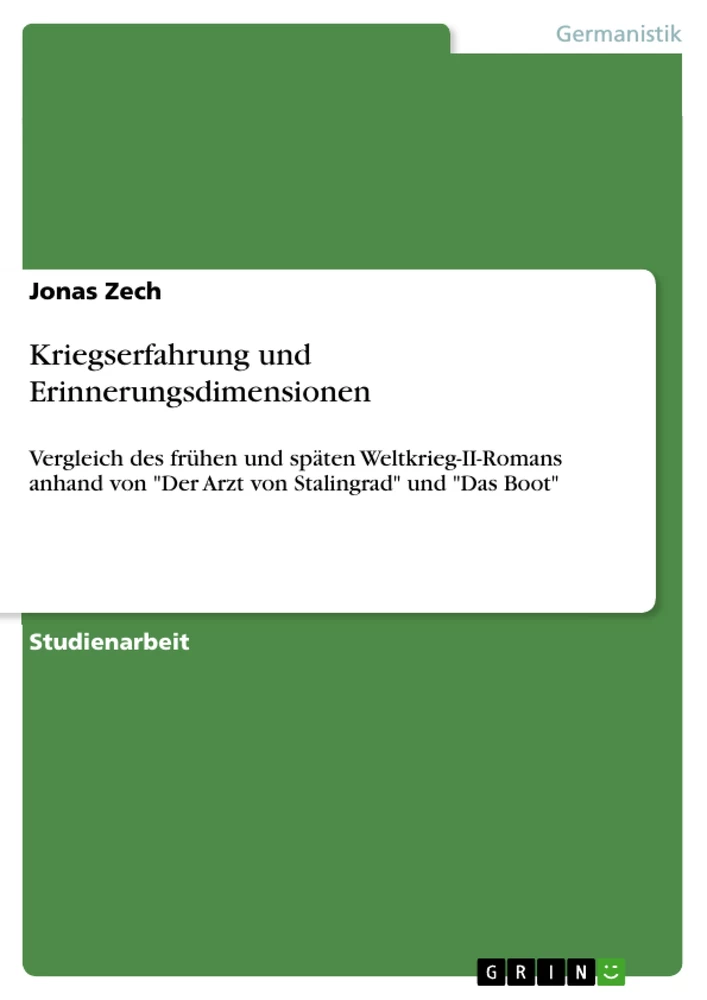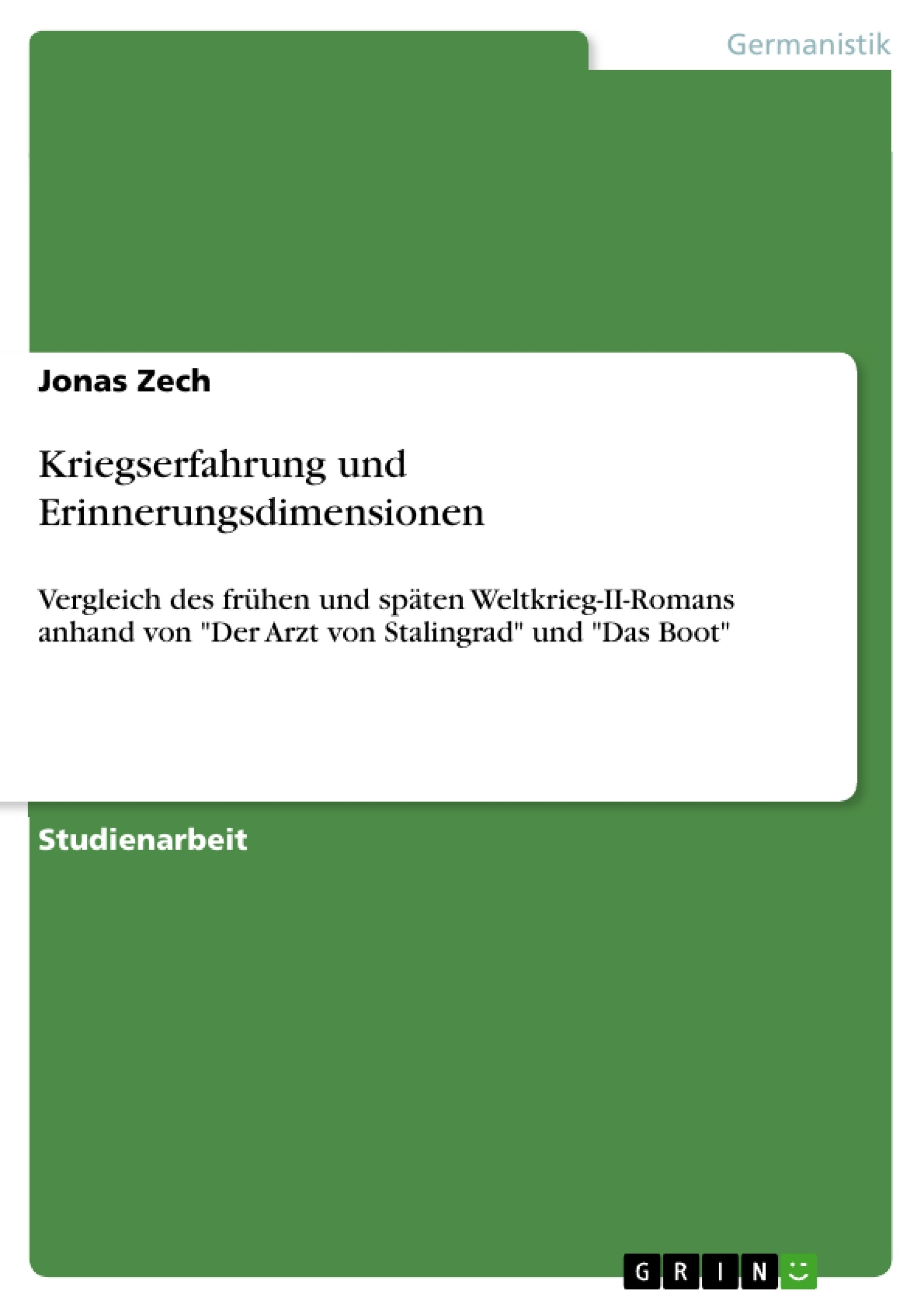Wenngleich der Zweite Weltkrieg mit all seinen Schrecken und ungekannten Gräueltaten
ganz sicher als die „größte historische Katastrophe der Deutschen“ gelten muss, so
war er doch auch, wie man ganz leidenschaftslos feststellen muss, einfach das zentrale
Ereignis Europas und speziell der Deutschen im vergangen Jahrhundert.
Wie jedes große Ereignis hinterließ er Spuren; recht eindeutige in der Erinnerung eines
ganzen Kontinents, sehr widersprechende in der Erinnerung der Deutschen.
Kollektive Erinnerung ist natürlich stets im Wandel, ein andauernder Prozess, und dabei
stets den Formungen durch äußere Einwirkung und den nicht anhaltenden Weltenlauf
unterworfen. Solche äußeren Einwirkungen sind bei vielen Menschen Eindrücke, die ihre
eigenen Erinnerungen durch gehörte oder gelesene fremde Erinnerungen umdeuten,
verfälschen, erweitern, bereichern. Insofern ist gerade die Kriegsliteratur ein mächtiges
Werkzeug für das Formen kollektiver Erinnerungen.
Die vorliegende Untersuchung will nicht so sehr einen rein literaturwissenschaftlichanalytischen
Romanvergleich liefern, weshalb hier auf eine ausgeprägte Darstellung
von Figurenkonstellationen und Plot-Nachzeichnungen ebenso verzichtet wird wie auf
intensive Interpretationsansätze.
Diese Arbeit versteht sich vielmehr als literaturgeschichtsphilosophische Grundlagenarbeit,
die einen Beitrag leisten möchte für die künftige, interdisziplinäre Gedächtnisforschung
zu bewältigbaren Kollektiverinnerungen der Deutschen bezüglich des Zweiten
Weltkrieges. Denn, wie schon Kant erkannt hatte, es wird künftige Generationen „in
wenigen Jahrhunderten“ nur noch interessieren, was die vorherigen „in weltbürgerlicher
Absicht zu leisten“ im Stande waren, und nur die Fortschritte jeder Generation an die
Nachkommen weiterzugeben kann sinnvoller Inhalt eines Erziehungsbegriffes sein.
„Vielleicht daß die Erziehung immer besser werden und daß jede folgende Generation
einen Schritt näher thun wird zur Vervollkommnung der Menschheit; denn hinter der
Education steckt das große Geheimniß der Vollkommenheit der menschlichen Natur.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Darstellung des Untersuchungsgebietes
- Weltkriegsliteratur als kollektives Erinnerungsprojekt und die Schwierigkeiten der geteilten Kriegserfahrung
- Krieg und Roman
- Unterschiede in der literarischen Aufbereitung der beiden Weltkriege
- Der frühe und der späte Roman zum Zweiten Weltkrieg
- Zur Wahl der Autoren und Romane
- Konsaliks Roman Der Arzt von Stalingrad (1956)
- Kriegserfahrung und Entstehungsgeschichte
- ...nach Angaben Heinz G. Konsaliks
- nach Ergebnissen der Forschungsliteratur
- Handlungsraum und Figurenkonstellation
- Der Mythos als Grundlage des narrativen Schemas
- ,Viktimisierungʻ als telos, topos und selling point
- Kriegserfahrung und Entstehungsgeschichte
- Buchheims Roman Das Boot (1973)
- Kriegserfahrung und Entstehungsgeschichte
- Entlarvung durch Überzeichnung, Zynismus und Persiflage
- Fiktionalisierung und (Ent-)Mythisierung
- Gegenüberstellung beider Romane und Vergleich der Darstellung der Kriegserlebnisse
- Darstellung des Untersuchungsgebietes
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Darstellung von Kriegserfahrungen und Erinnerungsdimensionen im Kontext des Zweiten Weltkriegs, anhand eines Vergleichs des frühen Romans „Der Arzt von Stalingrad“ von Heinz G. Konsalik und des späten Romans „Das Boot“ von Lothar-Günther Buchheim. Ziel ist es, die unterschiedlichen Perspektiven auf die Kriegserfahrung und die Entwicklung der kollektiven Erinnerung in der deutschen Literatur zu analysieren.
- Entwicklung der kollektiven Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in Deutschland
- Unterschiede in der Darstellung von Kriegserfahrungen in frühen und späten Weltkrieg-II-Romanen
- Bedeutung von Mythen und Viktimisierung in der Kriegserzählung
- Einfluss der subjektiven Kriegserfahrung der Autoren auf deren schriftstellerisches Werk
- Analyse der literarischen Mittel zur Vermittlung von Kriegserlebnissen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Untersuchung von Kriegserfahrungen und Erinnerungsdimensionen im Kontext des Zweiten Weltkriegs heraus. Sie beleuchtet die Bedeutung der Kriegsliteratur für die Gestaltung kollektiver Erinnerungen und die Notwendigkeit, die Geschichte des Zweiten Weltkriegs aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.
Der Hauptteil der Arbeit gliedert sich in drei Abschnitte. Der erste Abschnitt widmet sich der Darstellung des Untersuchungsgebietes. Er beleuchtet die Besonderheiten der Weltkriegsliteratur als kollektives Erinnerungsprojekt und die Schwierigkeiten, die sich aus den unterschiedlichen Kriegserfahrungen ergeben. Im zweiten Abschnitt wird Konsaliks Roman „Der Arzt von Stalingrad“ analysiert. Dieser Abschnitt befasst sich mit der Kriegserfahrung des Autors, der Handlungsraum und Figurenkonstellation des Romans sowie dem Einfluss von Mythen und Viktimisierung auf die Erzählung. Der dritte Abschnitt behandelt Buchheims Roman „Das Boot“. Hier werden die Kriegserfahrung des Autors, die Entlarvung von Mythen durch Überzeichnung und Zynismus sowie die Fiktionalisierung und (Ent-)Mythisierung in der Erzählung analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Kriegserfahrung, Erinnerung, Weltkriegsliteratur, kollektive Erinnerung, Viktimisierung, Mythen, Fiktionalisierung, (Ent-)Mythisierung, Romanvergleich, „Der Arzt von Stalingrad“, „Das Boot“, Heinz G. Konsalik, Lothar-Günther Buchheim.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheiden sich frühe und späte Romane zum Zweiten Weltkrieg?
Frühe Romane (wie bei Konsalik) nutzen oft Mythen und Viktimisierung, während spätere Werke (wie bei Buchheim) eher durch Zynismus und Entmythisierung geprägt sind.
Worum geht es in Konsaliks "Der Arzt von Stalingrad"?
Der Roman thematisiert die deutsche Kriegsgefangenschaft und nutzt das Motiv des leidenden, aber moralisch überlegenen deutschen Soldaten.
Welchen Ansatz verfolgt Lothar-Günther Buchheim in "Das Boot"?
Buchheim nutzt Überzeichnung und Realismus, um den Seekrieg zu entlarven und die Sinnlosigkeit sowie den Horror des U-Boot-Krieges darzustellen.
Was bedeutet "Viktimisierung" in der Kriegsliteratur?
Es beschreibt die literarische Tendenz, die eigenen Soldaten primär als Opfer der Umstände oder des Systems darzustellen, um von der Schuldfrage abzulenken.
Welche Rolle spielt die kollektive Erinnerung in dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie Literatur als Werkzeug dient, um das Bild des Krieges im Gedächtnis der deutschen Gesellschaft über Generationen hinweg zu formen.
- Arbeit zitieren
- Jonas Zech (Autor:in), 2008, Kriegserfahrung und Erinnerungsdimensionen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118566