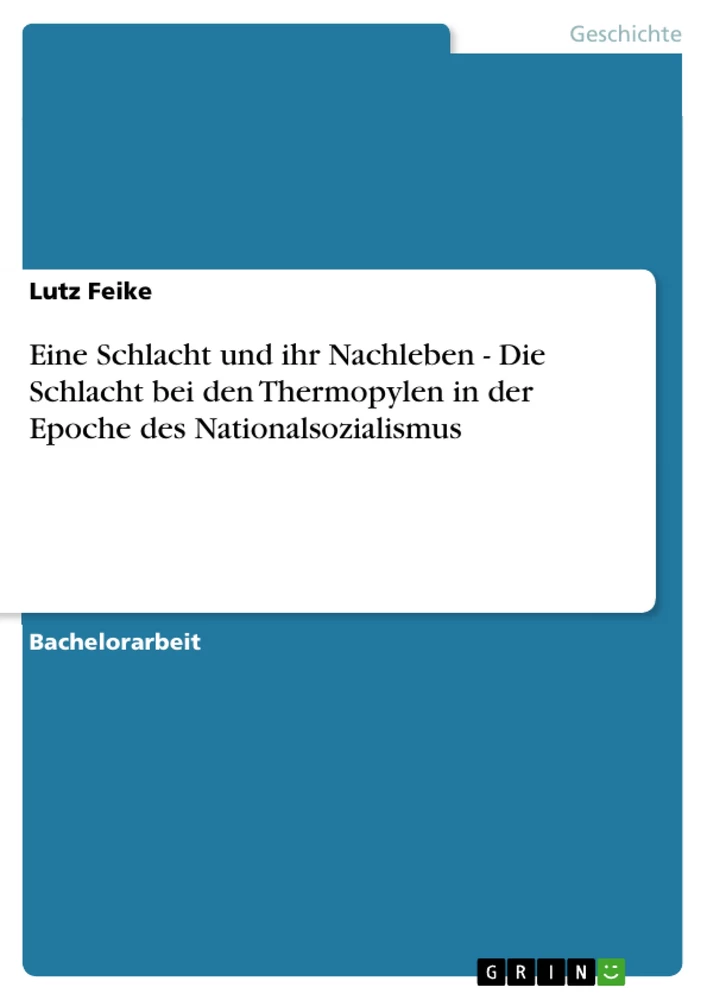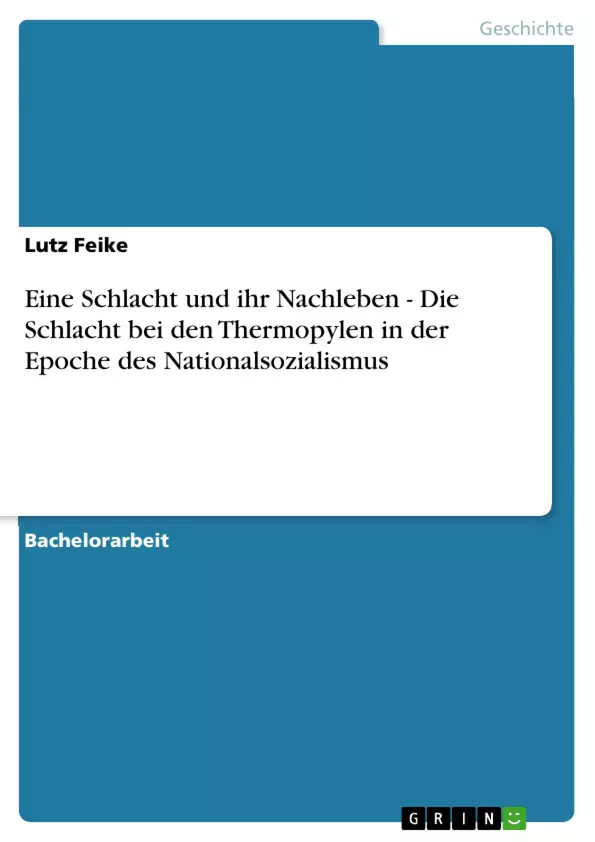Besonders totalitäre Regime beziehen sich seit jeher auf vergangene Ereignisse, um ihre Machtstellung im Innern zu festigen und zu legitimieren. So findet die Instrumentalisierung eines historischen Exempels gerade bei innenpolitischen Krisen Verwendung.
Auch in der Epoche des Nationalsozialismus musste sich die politische Führung Anfang 1943 einer drohenden Destabilisierung ihres Systems entgegenstemmen. Auslöser hierfür war die verlorene Schlacht in Stalingrad, bei der hunderttausende deutsche Soldaten den Tod fanden, nachdem sie im November 1942 von den sowjetischen Armeen eingekesselt wurden. Die Niederlage ist der skrupellosen Kriegsführung der Parteispitze zuzuschreiben, die sich nicht davor scheute, ihre Truppen in der auswegslosen Lage ihrem Schicksal zu überlassen. Um ihre Machtstellung im Reich zu sichern, ging die NS-Führung die Taktik ein, der Öffentlichkeit die negativen Ereignisse an der Wolga zu verschweigen. Doch als Nachrichten über die tragischen Entwicklungen in Russland Angehörige der in Stalingrad festsitzenden Soldaten erreichte, zweifelten nicht nur (wie im Verlauf der Schlacht zunehmend der Fall) Teile des Generalstabs der Wehrmacht an Hitlers militärischen Führungsqualitäten, sondern auch die deutsche Bevölkerung.
Die Sorge vor dem Loyalitätsverlust zwang die NS-Führung schließlich, die Strategie der Verschwiegenheit aufzugeben und die Niederlage in Stalingrad zuzugeben. Mit dieser Aufgabe wurde Reichsmarschall Hermann Göring betraut, der mit einer Rede am 30.1.1943, dem zehnten Jahrestag der Machtergreifung, an die Öffentlichkeit trat. Darin bemühte er sich, die militärischen Fehlentscheidungen in Russland unter Einbezug der Schlacht bei den Thermopylen zu rechtfertigen. Der Tod des Spartiatenkönigs Leonidas im Kampf gegen das riesige Perserheer des Xerxes 480 vor Christus, war lange vor Beginn des "Dritten Reichs" im Bewusstsein breiter Kreise des damaligen Bildungsbürgertums, insbesondere der Offiziersfamilien, verankert.
Inwiefern sich dieser Rückgriff tatsächlich dafür eignete, die Katastrophe von Stalingrad zu legitimieren, und zugleich die sich verschlechternde Stimmung ranghoher Offiziere und der deutschen Bevölkerung abzufangen, möchte diese Arbeit aufdecken.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Schlacht bei den Thermopylen 480 v. Chr.
- 2.1 Der Verlauf der Schlacht
- 2.2 Herodot als Richtungsgeber der späteren Rezeption
- 3 Die Schlacht um Stalingrad 1942/43
- 3.1 Informationen zur Schlacht
- 3.2 Reaktionen auf die Schlacht
- 4 Der Vergleich der Schlacht von Stalingrad mit der Schlacht bei den Thermopylen in Görings Rede vom 30.1.1943
- 4.1 Die Bedeutung der antiken Schlacht bei Göring
- 4.2 Wirkung des Vergleichs auf…
- 4.2.1 …die Bevölkerung
- 4.2.2 …die Offiziere
- Schlussbetrachtung
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- 6.1 Quellen
- 6.2 Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, inwiefern der von Reichsmarschall Hermann Göring in seiner Rede am 30. Januar 1943 gezogene Vergleich zwischen der Schlacht von Stalingrad und der Schlacht bei den Thermopylen dazu diente, dem wachsenden Unmut in der Bevölkerung und im Generalstab der Wehrmacht entgegenzuwirken. Die Arbeit analysiert Görings rhetorische Strategie im Kontext der innenpolitischen Krise nach der Niederlage in Stalingrad.
- Analyse von Görings Rede vom 30.1.1943 und der Verwendung des Vergleichs zwischen Stalingrad und Thermopylae.
- Untersuchung der herodoteischen Überlieferung der Schlacht bei den Thermopylen und deren Bedeutung für die NS-Propaganda.
- Bewertung der Wirkung des Vergleichs auf die deutsche Bevölkerung und die Offiziere.
- Einordnung des Vergleichs in den Kontext der innenpolitischen Lage des Nationalsozialistischen Regimes im Jahre 1943.
- Untersuchung der Instrumentalisierung historischer Ereignisse zur Legitimation von Herrschaft im Nationalsozialismus.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Problematik der innenpolitischen Krise im Nationalsozialistischen Deutschland nach der Niederlage in Stalingrad und die darauf folgende Strategie der NS-Führung, die negative Stimmung in der Bevölkerung und im Militär durch gezielte Propaganda zu beeinflussen. Der Fokus liegt auf Görings Rede vom 30. Januar 1943 und dem darin enthaltenen Vergleich zwischen Stalingrad und den Thermopylen, welcher im Zentrum der Analyse steht. Die Arbeit grenzt ihren Untersuchungsgegenstand deutlich ab und benennt die wichtigsten Quellen.
2 Die Schlacht bei den Thermopylen 480 v. Chr.: Dieses Kapitel skizziert den Verlauf der Schlacht bei den Thermopylen und analysiert die herodoteische Überlieferung des Ereignisses. Es werden die Elemente der Überlieferung herausgearbeitet, die für die spätere Rezeption, insbesondere im Kontext von Görings Rede, relevant sind. Der Fokus liegt auf der Darstellung des mutigen, aber letztlich vergeblichen Kampfes der griechischen Truppen gegen die zahlenmäßig weit überlegenen Perser, eine narrative Struktur, die für die NS-Propaganda instrumentalisiert werden konnte.
3 Die Schlacht um Stalingrad 1942/43: Dieses Kapitel liefert detaillierte Informationen zur Schlacht von Stalingrad, inklusive des Verlaufs, der militärischen Entscheidungen und der Reaktionen der Befehlshaber. Es wird die katastrophale Lage der deutschen Truppen und die immensen Verluste beschrieben. Darüber hinaus werden die Reaktionen der deutschen Bevölkerung und der Offiziere auf die Niederlage dargestellt, um den Handlungsdruck auf die NS-Führung und die Notwendigkeit der Propaganda-Maßnahmen zu verdeutlichen. Die Stimmung der Bevölkerung, geprägt von Zensur und den verspäteten Informationen über die Ausmaße der Katastrophe, wird als ein zentraler Faktor dargestellt.
4 Der Vergleich der Schlacht von Stalingrad mit der Schlacht bei den Thermopylen in Görings Rede vom 30.1.1943: Dieses Kapitel analysiert Görings Rede vom 30. Januar 1943 und konzentriert sich auf den Vergleich zwischen den Schlachten von Stalingrad und den Thermopylen. Es wird untersucht, welche Elemente der herodoteischen Überlieferung Göring verwendete und inwiefern diese für seinen Vergleich geeignet waren. Die Analyse umfasst die inhaltliche Ebene des Vergleichs (die Parallelen und Unterschiede zwischen den Schlachten) und die Wirkung des Vergleichs auf die Bevölkerung und die Offiziere. Es wird analysiert, ob der Vergleich dazu beitrug, die negative Stimmung zu mildern oder ob er eher kontraproduktiv war.
Schlüsselwörter
Schlacht bei den Thermopylen, Schlacht von Stalingrad, Hermann Göring, Nationalsozialismus, Propaganda, Innenpolitik, Herodot, historische Instrumentalisierung, deutsche Bevölkerung, Wehrmacht, Militär, Kriegsführung, Krisenmanagement.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse von Görings Rede vom 30. Januar 1943
Was ist der Gegenstand der Analyse?
Die Analyse untersucht, wie Reichsmarschall Hermann Göring in seiner Rede am 30. Januar 1943 den Vergleich zwischen der Schlacht von Stalingrad und der Schlacht bei den Thermopylen nutzte, um dem wachsenden Unmut in der Bevölkerung und im Generalstab der Wehrmacht entgegenzuwirken. Der Fokus liegt auf Görings rhetorischer Strategie im Kontext der innenpolitischen Krise nach der Niederlage in Stalingrad.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Analyse von Görings Rede, die Untersuchung der herodoteischen Überlieferung der Schlacht bei den Thermopylen und deren Bedeutung für die NS-Propaganda, die Bewertung der Wirkung des Vergleichs auf die deutsche Bevölkerung und die Offiziere, die Einordnung des Vergleichs in den Kontext der innenpolitischen Lage 1943 und die Instrumentalisierung historischer Ereignisse zur Legitimation von Herrschaft im Nationalsozialismus.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit benennt die wichtigsten Quellen im Quellen- und Literaturverzeichnis (Kapitel 6). Die genaue Auflistung der Quellen und Literatur findet sich im entsprechenden Kapitel der vollständigen Arbeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die die Problematik der innenpolitischen Krise beschreibt; ein Kapitel über die Schlacht bei den Thermopylen und ihre herodoteische Überlieferung; ein Kapitel über die Schlacht von Stalingrad und die Reaktionen darauf; eine Analyse von Görings Rede und dem Vergleich zwischen den beiden Schlachten; sowie eine Schlussbetrachtung und ein Quellen- und Literaturverzeichnis.
Was ist die zentrale These der Analyse?
Die zentrale These ist, dass Göring den Vergleich zwischen Stalingrad und Thermopylae als propagandistisches Mittel einsetzte, um die Stimmung in der Bevölkerung und im Militär zu beeinflussen und die innenpolitische Krise nach der Niederlage von Stalingrad zu bewältigen. Die Analyse untersucht, ob diese Strategie erfolgreich war.
Welche Aspekte der Schlacht bei den Thermopylen werden untersucht?
Die Analyse untersucht den Verlauf der Schlacht, die herodoteische Überlieferung und die Elemente dieser Überlieferung, die für die spätere Rezeption, insbesondere im Kontext von Görings Rede, relevant sind. Der Fokus liegt auf der Darstellung des mutigen, aber vergeblichen Kampfes der Griechen gegen die Perser.
Wie wird die Schlacht von Stalingrad dargestellt?
Das Kapitel über Stalingrad beschreibt detailliert den Verlauf der Schlacht, die militärischen Entscheidungen, die immensen Verluste und die Reaktionen der deutschen Bevölkerung und Offiziere. Die katastrophale Lage der deutschen Truppen und die Stimmung der Bevölkerung werden als zentrale Faktoren dargestellt.
Wie wird Görings Rede analysiert?
Die Analyse von Görings Rede konzentriert sich auf den Vergleich zwischen Stalingrad und Thermopylae. Untersucht werden die verwendeten Elemente der herodoteischen Überlieferung, die inhaltliche Ebene des Vergleichs (Parallelen und Unterschiede), und die Wirkung des Vergleichs auf die Bevölkerung und die Offiziere.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerung wird in der Schlussbetrachtung präsentiert und fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen. Sie bewertet die Wirkung des Vergleichs und seine Rolle im Kontext der NS-Propaganda und der innenpolitischen Krise.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schlacht bei den Thermopylen, Schlacht von Stalingrad, Hermann Göring, Nationalsozialismus, Propaganda, Innenpolitik, Herodot, historische Instrumentalisierung, deutsche Bevölkerung, Wehrmacht, Militär, Kriegsführung, Krisenmanagement.
- Arbeit zitieren
- B.A. Lutz Feike (Autor:in), 2008, Eine Schlacht und ihr Nachleben - Die Schlacht bei den Thermopylen in der Epoche des Nationalsozialismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118602