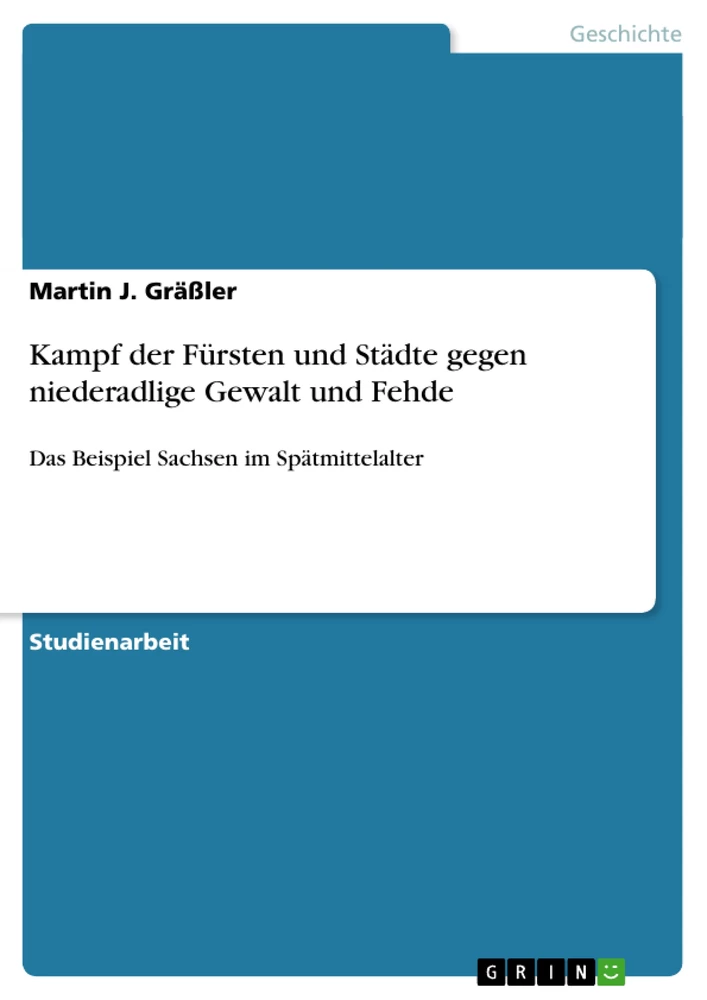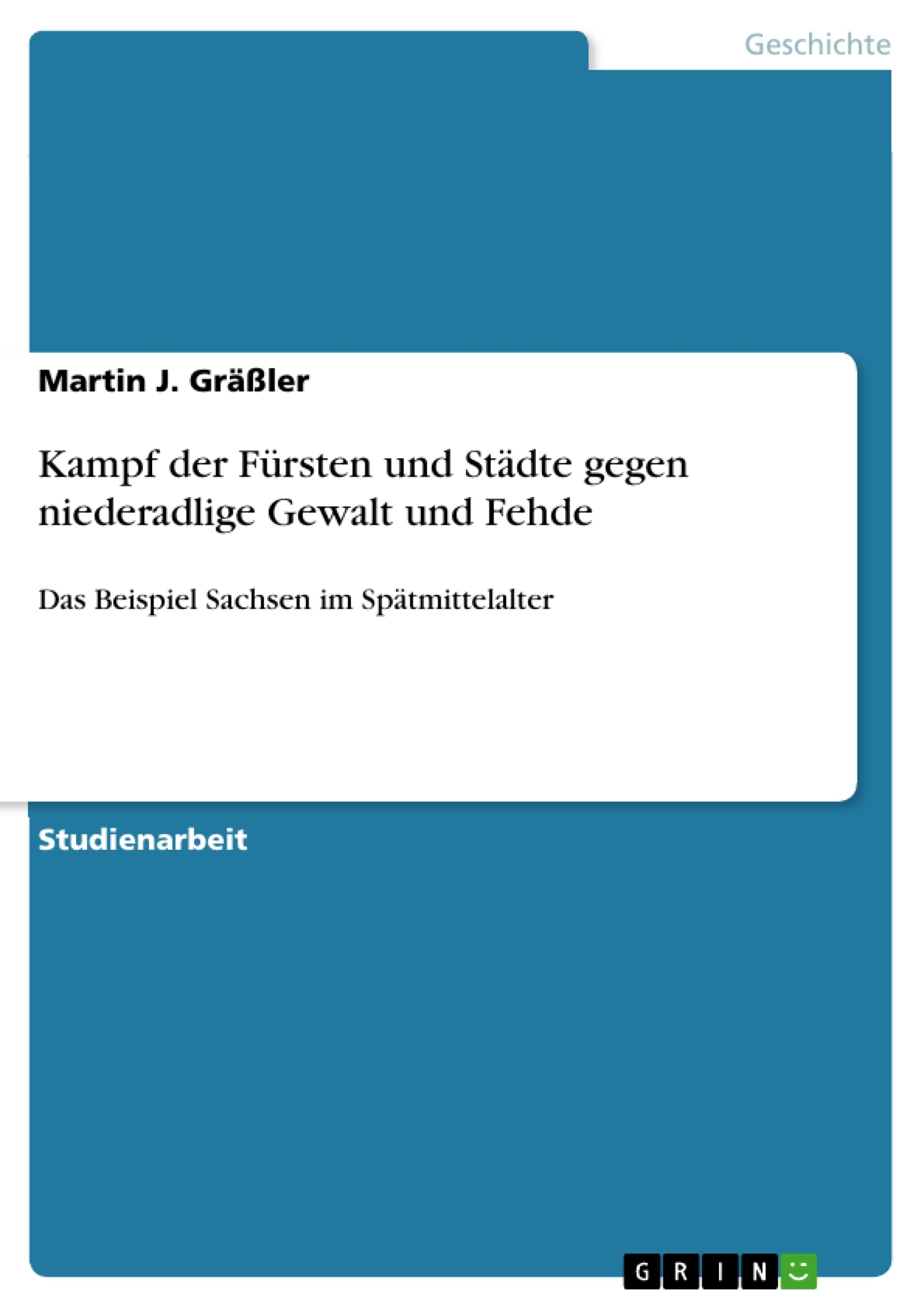Die Fehde war während des hohen und späten Mittelalters und bis hinein in die Frühe Neuzeit
eine wichtige Legitimation, um mit Gewalt für die eigenen Interessen zu streiten. Dabei
bedienten sich Landesfürsten, Städte, selbst Bürger dieser als Rechtsmittel verstanden
Maßnahme der Austragung von Konflikten. Aber nicht diese Gruppen sollen im Zentrum der
vorliegenden Arbeit stehen, vielmehr soll eine Betrachtung der Fehde als Rechtsmittel des
Niederadels und die Bekämpfung derselben durch Landesherr und Stadt erfolgen. Dabei soll
der umstrittene Begriff des „Raubritters“ vermieden werden, welcher, obwohl ein Konstrukt
der neueren Geschichtsschreibung, zunehmend wieder in der Diskussion steht. An dieser
Stelle wird ebenjene Debatte bewusst ausgeblendet, da diese für die Betrachtung des
Kampfes, sowohl der Städte als auch der Fürsten, gegen die Gewalt des Niederadels kaum
eine Bedeutung hat. Es ist letztlich gleich, ob die Gewalt von einer rechten Fehde oder von
einem Überfall durch einen „Raubritter“ ausging. Bekämpft wurde niederadlige Gewalt
per se, sofern sie den Interessen der Städte oder des Landesherrn zuwiderlief.
Zu Beginn werden die zeitgenössischen Beweggründe benannt, die im späten Mittelalter als
Grund für eine Fehde herhalten konnten. Aber auch bei einem gewichtigen Anlass und
entsprechend gegebenen Streitfall durfte nicht sofort eine offene Feindschaft erklärt werden.
Vielmehr musste zuerst eine friedliche Beilegung des Streitfalles über Gerichte oder
Schiedsleute versucht werden. Erst mit dem Scheitern einer gütlichen Einigung konnte eine
Fehde in adligen Kreisen als rechtens angesehen werden. Mit dem Scheitern der friedlichen
Konfliktbeilegung sollte eine förmliche Ankündigung der Feindschaft erfolgen, welche
bestimmte Ansprüche in Form, Inhalt und Übergabe erfüllen musste. Der Fehdebrief schied
die Fehde vom gesetzlosen Überfall und war für die juristische Bewertung der Tat von
entscheidender Bedeutung. Aber auch in der Durchführung der Auseinandersetzung gab es,
wenngleich wenige und häufig missachtete, Regeln, die die schlimmsten Schäden gegenüber
Land und Leuten begrenzen sollten. Die Charakteristik der Fehde als Problem für Sicherheit
und Wohlstand der Städte im späten Mittelalter schließt den ersten Teil der Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Fehdeführung des Niederadels
- Beweggründe für Fehdeführung
- Alternative Rechtsmittel
- Fehdebrief
- Fehdeführung
- Missbrauch der Fehde
- Kampf gegen die Fehde
- Landesherren und Städte
- Einschränkung des Fehderechts
- Einige Beispiele aus Sachsen
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Fehde als Rechtsmittel des niederen Adels im späten Mittelalter und der Frühen Neuzeit in Sachsen und die darauf folgende Bekämpfung durch Landesherren und Städte. Im Fokus steht die Analyse der Motive für Fehden, die Möglichkeiten alternativer Konfliktlösung und die Strategien zur Eindämmung der niederadligen Gewalt.
- Motive und Beweggründe für Fehden des Niederadels
- Alternative Rechtsmittel und Konfliktlösungsmechanismen
- Strategien der Landesherren und Städte zur Bekämpfung der Fehde
- Rechtliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen der Fehde
- Entwicklung des staatlichen Gewaltmonopols und der Rückgang der Fehde
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Arbeit untersucht die Fehde des niederen Adels im späten Mittelalter und in der Frühen Neuzeit in Sachsen, konzentriert sich auf die Bekämpfung dieser durch Landesherren und Städte und vermeidet den umstrittenen Begriff des „Raubritters“. Die Einleitung betont die Bedeutung der Fehde als Rechtsmittel und skizziert den Ansatz der Arbeit, der sich auf die zeitgenössischen Beweggründe für Fehden konzentriert und die Rolle der alternativen Rechtsmittel vor der Eskalation zu offener Feindschaft beleuchtet.
Fehdeführung des Niederadels: Dieses Kapitel analysiert die Beweggründe für Fehden des niederen Adels. Es differenziert zwischen „rechten“ Fehden, die auf Schadensersatzansprüchen oder Vertragsverletzungen beruhten, und „unrechten“ Fehden, die aus Rache, politischen Zielen oder Habgier entstanden. Es werden Beispiele für beide Arten von Fehden aufgeführt und die jeweiligen rechtlichen und sozialen Konsequenzen diskutiert. Die Einhaltung von Regeln der Fehdeführung, wie z.B. die formale Ankündigung der Feindschaft durch einen Fehdebrief, wird ebenfalls thematisiert, ebenso wie der Missbrauch der Fehde als Mittel zur Durchsetzung ungerechtfertigter Interessen.
Kampf gegen die Fehde: Dieses Kapitel behandelt die Reaktion von Landesherren und Städten auf die zunehmende Gewalt des niederen Adels. Es beschreibt, wie Landesherren die Fehde als Untergrabung ihrer Macht ansahen und wie Städte ihre wirtschaftlichen Interessen durch die Fehden bedroht sahen. Das Kapitel beleuchtet die gemeinsamen Interessen im Kampf gegen die Fehde und beschreibt die konkreten Maßnahmen, die ergriffen wurden, darunter die Bildung mächtiger Bündnisse, die Zerstörung von „Raubburgen“ und die Eingriffe der sächsischen Territorialherren in Fehden. Die allmähliche Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols im 16. Jahrhundert und der damit verbundene Rückgang der Fehde werden als Ergebnis dieser Bemühungen dargestellt.
Einige Beispiele aus Sachsen: Dieses Kapitel präsentiert konkrete Beispiele aus Sachsen, die die Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung der niederadligen Gewalt verdeutlichen. Es analysiert verschiedene Fälle und zeigt auf, wie Landesherren und Städte auf die jeweiligen Situationen reagierten und wie effektiv ihre Maßnahmen waren. Diese Beispiele dienen als Illustration der im vorherigen Kapitel beschriebenen Entwicklungen und verdeutlichen die konkreten Auswirkungen der Strategien zur Eindämmung der Fehden auf die regionale Situation in Sachsen.
Schlüsselwörter
Fehde, Niederadel, Sachsen, Spätmittelalter, Frühe Neuzeit, Landesherren, Städte, Gewalt, Rechtsmittel, Konfliktlösung, Gewaltmonopol, Territorialstaat, Raubritter (als diskutierter Begriff).
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Fehde des Niederadels in Sachsen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Fehde als Rechtsmittel des niederen Adels im späten Mittelalter und der Frühen Neuzeit in Sachsen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Analyse der Motive für Fehden, alternativer Konfliktlösungsmechanismen und der Strategien zur Eindämmung der niederadligen Gewalt durch Landesherren und Städte. Der umstrittene Begriff des "Raubritters" wird dabei vermieden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Beweggründe für Fehden des Niederadels (einschließlich "rechter" und "unrechter" Fehden), alternative Konfliktlösungsmethoden, die Strategien der Landesherren und Städte zur Bekämpfung der Fehde, die rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Fehde sowie die Entwicklung des staatlichen Gewaltmonopols und den damit einhergehenden Rückgang der Fehde.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, ein Kapitel zur Fehdeführung des Niederadels, ein Kapitel zum Kampf gegen die Fehde, ein Kapitel mit Beispielen aus Sachsen und abschließende Schlussbetrachtungen. Jedes Kapitel analysiert einen spezifischen Aspekt des Themas.
Was wird im Kapitel "Fehdeführung des Niederadels" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die Motive für Fehden, differenziert zwischen "rechten" (Schadensersatzansprüche, Vertragsverletzungen) und "unrechten" Fehden (Rache, politische Ziele, Habgier), beschreibt die rechtlichen und sozialen Konsequenzen und thematisiert die Einhaltung von Regeln der Fehdeführung (z.B. Fehdebrief) sowie den Missbrauch der Fehde.
Was wird im Kapitel "Kampf gegen die Fehde" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die Reaktionen von Landesherren und Städten auf die zunehmende Gewalt des niederen Adels, ihre gemeinsamen Interessen im Kampf gegen die Fehde und die ergriffenen Maßnahmen (Bildung von Bündnissen, Zerstörung von "Raubburgen", Eingriffe der sächsischen Territorialherren). Der allmähliche Rückgang der Fehde im Zusammenhang mit der Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols im 16. Jahrhundert wird ebenfalls dargestellt.
Welche Rolle spielen die Beispiele aus Sachsen?
Das Kapitel mit den Beispielen aus Sachsen verdeutlicht die Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung der niederadligen Gewalt anhand konkreter Fälle. Es zeigt die Reaktionen der Landesherren und Städte und die Effektivität ihrer Maßnahmen, illustriert die im vorherigen Kapitel beschriebenen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die regionale Situation in Sachsen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter charakterisiert: Fehde, Niederadel, Sachsen, Spätmittelalter, Frühe Neuzeit, Landesherren, Städte, Gewalt, Rechtsmittel, Konfliktlösung, Gewaltmonopol, Territorialstaat, Raubritter (als diskutierter Begriff).
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Fehde als Rechtsmittel des niederen Adels und die darauf folgende Bekämpfung durch Landesherren und Städte. Der Fokus liegt auf der Analyse der Motive für Fehden, alternativer Konfliktlösungsmechanismen und der Strategien zur Eindämmung der niederadligen Gewalt.
- Quote paper
- cand. phil. Martin J. Gräßler (Author), 2008, Kampf der Fürsten und Städte gegen niederadlige Gewalt und Fehde, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118632