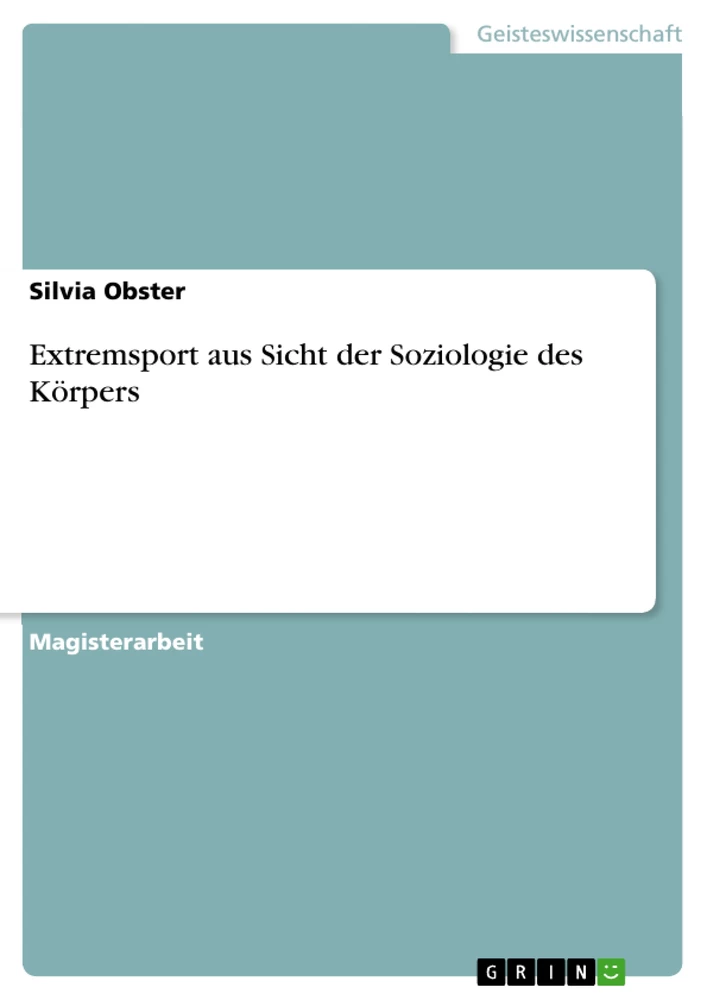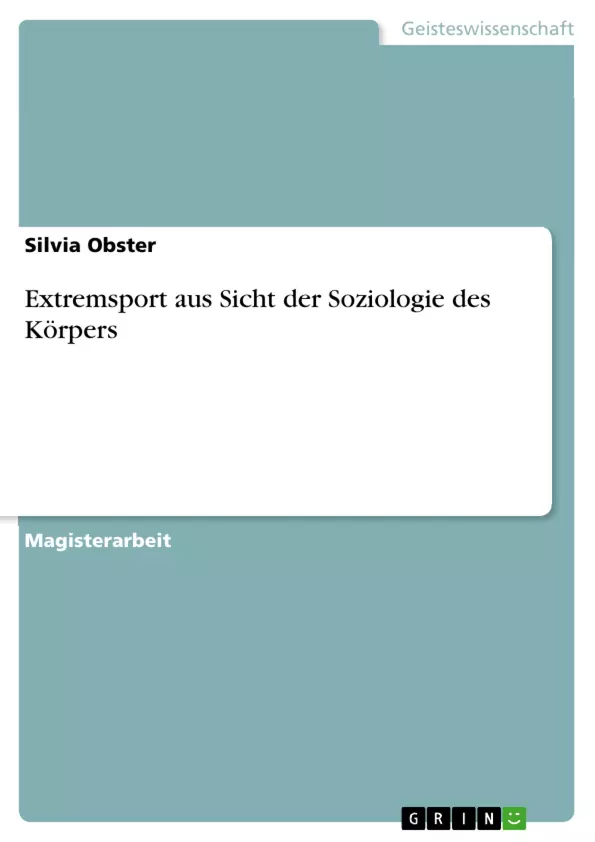„Natur Pur – Mit Freunden Abenteuerluft schnuppern“ wirbt das Prospekt einer Firma in Aschau im Chiemgau. Von Paragliding und Rafting über extremes Mountainbiking bis hin zu Canyoning und Erlebnistouren wie der „Patschnaßtour“, „Schlucht’In“ und „Outside Programmen“: Bei „Natur Pur“ kann sich jeder seinen individuellen Extremsportplan in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zusammenstellen. Für ein entsprechendes Entgelt kann man unter professioneller Anleitung den besonderen Kick erleben, den sich offenbar immer mehr Menschen wünschen.
Aber warum ist das so? Warum setzt ein Mensch in seiner Freizeit seinen Körper und sein ganzes Leben freiwillig aufs Spiel? Kann der Wunsch nach Aufregung nicht auch mit einem spannenden Film kompensiert werden? Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigt sich diese Arbeit. Der Schwerpunkt liegt dabei nicht auf den persönlichen Gründen des Extremsportlers, die vor allem von der Psychologie erforscht werden, sondern auf den gesellschaftlichen Hinter-gründen. Sprich: Inwiefern ist die Gesellschaft und ihre Entwicklung dafür verantwortlich, dass der Extremsport entstehen konnte und nun so massenhaft von den Menschen betrieben wird? Zur Beantwortung dieser Frage werden modelltheoretische Ableitungen auf Grundlage gesellschaftstheoretischer Erkenntnisse vorgenommen. Der Extremsport wird in einen sozialen Kontext eingebettet. Dabei werden zur Erforschung des Entstehens und der Motive des Extremsports in hohem Maße die Erkenntnisse der Körpersoziologie herangezogen. Dieses relativ junge Teilgebiet der Soziologie beschäftigt sich mit dem gesellschaftlich beeinflussten Körper bzw. mit der „wechselseitigen Durchdringung von Körper und Gesellschaft“ (Gugutzer, 2004, S. 7). „Was immer wir mit unserem Körper tun, wie wir mit ihm umgehen, wie wir ihn einsetzen, welche Einstellung wir zu ihm haben, wie wir ihn bewerten, empfinden und welche Bedeutung wir dem Körper zuschreiben, all das ist geprägt von der Gesellschaft und der Kultur, in der wir leben“, schreibt Robert Gugutzer in seinem Buch „Soziologie des Körpers“ (2004, S. 5).[...]
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG: KÖRPERSOZIOLOGIE UND EXTREMSPORT
- I. Einführung und Problemstellung
- II. Aufbau der Arbeit
- TEIL A: EXTREMSPORT - BESCHREIBUNG DES GEGENSTANDES
- I. Definition von Extremsport
- 1. Was ist Extremsport? - Begriffliche Schwierigkeiten
- 2. Merkmale des Extremsports
- 3. Selbstkontrolle oder externalisierte Kontrolle beim Extremsport
- 4. Verletzungen und Tod: Die gefährlichsten Extremsportarten
- II. Beschreibung von Extremsportlern
- 1. Allgemeine Merkmale, Typus
- 2. Extremsport - Eine Männerdomäne?
- III. Entwicklung von Extremsport
- 1. Abenteuer und Risiko im Wandel der Zeit
- 2. Aufkommen und Verbreitung des Extremsports
- 3. Kommerzialisierung des Abenteuers: Der Extremsportler als Held
- IV. Paradoxien und Ambivalenzen im Extremsport
- 1. Individualitätserhaltung versus Massenverbreitung des Extremsports
- 2. Autonomie versus Kooperation mit Marktwirtschaft und den Medien
- 3. Ablehnung von Erfindungen der Moderne versus Benutzung von modernen Hilfsmitteln und Sicherheiten
- 4. Gefahrensuche versus Sicherheitsbedürfnis
- 5. Respekt vor Natur versus Naturschädigung
- TEIL B: EXTREMSPORT IN DER GESELLSCHAFT
- I. Allgemeine gesellschaftliche Theorien im Zusammenhang mit Extremsport
- 1. Die Leistungsgesellschaft
- 2. Die Risikogesellschaft
- 3. Die Erlebnisgesellschaft
- 4. Die Regulationstheorie
- II. Zusammenhang von Gesellschaft, Körper und der Entwicklung von Extremsport
- 1. Zivilisierung und Disziplinierung des Körpers
- 1.1 Erscheinungsbild des Sports
- 1.2 Die Rolle des Körpers
- 2. Neue Beachtung des Körpers: Sportvielfalt und Individualisierung
- 2.1 Erscheinungsbild des Sports
- 2.2 Paradoxie der gleichzeitigen Körperverdrängung und Körperaufwertung
- 2.3 Die Rolle des Körpers
- 3. Der Körper als soziales Gebilde, Sport und seine gesellschaftlichen Schranken
- 3.1 Traditioneller Sport im neuen Gewand?
- 3.2 Das „modern/anti-moderne Doppelgesicht“ des Extremsports
- III. Gesellschaftliche Hintergründe und daraus resultierende Motive für das Betreiben von Extremsport
- 1. Untersuchungsgegenstand
- 1.1 Ziel und Hypothese
- 1.2 Durchführung
- 2. Theoretische und empirische Ergebnisse
- 2.1 Extremsport als Gegenpol zur Körperverdrängung im Alltag
- 2.1.1 Wiederentdeckung von Körpereinsatz und körperlichem Erleben
- 2.1.2 Wiederbelebung der Sinne
- 2.1.3 Empirische Befunde
- 2.2 Extremsport als Mittel gegen den Verlust von Eindeutigkeits- und Evidenzerfahrungen
- 2.2.1 Evidenz durch die Intensität von Gefühlen
- 2.2.2 Evidenz durch das Erleben von natürlichen Größen und Kräften
- 2.2.3 Evidenz durch Flow
- 2.2.4 Empirische Befunde
- 2.3 Extremsport als Weg aus der eigenen Machtlosigkeit in der Gesellschaft
- 2.3.1 Erfahrung von Selbstermächtigung und Handlungswirksamkeit
- 2.3.2 Empirische Befunde
- 2.4 Extremsport als Kontrast zur heutigen Raum- und Gegenwartsverdrängung
- 2.4.1 Sinnliches Erleben von Räumen
- 2.4.2 Erleben von Zeit und Gegenwart
- 2.4.3 Empirische Befunde
- 2.5 Extremsport als Gegengewicht zur Alltagsroutine
- 2.5.1 Risikoerfahrungen gegen Reizarmut und Langeweile
- 2.5.2 Ungefährliches Ausleben von Aggression
- 2.5.3 Spaßorientierter Umgang mit Angst
- 2.5.4 Empirische Befunde
- 2.6 Extremsport als Unterstützung des heutigen Gebotes zur Distinktion
- 2.6.1 Selbstdarstellung durch die Gefährdung des Körpers
- 2.6.2 Dem Leben Stil verleihen
- 2.6.3 Empirische Befunde
- 2.7 Unterschiede in Theorie und Praxis und weitere Auffälligkeiten
- 3. Interpretation der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die gesellschaftlichen Hintergründe für die Entstehung und Verbreitung des Extremsports. Sie beleuchtet die Rolle der Körpersoziologie bei der Analyse von Extremsport und den Motiven der Extremsportler.
- Der Einfluss der Leistungs-, Risiko- und Erlebnisgesellschaft auf den Extremsport
- Die Entwicklung des Körpers und dessen Bedeutung in der Gesellschaft
- Die Ambivalenzen des Extremsports zwischen Individualität und Massenverbreitung, Autonomie und Kooperation
- Die Rolle der Körperverdrängung im Alltag und die Suche nach körperlicher Erfahrung im Extremsport
- Die Nutzung von Extremsport als Mittel zur Selbstermächtigung und zum Erleben von Zeit und Raum
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert. Teil A widmet sich der Definition von Extremsport, den Merkmalen von Extremsportlern und der Entwicklung des Extremsports. Teil B beleuchtet die Verbindung zwischen Extremsport und gesellschaftlichen Entwicklungen, insbesondere die Rolle des Körpers in der Gesellschaft. Die Arbeit beleuchtet die Motive für das Betreiben von Extremsport und deren gesellschaftlichen Wurzeln.
Schlüsselwörter
Extremsport, Körpersoziologie, Gesellschaft, Körper, Risikogesellschaft, Leistungsgesellschaft, Erlebnisgesellschaft, Individualisierung, Selbstermächtigung, Körperverdrängung, Zeit und Raum, Motivation, Ambivalenz.
- Arbeit zitieren
- Silvia Obster (Autor:in), 2005, Extremsport aus Sicht der Soziologie des Körpers, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118634