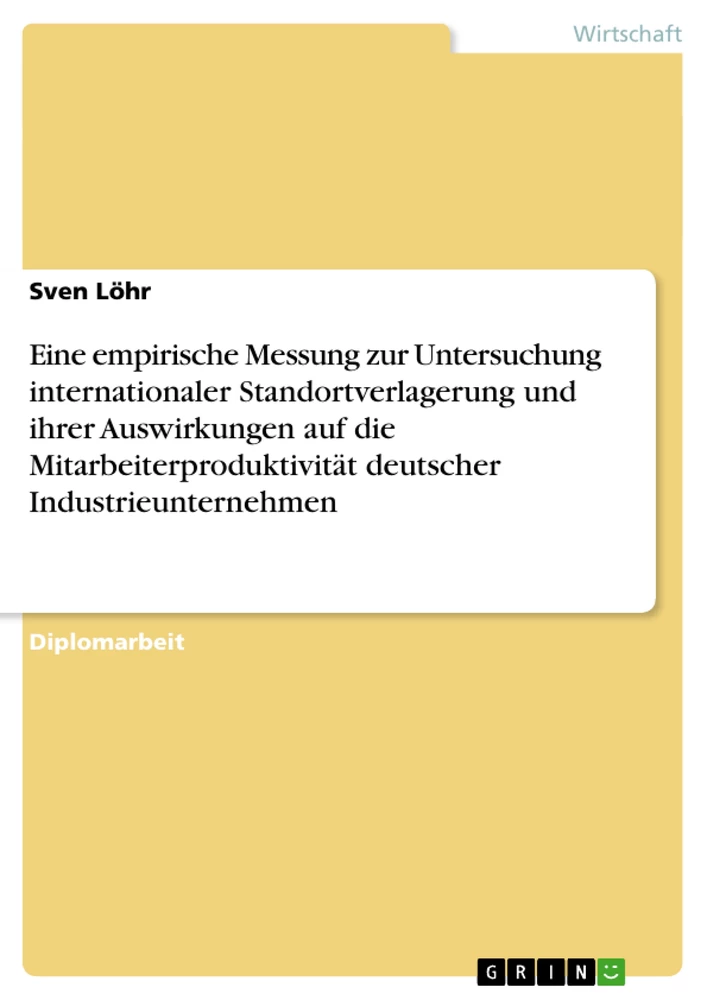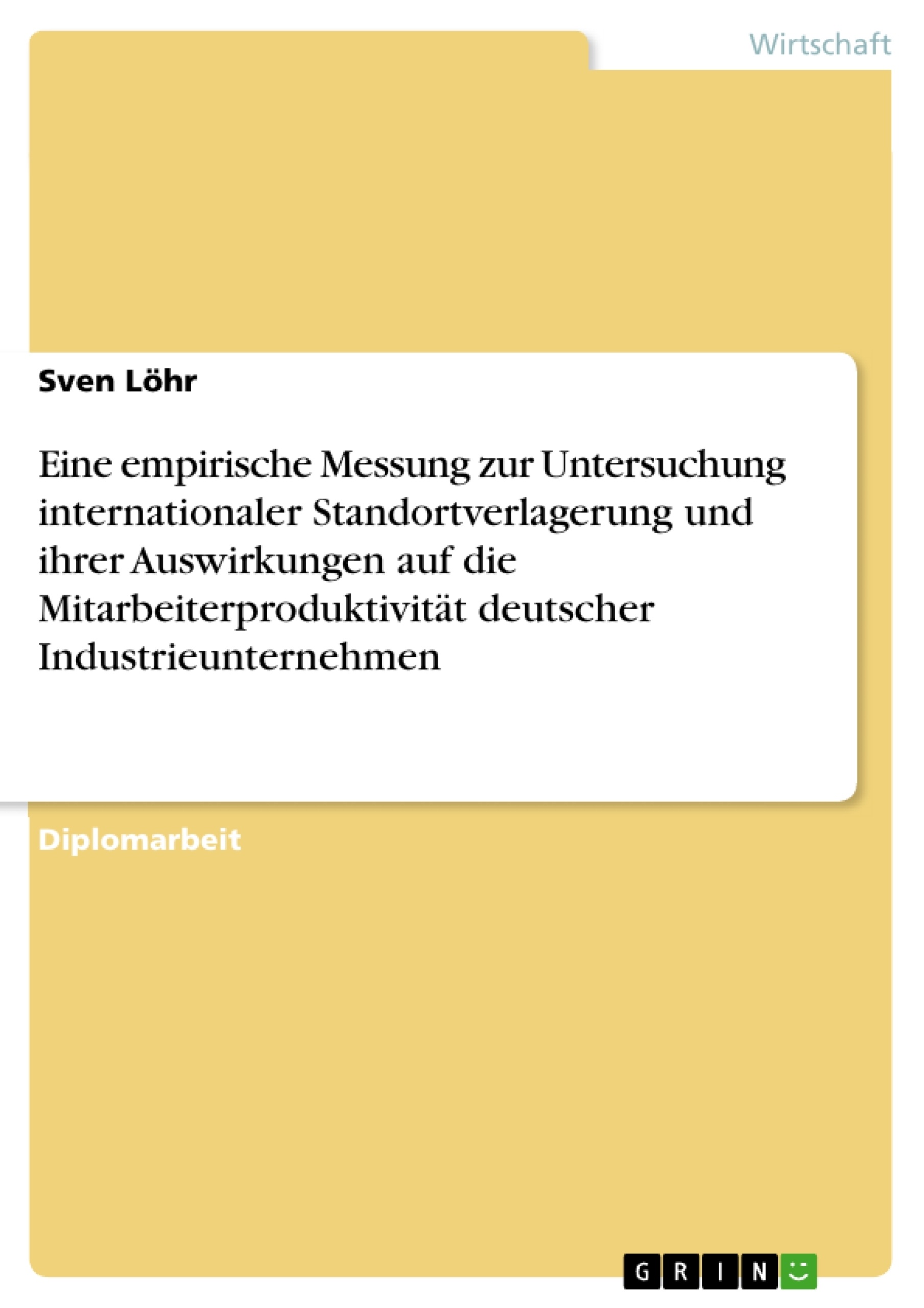Die vorliegende Arbeit verfolgt zwei primäre Ziele. Sie will aufzeigen, wie Internationalisierung auf Unternehmensebene gemessen werden kann und welche Auswirkungen eine Internationale Standortverlagerung auf die
Mitarbeiterproduktivität hat.
Eingangs soll erörtert werden, welche Möglichkeiten zur Messung Internationaler Standortverlagerungen existieren. Hintergrund dieser Fragestellung ist die bereits erwähnte Debatte über die Art der Messung (Bestimmung) eines Internationalisierungsgrades. Lediglich die Anzahl der Auslandsgesellschaften oder die Höhe des Auslandumsatzes der ausländischen Tochtergesellschaften zur Messung der Internationalisierung zu verwenden, erscheint bei genauer Betrachtung als unvollständig, eine Internationale Standortverlagerung zu
charakterisieren. Die bestehende Literatur zeigt verschiedene Messkonzepte auf, von denen einige im Rahmen dieser Arbeit dargestellt werden. Allerdings ist festzustellen, dass diese Konzepte weder einen inhaltlichen Konsens bzgl. ihrer Vorgehensweise aufweisen noch zu vergleichbaren Ergebnissen in ihren Untersuchungen gelangen. Da innerhalb der deutschen Literatur Untersuchungen bzgl. der Operationalisierung und Messung des Internationalisierungsphänomens bisher weitestgehend vernachlässigt werden, soll in der vorliegenden Arbeit versucht werden, einen Beitrag zu diesem noch jungen und uneinheitlich diskutiertem Forschungsgebiet zu leisten. Nachdem zunächst der Stand der methodischen Debatte in der Internationalisierungsforschung reflektiert wird, soll anhand einer eigenen empirischen Untersuchung gezeigt werden, dass Internationalisierung auf mehreren Dimensionen vollzogen wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung der Arbeit
- 1.3 Gang der Untersuchung
- 2 Standortverlagerung im Internationalisierungsprozess von Unternehmen
- 2.1 Begrifflichkeiten
- 2.2 Formen der Internationalen Standortverlagerung
- 2.2.1 Bestimmungsfaktoren für die Wahl der Verlagerungsform
- 2.2.2 Außenhandel
- 2.2.3 Direktinvestitionen
- 2.2.4 Vertragliche Kooperationsformen ohne Kapitalbeteiligung
- 2.3 Der Internationalisierungsprozess
- 2.3.1 Einfaches (deskriptives) Phasenmodell
- 2.3.2 Uppsala-Modell der Internationalisierung
- 2.3.3 Kritische Beurteilung
- 2.4 Grundtypen der Internationalisierung
- 2.4.1 Internationale Strategie (ethnozentrisch)
- 2.4.2 Multinationale Strategie (polyzentrisch)
- 2.4.3 Globale Strategie (geozentrisch)
- 2.4.4 Transnationale Strategie (synergetisch)
- 2.5 Motive einer Internationalen Standortverlagerung
- 2.5.1 Die Standorttheorie von Tesch (1980)
- 2.5.2 Das eklektische Paradigma von Dunning (1979)
- 2.5.3 Empirische Befunde
- 2.6 Länderselektion
- 2.6.1 Länderspezifische Standortfaktoren
- 2.6.2 Marktsegmentierung und Ländergruppierung
- 3 Messung Internationaler Standortverlagerung auf Unternehmensebene
- 3.1 Indikatoren Internationaler Unternehmen
- 3.1.1 Strukturelle Indikatoren
- 3.1.2 Leistungsorientierte Indikatoren
- 3.1.3 Verhaltensorientierte Indikatoren
- 3.1.4 Finanzielle Indikatoren
- 3.2 Internationalisierungsprofil
- 3.3 Internationalisierungs-Indizes
- 3.3.1 Transnationality Index (UNCTAD 1995)
- 3.3.2 Transnational Activities Spread Index (letto-Gillies 1998)
- 3.3.3 Degree of Internationalization Scale (Sullivan 1994)
- 3.3.4 Produkt- und Kapitalmarktdimension (Hassel et al. 2003)
- 3.4 Abschließende Betrachtung der Messverfahren
- 4 Empirische Untersuchung: Internationalisierung deutscher Industrieunternehmen
- 4.1 Datenanalyse
- 4.1.1 Projektdesign (Zielformulierung)
- 4.1.2 Auswahl des Samples
- 4.1.3 Indikatoren
- 4.1.4 Datenquellen
- 4.2 Faktorenanalytische Untersuchung
- 4.2.1 Einordnung und Durchführung einer Faktorenanalyse
- 4.2.2 Eignung des Datenmaterials zur Durchführung einer Faktorenanalyse
- 4.2.3 Faktorenextraktion
- 4.2.4 Faktorenanzahl
- 4.2.5 Faktorenrotation
- 4.2.6 Interpretation der extrahierten Faktoren
- 4.2.7 Berechnung der Faktorenwerte
- 4.3 Messung des Internationalisierungsgrades (IG) auf Unternehmens- und Branchenebene
- 4.3.1 Entwicklung und Berechnung des Internationalisierungsgrades
- 4.3.2 Implikationen des Index
- 5 Internationale Standortverlagerung und Mitarbeiterproduktivität
- 5.1 Darstellung der theoretischen Überlegungen
- 5.1.1 Aspekte kostenorientierter Internationaler Standortverlagerung
- 5.1.2 Organisationales Lernen
- 5.1.3 Kulturelle Distanzen und ihre Auswirkungen auf die Mitarbeiterproduktivität
- 5.1.4 Schlussfolgerungen aus den theoretischen Überlegungen
- 5.2 Formulierung der Hypothesen
- 5.3 Allgemeine Anmerkungen zur Hypothesenprüfung
- 5.3.1 Erfasste Unternehmen und Datenerhebung
- 5.3.2 Methodik der empirischen Untersuchung und Variablenoperationalisierung
- 5.4 Ermittlung der Zusammenhänge mit der Regressionsanalyse
- 5.4.1 Grundidee und Ablauf einer Regressionsanalyse
- 5.4.2 Modellformulierung
- 5.4.3 Schätzung der Regressionsfunktion
- 5.4.4 Anpassungsgüte
- 5.4.5 Ausreißer
- 5.4.6 Prüfung der Modellprämissen
- 5.4.7 Dummy-Regression
- 5.5 Empirische Untersuchungsergebnisse
- 5.5.1 Internationale Standortverlagerung: Operationalisiert durch den Auslandsanteil am Gesamtumsatz
- 5.5.2 Internationale Standortverlagerung: Operationalisiert durch den Auslandsanteil an der Gesamtbeschäftigung
- 5.5.3 Internationale Standortverlagerung: Operationalisiert durch die Anzahl der kulturellen Cluster
- 5.5.4 Weitere Ergebnisse
- 5.6 Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht empirisch die Messung internationaler Standortverlagerungen und deren Auswirkungen auf die Mitarbeiterproduktivität deutscher Industrieunternehmen. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Zusammenhänge zwischen Internationalisierung, Standortwahl und Produktivität zu entwickeln.
- Messung internationaler Standortverlagerung
- Einflussfaktoren auf die Standortwahl
- Zusammenhang zwischen Standortverlagerung und Mitarbeiterproduktivität
- Analyse relevanter theoretischer Modelle (z.B. Uppsala-Modell, eklektisches Paradigma)
- Anwendung empirischer Methoden (z.B. Faktorenanalyse, Regressionsanalyse)
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Diplomarbeit ein, beschreibt die Problemstellung der Messung internationaler Standortverlagerungen und deren Auswirkungen auf die Produktivität, definiert die Zielsetzung der Arbeit und skizziert den Aufbau der Untersuchung.
2 Standortverlagerung im Internationalisierungsprozess von Unternehmen: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der internationalen Standortverlagerung. Es werden Begrifflichkeiten geklärt, verschiedene Formen der Verlagerung (Außenhandel, Direktinvestitionen, vertragliche Kooperationen) erläutert und entscheidende Bestimmungsfaktoren analysiert. Der Internationalisierungsprozess wird anhand verschiedener Modelle (u.a. Uppsala-Modell) dargestellt und kritisch bewertet. Schließlich werden Motive für internationale Standortverlagerungen diskutiert und die Relevanz von Standorttheorien (z.B. Tesch, Dunning) sowie empirische Befunde aufgezeigt. Die Länderselektion wird anhand von länderspezifischen Faktoren und Marktsegmentierungen erläutert.
3 Messung Internationaler Standortverlagerung auf Unternehmensebene: Das Kapitel fokussiert auf die methodischen Herausforderungen der Messung internationaler Standortverlagerungen auf Unternehmensebene. Es werden verschiedene Indikatoren (strukturell, leistungsorientiert, verhaltensorientiert, finanziell) vorgestellt und ein Internationalisierungsprofil entwickelt. Verschiedene Internationalisierungsindizes (z.B. Transnationality Index, Degree of Internationalization Scale) werden kritisch verglichen und bewertet, um geeignete Messverfahren für die empirische Untersuchung auszuwählen.
4 Empirische Untersuchung: Internationalisierung deutscher Industrieunternehmen: In diesem Kapitel wird die empirische Untersuchung zur Internationalisierung deutscher Industrieunternehmen detailliert beschrieben. Das Kapitel umfasst das Projektdesign, die Auswahl der Stichprobe, die verwendeten Indikatoren und Datenquellen. Die Faktorenanalyse wird als Methode zur Datenreduktion und zur Identifizierung relevanter Faktoren eingesetzt, gefolgt von der Messung des Internationalisierungsgrades auf Unternehmens- und Branchenebene.
5 Internationale Standortverlagerung und Mitarbeiterproduktivität: Dieses Kapitel behandelt den zentralen Forschungsgegenstand: den Zusammenhang zwischen internationaler Standortverlagerung und Mitarbeiterproduktivität. Es werden theoretische Überlegungen zu Kostenfaktoren, organisationalem Lernen und kulturellen Distanzen vorgestellt, die die Mitarbeiterproduktivität beeinflussen können. Auf Basis der theoretischen Überlegungen werden Hypothesen formuliert und anhand einer Regressionsanalyse empirisch geprüft. Die Ergebnisse der Analyse werden detailliert dargestellt und interpretiert.
Schlüsselwörter
Internationale Standortverlagerung, Mitarbeiterproduktivität, Internationalisierung, Industrieunternehmen, Deutschland, Faktorenanalyse, Regressionsanalyse, Standortfaktoren, Uppsala-Modell, Eklektisches Paradigma, Messung der Internationalisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Internationale Standortverlagerung und Mitarbeiterproduktivität
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht empirisch die Messung internationaler Standortverlagerungen deutscher Industrieunternehmen und deren Auswirkungen auf die Mitarbeiterproduktivität. Es geht darum, die Zusammenhänge zwischen Internationalisierung, Standortwahl und Produktivität zu verstehen.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Aspekte: die Messung internationaler Standortverlagerungen, Einflussfaktoren auf die Standortwahl, den Zusammenhang zwischen Standortverlagerung und Mitarbeiterproduktivität, relevante theoretische Modelle (z.B. Uppsala-Modell, eklektisches Paradigma) und die Anwendung empirischer Methoden (z.B. Faktorenanalyse, Regressionsanalyse).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Standortverlagerung im Internationalisierungsprozess, Messung internationaler Standortverlagerung, empirische Untersuchung deutscher Industrieunternehmen und der Zusammenhang zwischen internationaler Standortverlagerung und Mitarbeiterproduktivität. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Themas, beginnend mit der Einführung und der Definition der Forschungsfrage bis hin zur Präsentation und Interpretation der empirischen Ergebnisse.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet sowohl theoretische als auch empirische Methoden. Theoretisch werden relevante Modelle der Internationalisierung und Standortwahl (z.B. Uppsala-Modell, eklektisches Paradigma von Dunning) analysiert. Empirisch wird eine Faktorenanalyse zur Datenreduktion und Identifizierung relevanter Faktoren eingesetzt, sowie eine Regressionsanalyse zur Prüfung der Zusammenhänge zwischen internationaler Standortverlagerung und Mitarbeiterproduktivität.
Welche Daten werden in der empirischen Untersuchung verwendet?
Die empirische Untersuchung basiert auf Daten deutscher Industrieunternehmen. Die genauen Datenquellen und die Auswahl der Stichprobe werden im Kapitel 4 detailliert beschrieben. Es werden verschiedene Indikatoren (strukturell, leistungsorientiert, verhaltensorientiert, finanziell) verwendet, um den Internationalisierungsgrad und die Mitarbeiterproduktivität zu messen.
Welche Ergebnisse liefert die empirische Untersuchung?
Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung, die mit Hilfe von Faktorenanalyse und Regressionsanalyse gewonnen wurden, werden im Kapitel 5 detailliert dargestellt und interpretiert. Es wird untersucht, wie verschiedene Operationalisierungen der internationalen Standortverlagerung (z.B. Auslandsanteil am Umsatz, Auslandsanteil an der Beschäftigung, Anzahl kultureller Cluster) mit der Mitarbeiterproduktivität zusammenhängen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen über die Zusammenhänge zwischen internationaler Standortverlagerung und Mitarbeiterproduktivität deutscher Industrieunternehmen. Die Ergebnisse liefern Erkenntnisse für Unternehmen, die ihre Internationalisierungsstrategien planen und optimieren möchten, und tragen zum Verständnis der komplexen Wechselwirkungen zwischen Internationalisierung, Standortwahl und Produktivität bei.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Internationale Standortverlagerung, Mitarbeiterproduktivität, Internationalisierung, Industrieunternehmen, Deutschland, Faktorenanalyse, Regressionsanalyse, Standortfaktoren, Uppsala-Modell, Eklektisches Paradigma, Messung der Internationalisierung.
- Arbeit zitieren
- Diplom Kaufmann, MBA Sven Löhr (Autor:in), 2006, Eine empirische Messung zur Untersuchung internationaler Standortverlagerung und ihrer Auswirkungen auf die Mitarbeiterproduktivität deutscher Industrieunternehmen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118668