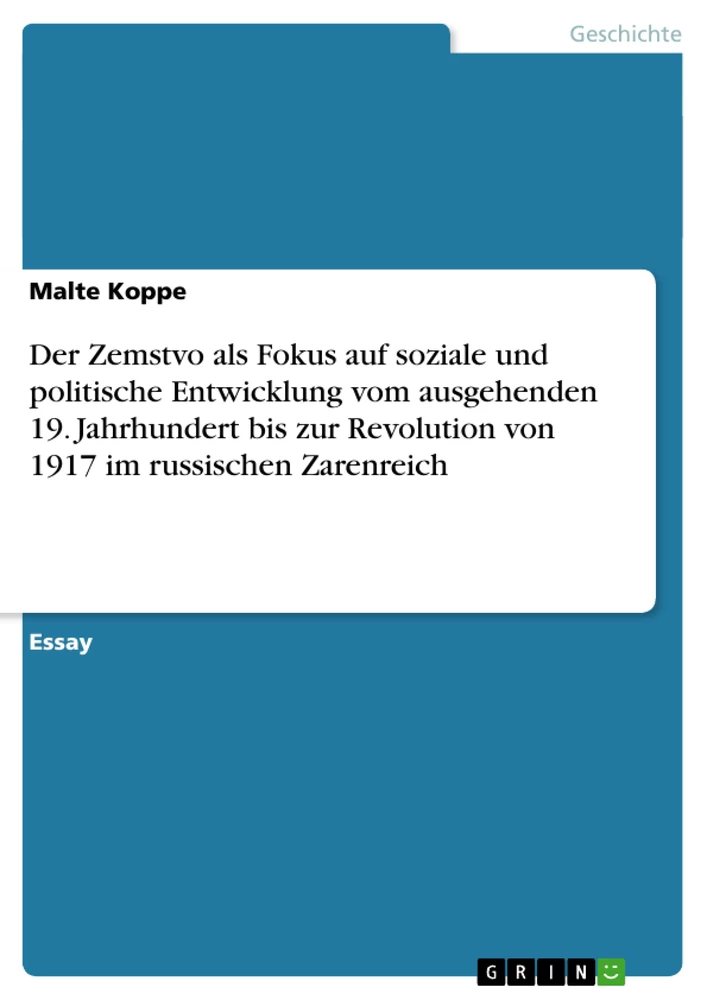Wie viele Forschung zum Zarenreich im ausgehenden 19. Jahrhundert steht auch die Untersuchung des Zemstvo unter dem Schatten der Oktoberrevolution. Viele Arbeiten zeichnen gewollt oder ungewollt schon ab dem Krimkrieg und den Großen Reformen den Weg in den ersten Weltkrieg und das turbulente Jahr 1917 vor. Die vorevolutionären Entwicklungen werden so als unabwendbares Vorspiel der Revolution dargestellt. Im Bezug auf den Zemstvo sind in diesem Zusammenhang vor allem zwei Fragen von Bedeutung, von denen die zweite vor dem Hintergrund der Revolution zu betrachten ist, da der Zemstvo neben der Aufhebung der Leibeigenschaft den ambitioniertesten Versuch darstellte Staat und „Gesellschaft“ im Zarenreich zu versöhnen. Die Fragen lauten:
- Warum wurde der Zemstvo geschaffen?
- Welche Verdienste erbrachte die Institution in der Zeit ihrer Existenz?
Die Antwort auf die erste Frage kann berechtigt aus mehreren Perspektiven gegeben werden: Man kann den Entstehungsgrund funktionalistisch in der zunehmenden Bürokratisierung des russischen gesellschaftlichen und politischen Lebens im 19. Jahrhundert, ideengeschichtlich in einer zumindest teilweisen Übernahme westlicher liberaler Selbstverwaltungsmodelle oder fiskalisch in dem Versuch der Hebung der Steuermoral der Bevölkerung durch neue Institutionen sehen. Große Berechtigung hat auch die „humanitäre“ Perspektive, in der Schaffung des Zemstvo die Absicht des Staates zu sehen, soziale Not auf dem Lande „an der Wurzel“ zu mildern und zum Beispiel Elementarbildung und medizinische Versorgung bereitzustellen – nicht zuletzt deshalb, um eine Revolution zu verhindern. Politisch ist die Schaffung der lokalen Selbstverwaltungskörperschaften auf Provinz- (gubernija) und Distriktsebene (ujezd) jedoch vor allem der Versuch der Autokratie, den Adel für den mit der „Befreiung“ der Leibeigenen einhergehenden Machtverlust durch neuen institutionalisierten Einfluss zu entschädigen. Doch jeder dieser Blickwinkel, deren Aufzählung nicht vollständig ist, trägt eine gewisse Berechtigung.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Vom Hort der liberalen Opposition zum verlängerten Arm der Autokratie
3. Zusammenfassung
4. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Wie viele Forschung zum Zarenreich im ausgehenden 19. Jahrhundert steht auch die Untersuchung des Zemstvo unter dem Schatten der Oktoberrevolution.[1] Viele Arbeiten zeichnen gewollt oder ungewollt schon ab dem Krimkrieg und den Großen Reformen den Weg in den ersten Weltkrieg und das turbulente Jahr 1917 vor. Die vorevolutionären Entwicklungen werden so als unabwendbares Vorspiel der Revolution dargestellt. Im Bezug auf den Zemstvo sind in diesem Zusammenhang vor allem zwei Fragen von Bedeutung, von denen die zweite vor dem Hintergrund der Revolution zu betrachten ist, da der Zemstvo neben der Aufhebung der Leibeigenschaft den ambitioniertesten Versuch darstellte Staat und „Gesellschaft“ im Zarenreich zu versöhnen. Die Fragen lauten:
- Warum wurde der Zemstvo geschaffen?
- Welche Verdienste erbrachte die Institution in der Zeit ihrer Existenz?
Die Antwort auf die erste Frage kann berechtigt aus mehreren Perspektiven gegeben werden: Man kann den Entstehungsgrund funktionalistisch in der zunehmenden Bürokratisierung des russischen gesellschaftlichen und politischen Lebens im 19. Jahrhundert, ideengeschichtlich in einer zumindest teilweisen Übernahme westlicher liberaler Selbstverwaltungsmodelle oder fiskalisch in dem Versuch der Hebung der Steuermoral der Bevölkerung durch neue Institutionen sehen. Große Berechtigung hat auch die „humanitäre“ Perspektive, in der Schaffung des Zemstvo die Absicht des Staates zu sehen, soziale Not auf dem Lande „an der Wurzel“ zu mildern und zum Beispiel Elementarbildung und medizinische Versorgung bereitzustellen – nicht zuletzt deshalb, um eine Revolution zu verhindern. Politisch ist die Schaffung der lokalen Selbstverwaltungskörperschaften auf Provinz- (gubernija) und Distriktsebene (ujezd) jedoch vor allem der Versuch der Autokratie, den Adel für den mit der „Befreiung“ der Leibeigenen einhergehenden Machtverlust durch neuen institutionalisierten Einfluss zu entschädigen. Doch jeder dieser Blickwinkel, deren Aufzählung nicht vollständig ist, trägt eine gewisse Berechtigung.
Im Bezug auf die zweite Eingangsfrage dominiert in den Untersuchungen zum Organ der 1864 durch Zarenerlasss eingeführten lokalen Selbstverwaltung im russischen Zarenreich zudem die Frage nach der Rolle des Zemstvo beim Scheitern des liberal-parlamentarischen Weges Russlands im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Auf diesem wurde besonders von der liberalen westlichen Geschichtsschreibung der Zemstvo als integraler Bestandteil und Grundstein angesehen.[2] Schon die Erwähnung der Tatsache, dass Zemstvos auf zwei unterschiedlichen Ebenen der Staatsverwaltung existierten, zeigt neben noch zu erwähnenden Aspekten, dass man den Gegenstand „Zemstvo“ nicht als einheitlichen „Monolithen“ behandeln und mit wenigen allgemeinen Aussagen abhandeln kann.[3] Dies würde dem Charakter der bis 1917/8 über insgesamt fast 54 Jahre bestehenden Zemstva angesichts der enormen Umwälzungsprozesses im zaristischen Russland im ausgehenden 19. Jahrhundert mit Industrialisierung, sozialistischem Terror und der 1905er-Revolution nicht gerecht werden.
Der Zemstvo war zwar auch, aber nicht nur eine liberale Schule, deren „Schüler“ nach Verfassung und Grundrechten strebten.[4] Zu betonen sind ebenso konservative und besitzstands-wahrende Tendenzen der zemsty. KAPPELER formuliert zu Recht vorsichtig, dass die Zemstva gewählte Körperschaften waren, „die die ländliche Infrarstruktur (Sozialfürsorge, Straßen, medizinische Versorgung, Elementarschulen) verbessern sollten.“[5] Im Rahmen dieses grundsätzlichen Paradoxons zwischen Anspruch und Wirklichkeit war der Zemstvo vor allem eine Institution der Widersprüche, die dem Anspruch nicht gerecht werden konnte, Staat und Gesellschaft miteinander zu versöhnen.
Aus der allgemeinen russischen Geschichtsschreibung ist die Erkenntnis zu bejahen, dass die Zemstvoversammlungen und -vorstände – beide werden unter der Sammel-bezeichnung „Zemstvo“ besprochen – vom Adelsstand dominiert waren.[6] Dennoch stellte die Etablierung der Körperschaften im Zuge der Großen Reformen der 60er Jahre des 18. Jahrhunderts unter Alexander II.[7] die erstmalige – wenn auch sehr bescheidene – Beteiligung des überwältigendem Teil der russischen Bevölkerung, der Bauern, an den lokalen Angelegenheiten außerhalb ihrer eigenen Standesversammlungen in mir und volost dar. Ihre Abstinenz und Skepsis gegenüber der neuen Lokalverwaltung war jedoch stets groß und besonders ab den 1890er Jahren auch nicht unberechtigt.
2. Vom Hort der liberalen Opposition zum verlängerten Arm der Autokratie
Während in den Anfangsjahren des Zemstvo die Hoffnung bestand, dass dieser sich neben der Erbringung praktischer sozialer Leistungen für die eigene sowie die Demokratisierung des gesamten russischen politischen Systems einsetzen würde, lässt sich spätestens ab 1890 auch aus der Perspektive der Zemstva die autokratische Reaktion unter Alexander III. deutlich erkennen. Vehement forderten sie zwar eine konstitutionelle Bindung der Autokratie und ein Parlament, wofür sie nicht nur einmal gemaßregelt wurden, doch wie zu zeigen ist wandelte sich ihr Charakter schnell. Die Zemstva waren von 1864 an selbst keine demokratischen Institutionen, sondern von übermäßig repräsentierten Adligen bzw. Landbesitzern dominierte, nach Besitz und Stand in drei Wahlgruppen gewählte Versammlungen. Es fehlte zudem sowohl eine Vertretung auf höchster wie auch auf niedrigster (volost-)Ebene sowie eine funktionierende Vernetzung der Zemstva untereinander.
In der Forschung werden unterschiedliche „Lebensphasen“ des Zemstvo bis zur seiner Auflösung ab 1917 zugunsten der Sowjets unterschieden, wobei die Unterteilung der Zemstvogeschichte nach den Rechtsstatuten von 1864 (Gründungsverordnung der Zemstvos) und 1890 (dessen Modifizierung) nur eine Möglichkeit der Einteilung bildet. Mit der Revolution von 1905 und der Stolypinschen Agrarreformen änderte sich ihr rechtlicher Charakter erneut; viele Restriktionen von 1890 wurden wieder gelockert.
Gefährlich und irreführend kann jedoch ein Blick auf den Zemstvo aus ausschließlich rechtlicher Perspektive sein, da Recht und Rechtswirklichkeit im zaristischen Russland häufig weit auseinander lagen. Reine Rechtsstudien können deshalb zu anderen Schlüssen führen, als sozialgeschichtlich orientierte Forschung wie STARR anhand von institutionellen Vorläufern des Zemstvo zeigt.[8]
Dennoch kann als gesichert gelten, dass der Zemstvo sich nach rechtlichen Änderungen auch faktisch wandelte. THOMPSON-MANNING sieht das Ende der liberalen Zemstvoperiode, während derer die zemsty durchaus die Ideen moderner politischer Repräsentation und Grundrechte unterstützten, mit dem konservativen Umschwung nach der Revolution von 1905 eintreten. Im Zuge der revolutionären Wirren begannen die Zemstva, gemeinsam mit der Regierung für den Erhalt des bestehenden politischen Systems einzutreten, was sich beispielsweise durch von ihnen versandte Petitionen, verstärkte staatliche direkte Finanzhilfen und die Tatsache belegen lässt, dass manche Zemstvofunktionäre in höhere Staatsfunktionen aufstiegen.[9] Neben der banalen Feststellung, dass der Zemstvo über fünfzig Jahre existieren konnte, ist die Frage zu stellen, für wen er warum nützlich war. Die Antwort, die hier vertreten wird, ist: für den Erhalt der Autokratie.[10] Der Grundstein hierfür war freilich schon 1890 durch die Änderung des Zemstvostatuts gelegt worden, das die Lokalvertretungen unter verschärfte Staatsaufsicht stellte, die führende Rolle des Adels weiter stärkte und die direkte staatliche Überwachung der Bevölkerung auf dem Land durch sogenannte zemskie nachal’niki sicherstellte.[11]
Das 1890er Statut war jedoch, wie auch die Koryphäe der Zemstvo-Historiographie VESELOVSKIJ eingesteht, keine Revolution der lokalen Institution.[12] So änderten sich die inhaltlichen Aufgaben der Zemstva nicht. Jedoch wurde das Wahlsystem entscheidend umgestellt. Wurde ab 1864 nach der Art des (Land)Besitzes gewählt, war das Kriterium ab 1890 der Stand. Dieser vermeintlich marginale Unterschied führte dazu, dass die wachsende Zahl besitzender Bauern nach der Beendigung der Leibeigenschaft ihre teilweise (z.B. auf Distriktebene) erstaunlich hohe Repräsentanz im Zemstvo durch Absinken in die dritte Wahlkurie einbüßte, während der langsam an Land verlierende Adel weiterhin übermäßig stark vertreten blieb.[13] Bauern wurden zudem nicht mehr gewählt, sondern auf Vorschlag der volosty vom Gouverneur ernannt. So entschädigte der Staat den Adel für die sich ab 1890 verschärfende Kontrolle – die Verlierer waren die Bauern.[14] Die langsam wachsende Arbeiterschicht der Städte[15] war zu keiner Zeit in den Zemstvos vertreten.
Die Episode der Wahlrechtsänderung macht die Skepsis der Bauern dem Zemstvo gegenüber verständlich. Wie ATKINSON zeigt, wurde er von „den einfachen Leuten“ aufgrund seiner Steuerhebungsrechte auf Landbesitz (neben den staatlichen und Provinzsteuerabgaben!), die von den lokalen staatlichen Polizeibehörden durchgesetzt werden konnten, vor allem als Teil einer ungerechten Bürokratie angesehen.[16] Die auch durch den staatlichen Zemstvo nicht gelungene Integration der Bauern – bei allen Fortschritten im Sozial- und Bildungsbereich[17] – wog letztendlich schwerer als die konstitutionellen Fortschritte und die erfolgreiche Integration des Adels in Staatsangelegenheiten und lokale Verwaltung.
Nicht erwähnt wurde bis hierhin das sogenannte „Dritte Element“ im Zemstvo. Hierbei handelt es sich um professionelle „Freiberufler“, z.B. Ärzte, Lehrer und Statistiker, die die konkreten Aufträge des Zemstvo ausführten. Ihre Zahl war mit unter 100 000 in allen Jahren der Existenz des Zemstvo zu gering, um von einem Stand oder einer Klasse zu sprechen. Viele von ihnen gehörten der niedrigeren Intelligenzija an. FRIEDEN und JOHNSON zeigen, dass sie trotz teilweise hervortretender Sympathien für die Bauern und ihre Nöte nur in seltenen Ausnahmefällen revolutionärer und agitatorischer Arbeit nachgingen.[18] Da ihre Existenz zumeist an den Zemstvobesoldungen hing, war mehr Opposition hier kaum möglich. Dieser tatsächlich weniger einheitlichen als hier vereinfacht dargestellten Gruppe lässt sich am wenigsten die Schuld für das Versagen der Zemstvos geben, ihren ursprünglichen Auftrag, „die lokale wirtschaftliche Wohlfahrt und Bedürfnisse“ (Art. 1 des Zemstvostatuts von 1864) sicherzustellen bzw. zu befrieden, schließlich doch nicht im ausreichenden Maße erfüllt zu haben.
3. Zusammenfassung
Eine übermäßige Idealisierung des Zemstvo trägt dieselben Züge wie die Glorifizierung des bäuerlichen mir. Beide Institutionen waren vor allem als Verwaltungseinheiten dem Staate zur Verwaltung des Riesenreiches und der Steuererhebung notwendig. Genoss auch der Zemstvo, hauptsächlich also die mit der Bauernbefreiung unzufriedene Adelsschicht, bis in die Jahre der Reaktion (1880-90) eine weitgehende Autonomie, wandelte er sich bald zu einer staatlichen Verwaltungseinheit.[19] Nach der Revolution von 1905 erlahmte sein progressives Moment endgültig und es ist bezeichnend, dass der Zemstvo in der Folgezeit vor allem noch als Unterstützer an der Heimatfront (Verwundetenversorgung) des Ersten Weltkrieges und Wahrer der bestehenden Ordnung auftritt. Die „Verstaatlichung“ kann dabei nicht nur der Autokratie, sondern muss auch den (adligen) zemtsy selbst angelastet werden, die sich ihr nicht widersetzen.
Gegründet durch die Autokratie, geführt durch den lokalen Adel, entfremdet von den Bauern und den eigenen Angestellten war der Zemstvo ein notwendiger Teil des „alten Systems“. Dies schmälert nicht erwähnte praktische Leistungen in den Sachgebieten seiner Arbeit[20], was wiederum deutlich macht, dass die Autokratie durch den Zemstvo zumindest eine Linderung sozialer Probleme auf dem Land erreichen konnte – was freilich nicht genügte, den über Jahrzehnte aufgestauten sozialen Druck zu kanalisieren.
Literaturverzeichnis:
- Geyer, Dietrich: „Gesellschaft“ als staatliche Veranstaltung, in: Jahrbuch für die Geschichte Osteuropas 14 (1966), S. 21 – 50.
- Hosking, Geoffrey: Rulers and Victims. The Russians in the Soviet Union. Cambridge 2006.
- Informationen zur politischen Bildung 235: Die Sowjetunion 1917-1953, hrsg. von der Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1992.
- Kappeler, Andreas: Russische Geschichte (2. Aufl.), München 2002.
- Margolina, Sonja: Russland – Die nichtzivile Gesellschaft, Hamburg 1994.
- Sorokina, Tatiana: Zemstvo Physician – a prototype of modern general practitioners. o. O. u. J.
- Stoekl, Günter: Russische Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart 1983.
- Takenaka, Yutaka: Land-owning nobles and zemstvo Institutions: The post-Reform estate system in political erspective, in: Empire and Society. New approaches Russian history. Sapporo 1997, S. 133 – 150.
- The zemstvo in Russia. An experiment in local self-government, hrsg. von Terence Emmond, Cambridge 1982. (sämtliche Artikel, siehe einzelne Fußnoten)
- „Bauerngemeinde“, in: Lexikon der Geschichte Russland, hrsg. von Hans-Joachim Torke, München 1985, S. 58 – 61.
- von Rauch, Georg: Geschichte der Sowjetunion (5. Aufl.), Stuttgart 1969.
[...]
[1] Dieser Essay spart weitgehend Anmerkungen zur Rolle der Zemstvounion (ab Beginn des 20. Jahrhunderts) und der demokratisierten Zemstva ab 1917 aus.
[2] So etwa Emmons, Terence: Historical perspective, in: The zemstvo in Russia. An experiment in local self-government, hrsg. von ders., Cambridge 1982, S. 426 – 446. (Emmons, 1982)
[3] Auf die Ungenauigkeit von Vereinfachungen im Bezug auf „den Zemstvo“ verweist zu Recht auch FALLOWS. Siehe: Fallows, Thomas: The zemstvo and the bureaucracy, in: The zemstvo in Russia. An experiment in local self-government, hrsg. von Terence Emmond, Cambridge 1982, S. 177. (Fallows, 1982)
[4] von Rauch, Georg: Geschichte der Sowjetunion (5. Aufl.), Stuttgart 1969, S. 22.
[5] Kappeler, Andreas: Russische Geschichte (2. Aufl.), München 2002, S. 29.
[6] Thompson Manning, Roberta: The zemstvo and politics, 1864 – 1914, in: The zemstvo in Russia. An experiment in local self-government, hrsg. von Terence Emmons, Cambridge 1982, S. 133 – 175 (Thompson Manning, 1982); Atkinson, Dorothy: The zemstvo and the peasantry, in: The zemstvo in Russia. An experiment in local self-government, hrsg. von Terence Emmons, Cambridge 1982, S. 79 – 131. (Atkinson, 1982)
[7] Zemstvos wurden nicht in allen russischen Gouvernements und Provinzen geschaffen. Im Westen (ehemals polnische Gebiete) fürchtete die Autokratie eine Stärkung des polnischstämmigen Adels; in manchen Ostgebieten wurden sie überhaupt nicht erwogen.
[8] Starr, Frederick S.: Local initiative in Russia before the zemstvo, in: The zemstvo in Russia. An experiment in local self-government, hrsg. von Terence Emmond, Cambridge 1982, S. 5 – 29. (Starr, 1982)
[9] Thompson Manning, 1982, S. 134; McKenzie, Kermit E.: The zemstvo and the administration, in: The zemstvo in Russia. An experiment in local self-government, hrsg. von Terence Emmond, Cambridge 1982, S. 46. (McKenzie, 1982)
[10] Wenn das Misstrauen der Bürokratie gegenüber dem Zemstvo sich ab 1905 eher auf die Duma konzentrierte (McKENZIE, 1982, S. 64), dann liegt dies auch daran, dass der Zemstvo „gebändigt“ war. In Auswertung von Senatsentscheidung von Streitigkeiten zwischen den Zemstva des Landes und den Ministerien in St. Petersburg sowie den lokalen Gouverneuren zeigt FALLOWS, dass es durchaus Elemente von Streit und Konsens in den sogenannten Zemstvo-Staat Beziehungen gab. Er zeigt jedoch auch, dass der Zemstvo und die Gouverneure / Ministerien als “two parts of one broader whole [...] administrative apparatus of tsarist Russia” zu sehen sind. Siehe: Fallows, 1982, S. 177 – 241.
[11] Nachweise für einen grundsätzlichen Wandel des Zemstvo zwischen 1864 bis 1890 bringt ebenfalls McKENZIE: Er erwähnt eine Klarstellung des Ministerrates von 1870, in der die Zemstva eindeutig nicht als „governmental authorities“ bezeichnet werden sowie einen ukaz aus dem Jahre 1880, in der den Zemstva die einmütige Arbeit zusammen „with the other governmental institutions“ aufgetragen wird. Siehe: McKenzie, 1982, S. 36f.
[12] zitiert nach: McKenzie, 1982, S. 37.
[13] McKENZIE gibt beispielsweise an, dass 1913 auf Provinzebene die Vorstände mit bis zu 94 % adligen Mitgliedern besetzt waren; die Versammlungen selbst mit bis zu 80 % Adelsvertretern (1897). Siehe: McKenzie, 1982, S. 44, 54.; Nachweis zur aufsteigenden Rolle der Bauern, der absteigenden des Adels und der deshalb erfolgten Änderung: Atkinson, 1982, S. 87, 91.
[14] Der Vollständigkeit halber muss erwähnt werden, dass diese die Bauern benachteiligenden Änderungen 1906 wieder zurückgenommen wurden, was aber endgültig die Bauern mit dem Zemstvo nicht mehr versöhnen konnte.
[15] Den Zemstvo nachempfundene „Dumas“ wurden 1870 in den russischen Städten eingeführt.
[16] Atkinson, 1982, S. 79 – 131.
[17] FALLOWS weist als einer der wenigen auf die hohen Kosten der Zemstvo-Sozialleistungen hin (von 1900 bis 1905 explodierten in ganz Russland die Zemstvobudgets, was die Bürokratie veranlasste, diese zu deckeln), während andere Experten diese unkritisch als großen Erfolg loben. Siehe: Fallows, 1982, S. 181.
[18] Frieden, Nancy M.: The politics of Zemstvo medicine, in: The zemstvo in Russia. An experiment in local self-government, hrsg. von Terence Emmond, Cambridge 1982, S. 315 – 341 sowie Johnson, Robert E.: Liberal professionals and professional liberals: the zemstvo statisticians and their work, in: The zemstvo in Russia. An experiment in local self-government, hrsg. von Terence Emmond, Cambridge 1982, S. 343–363.
[19] Die Tatsache, dass FALLOWS in umfangreicher Quellenauswertung feststellt, dass „definite conflict existed between the governor and the zemstvo, but from the standppoint of an outsider neither party in these disputes appears either more virtuous or more capricious than the other.”, bedeutet nicht, dass die These der “Verstaatlichung” der Zemstva hinfällig ist. Auch zwischen den Verwaltungsebenen derselben Staatsverwaltung kann es – besonders in föderalen Systemen – Unstimmigkeiten bis hin zur Möglichkeit der Organklage geben. Zitat siehe: Fallows, 1982, S. 212.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Abhandlung über den Zemstvo im zaristischen Russland?
Die Abhandlung untersucht die Rolle des Zemstvo (einer lokalen Selbstverwaltungsinstitution) im zaristischen Russland des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Sie analysiert, wie sich der Zemstvo von einer Plattform liberaler Opposition zu einem Werkzeug zur Stärkung der Autokratie entwickelte, und beleuchtet die Widersprüche und begrenzten Erfolge dieser Institution.
Warum wurde der Zemstvo gegründet?
Der Zemstvo wurde aus verschiedenen Gründen geschaffen, darunter die zunehmende Bürokratisierung, die Übernahme westlicher Selbstverwaltungsmodelle, fiskalische Überlegungen und der Wunsch, soziale Not zu lindern. Politisch diente er vor allem dazu, den Adel für den durch die Aufhebung der Leibeigenschaft erlittenen Machtverlust zu entschädigen.
Welche Rolle spielte der Adel im Zemstvo?
Der Adel dominierte die Zemstvo-Versammlungen und -Vorstände. Die Gründung der Körperschaften sollte den Adel für den Verlust der Leibeigenschaft entschädigen, durch neue institutionelle Einflüsse.
Welche Bedeutung hatten die Bauern im Zemstvo?
Obwohl die Gründung des Zemstvo eine bescheidene Beteiligung der Bauern an lokalen Angelegenheiten ermöglichte, blieben sie skeptisch und distanziert, besonders ab den 1890er Jahren. Die Integration der Bauern in den Zemstvo scheiterte letztendlich, trotz Fortschritten im Sozial- und Bildungsbereich.
Was ist das "Dritte Element" im Zemstvo?
Das "Dritte Element" bezieht sich auf professionelle Freiberufler wie Ärzte, Lehrer und Statistiker, die die konkreten Aufträge des Zemstvo ausführten. Ihre Zahl war relativ gering, und ihre Möglichkeiten zur Opposition waren begrenzt, da ihre Existenz von den Zemstvobesoldungen abhing.
Wie veränderte sich der Zemstvo im Laufe der Zeit?
In den Anfangsjahren bestand die Hoffnung, dass der Zemstvo sich für Demokratisierung einsetzen würde. Nach 1890, mit der autokratischen Reaktion unter Alexander III., wandelte er sich jedoch. Durch das geänderte Zemstvostatut wurde er unter stärkere Staatsaufsicht gestellt und die Rolle des Adels gestärkt, was letztlich zur Stärkung der Autokratie beitrug.
Was war das Zemstvostatut von 1890?
Das Zemstvostatut von 1890 verschärfte die Staatsaufsicht über die Lokalvertretungen, stärkte die führende Rolle des Adels und sicherte die staatliche Überwachung der Bevölkerung auf dem Land. Das Wahlsystem wurde dahingehend geändert, dass nicht mehr nach Besitz, sondern nach Stand gewählt wurde, was die Repräsentanz der Bauern verringerte.
Wie wurde der Zemstvo von der einfachen Bevölkerung wahrgenommen?
Der Zemstvo wurde aufgrund seiner Steuerhebungsrechte auf Landbesitz oft als Teil einer ungerechten Bürokratie angesehen.
Was waren die Verdienste des Zemstvo?
Trotz seiner Widersprüche und begrenzten Erfolge leistete der Zemstvo praktische Beiträge in den Bereichen Soziales und Bildung. Er trug zur Linderung sozialer Probleme auf dem Land bei, was aber nicht ausreichte, den sozialen Druck zu kanalisieren.
Warum scheiterte der Zemstvo letztendlich?
Der Zemstvo scheiterte letztendlich daran, dass er von der Autokratie gegründet, vom Adel geführt, den Bauern entfremdet und ein Teil des "alten Systems" war. Seine mangelnde Integration der Bauern und seine Verstaatlichung trugen zu seinem Scheitern bei.
Welche Rolle spielte der Zemstvo im Ersten Weltkrieg?
Nach der Revolution von 1905 spielte der Zemstvo vor allem eine Rolle als Unterstützer an der Heimatfront des Ersten Weltkriegs (Verwundetenversorgung) und Wahrer der bestehenden Ordnung.
Wann und warum wurde der Zemstvo aufgelöst?
Der Zemstvo wurde ab 1917 zugunsten der Sowjets aufgelöst. Seine Auflösung markierte das Ende eines Experiments zur lokalen Selbstverwaltung, das letztendlich den Erwartungen nicht gerecht werden konnte.
Was sind die wichtigsten Quellen, die in dieser Abhandlung verwendet werden?
Die Abhandlung stützt sich auf eine Vielzahl von Quellen, darunter Werke von Dietrich Geyer, Andreas Kappeler, Georg von Rauch und Terence Emmons (Herausgeber von "The Zemstvo in Russia").
- Quote paper
- Malte Koppe (Author), 2008, Der Zemstvo als Fokus auf soziale und politische Entwicklung vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis zur Revolution von 1917 im russischen Zarenreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118669