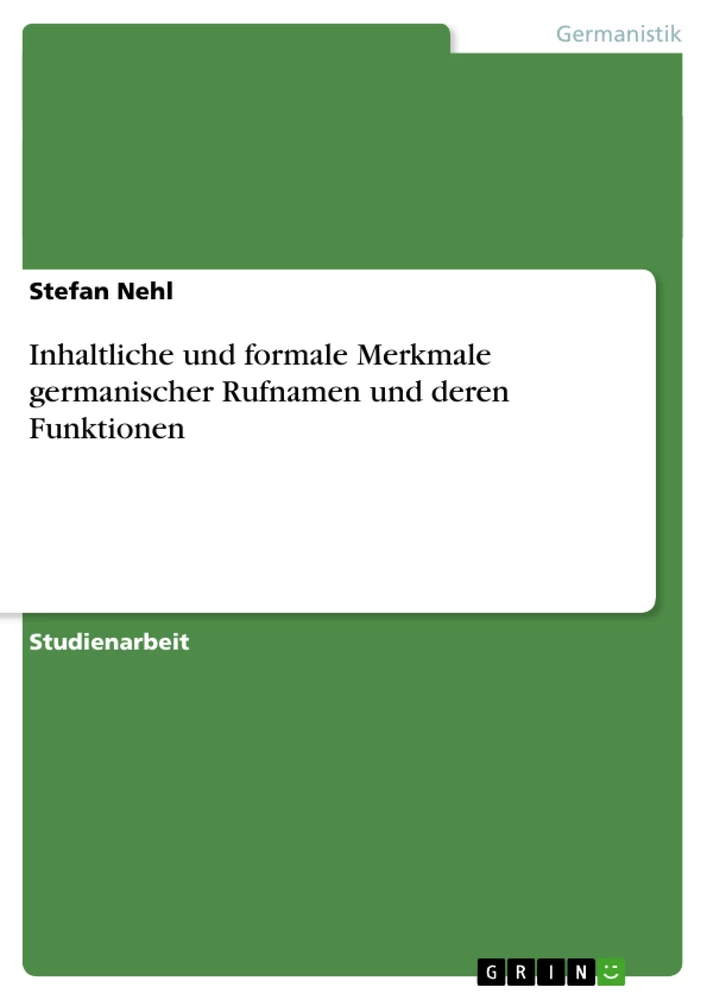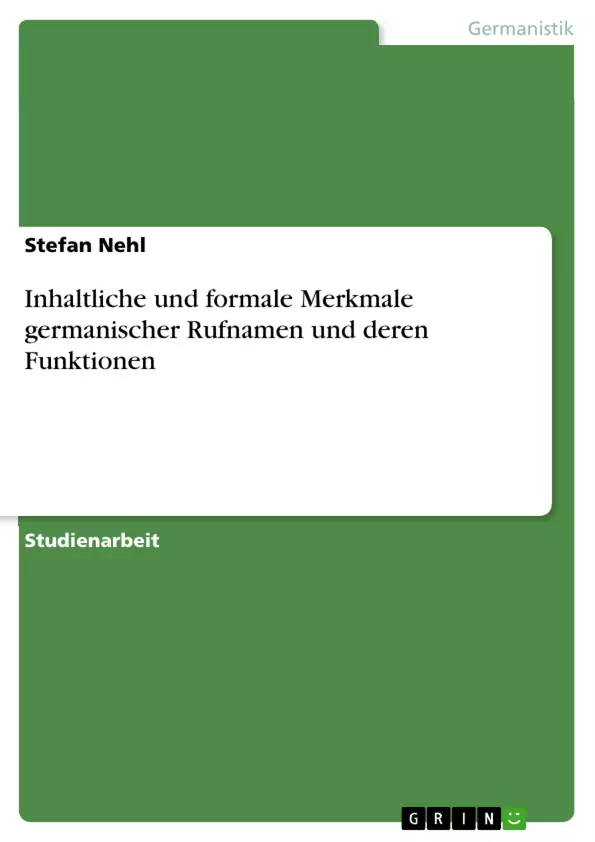Im Rahmen dieser Hausarbeit beschäftige ich mich mit verschiedenen grundlegenden Aspekten germanischer Rufnamen.
Meine Ausführungen beginne ich mit einem begriffstheoretischen Teil, in dem, für das Hauptthema und die eigentliche Untersuchung relevante Begrifflichkeiten, definiert und erklärt werden, um dem Verlauf der folgenden Untersuchung adäquat folgen zu können. Dabei gehe ich explizit auf den Unterschied zwischen Propria (Eigennamen) und Appellativa (Gattungsnamen) ein. Propria bezeichnen stets etwas Individuelles um eine gewisse Abgrenzung und Unverwechselbarkeit zu erzeugen, wobei Appellativa die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse oder Gattung ausdrücken. Des Weiteren erfolgt in diesem Teil die Einteilung der Namen in unterschiedliche Klassen, wobei ich mich auf Anthroponyme (Personennamen), Toponyme (Ortsnamen) und eine Klasse beziehe, welche Namen beinhaltet, die weder in die erste, noch in die zweite Klasse eindeutig eingeordnet werden können. Zudem zeige ich auf, dass bezüglich der Klassifizierung bislang keine Einigung auf ein einheitliches, allgemein akzeptiertes Modell erzielt werden konnte. Im letzten Punkt dieses Abschnitts, gehe ich auf den Begriff ‚Rufname‘ ein, welcher synonym mit dem Begriff ‚Personenname‘ ist und der Bezeichnung eines Individuums dient.
Anschließend beginne ich mit der Untersuchung und wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Hauptthema, mit welchem ich mich anhand einer konkreten Fragestellung auseinandersetze.
Im ersten Teil gehe ich auf die Motivierung germanischer Rufnamen ein, um zu zeigen, auf welcher Grundlage bzw. (beziehungsweise) Grundlagen germanische Rufnamen gebildet worden und durch welche Bereiche die Namen beeinflusst worden. Des Weiteren spielt die Form germanischer Rufnamen eine signifikante Rolle. Damit meine ich die Eigenschaft der Zweigliedrigkeit und die damit verbundenen Bedeutung des jeweiligen Personennamens. Die Zweigliedrigkeit der germanischen Rufnamen liegt in der Komposition begründet, d.h. (das heißt) bestimmten Regeln der Verknüpfung von zwei Wörtern zu einem Wort. Die Komposition und die Zweigliedrigkeit stellen neben der Motivierung die Bedeutung der formalen Seite germanischer Rufnamen dar. Aufbauend auf die Komposition setze ich mich mit der Funktion des Erst- und Zweitgliedes des Kompositums auseinander. Anknüpfend daran, befasse ich mich mit dem durch das jeweilige Erst- und Zweitglied bedingte Geschlecht germanischer Rufnamen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Themenrelevante Definitionen und begriffliche Erklärungen zu „Namen“
- Unterscheidung zwischen Nomen proprium und Nomen appellativum
- Klassifizierung der Namen
- Was ist ein Rufname?
- Germanische Rufnamen
- Motivierung germanischer Rufnamen
- Zweigliedrigkeit und Komposition germanischer Rufnamen
- Funktion der Erst- und Zweitglieder in germanischen Rufnamen
- Geschlecht germanischer Rufnamen
- Götter- und Tiernamen als Bestandteil germanischer Rufnamen
- Verkürzung germanischer Rufnamen
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht grundlegende Aspekte germanischer Rufnamen. Das Ziel ist die Darstellung der inhaltlichen und formalen Merkmale dieser Namen und deren Funktionen anhand konkreter Beispiele. Die Arbeit konzentriert sich auf die formale und inhaltliche Seite germanischer Rufnamen, ohne jedoch bereits zu großen Schlussfolgerungen zu gelangen.
- Unterscheidung zwischen Eigen- und Gattungsnamen
- Motivierung und Bildung germanischer Rufnamen
- Zweigliedrigkeit und Komposition als formale Merkmale
- Funktion von Erst- und Zweitgliedern, einschließlich des Geschlechtsaspekts
- Die Rolle von Götter- und Tiernamen sowie die Verkürzung von Namen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Sie kündigt die begriffliche Klärung von „Nomen proprium“ und „Nomen appellativum“ an und führt in die zentrale Fragestellung nach den inhaltlichen und formalen Merkmalen germanischer Anthroponyme und deren Funktionen ein. Der Fokus liegt auf der methodischen Vorgehensweise und der Darstellung des Forschungsansatzes.
Themenrelevante Definitionen und begriffliche Erklärungen zu „Namen“: Dieser Abschnitt definiert und erklärt wichtige Begriffe wie „Nomen proprium“ und „Nomen appellativum“, unterscheidet zwischen Eigennamen und Gattungsnamen und beleuchtet deren jeweilige Funktionen. Die Bedeutung der Identifizierungsfunktion von Eigennamen wird herausgestellt. Die Arbeit diskutiert auch die Schwierigkeiten bei der Klassifizierung von Namen und führt den Begriff „Rufname“ als Synonym für Personennamen ein. Der Abschnitt legt die begrifflichen Grundlagen für die spätere Analyse germanischer Rufnamen.
Germanische Rufnamen: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es behandelt die Motivierung germanischer Rufnamen, untersucht deren Zweigliedrigkeit und Komposition, analysiert die Funktionen der Erst- und Zweitglieder, betrachtet den Einfluss von Götter- und Tiernamen und schließlich die Verkürzung von Namen. Die Kapitelteile greifen ineinander und zeigen die komplexen Zusammenhänge zwischen der Entstehung, der Form und der Bedeutung germanischer Personennamen auf. Es werden detaillierte Beispiele verwendet, um die beschriebenen Phänomene zu veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Germanische Rufnamen, Anthroponyme, Nomen proprium, Nomen appellativum, Zweigliedrigkeit, Komposition, Motivierung, Götternamen, Tiernamen, Namensgebung, Namenfunktionen, Sprachgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Germanische Rufnamen
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht grundlegende Aspekte germanischer Rufnamen. Sie konzentriert sich auf die inhaltlichen und formalen Merkmale dieser Namen und deren Funktionen anhand konkreter Beispiele. Der Fokus liegt dabei auf der formalen und inhaltlichen Seite, ohne weitreichende Schlussfolgerungen zu ziehen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Unterscheidung zwischen Eigen- und Gattungsnamen (Nomen proprium und Nomen appellativum), Motivierung und Bildung germanischer Rufnamen, Zweigliedrigkeit und Komposition als formale Merkmale, Funktion von Erst- und Zweitgliedern (inkl. Geschlechtsaspekt), Rolle von Götter- und Tiernamen in der Namensgebung und die Verkürzung von Namen.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung (mit Zielsetzung und methodischem Ansatz), begriffliche Klärung wichtiger Termini (Nomen proprium, Nomen appellativum, Rufname), Hauptteil mit der Analyse germanischer Rufnamen (Motivierung, Zweigliedrigkeit, Komposition, Bedeutung von Erst- und Zweitgliedern, Rolle von Götter- und Tiernamen, Namensverkürzungen) und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Welche Definitionen werden erläutert?
Die Arbeit klärt die Begriffe „Nomen proprium“ (Eigenname), „Nomen appellativum“ (Gattungsname) und „Rufname“ (als Synonym für Personennamen). Es wird die Unterscheidung zwischen Eigen- und Gattungsnamen erläutert und deren jeweilige Funktionen im Kontext der Namensgebung.
Wie werden germanische Rufnamen analysiert?
Die Analyse germanischer Rufnamen umfasst die Untersuchung der Motivierung (Beweggründe für die Namenswahl), die Zweigliedrigkeit und Komposition (Aufbau aus mehreren Elementen), die Funktion der Erst- und Zweitglieder (Bedeutung der einzelnen Bestandteile), den Einfluss von Götter- und Tiernamen und die Prozesse der Namensverkürzung.
Welche Beispiele werden verwendet?
Die Hausarbeit verwendet detaillierte Beispiele, um die beschriebenen Phänomene (Motivierung, Komposition, etc.) von germanischen Personennamen zu veranschaulichen. Die konkreten Beispiele werden im Hauptteil der Arbeit präsentiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Germanische Rufnamen, Anthroponyme, Nomen proprium, Nomen appellativum, Zweigliedrigkeit, Komposition, Motivierung, Götternamen, Tiernamen, Namensgebung, Namenfunktionen, Sprachgeschichte.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist die Darstellung der inhaltlichen und formalen Merkmale germanischer Rufnamen und deren Funktionen. Es geht um ein grundlegendes Verständnis der Entstehung, Form und Bedeutung dieser Namen.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die methodische Vorgehensweise und der Forschungsansatz werden in der Einleitung dargelegt. Die Arbeit stützt sich auf die Analyse von bestehenden Quellen und Beispielen germanischer Rufnamen.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen finden Sie im vollständigen Text der Hausarbeit (Inhaltsverzeichnis, Kapitelzusammenfassungen, etc.).
- Quote paper
- Stefan Nehl (Author), 2008, Inhaltliche und formale Merkmale germanischer Rufnamen und deren Funktionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118714