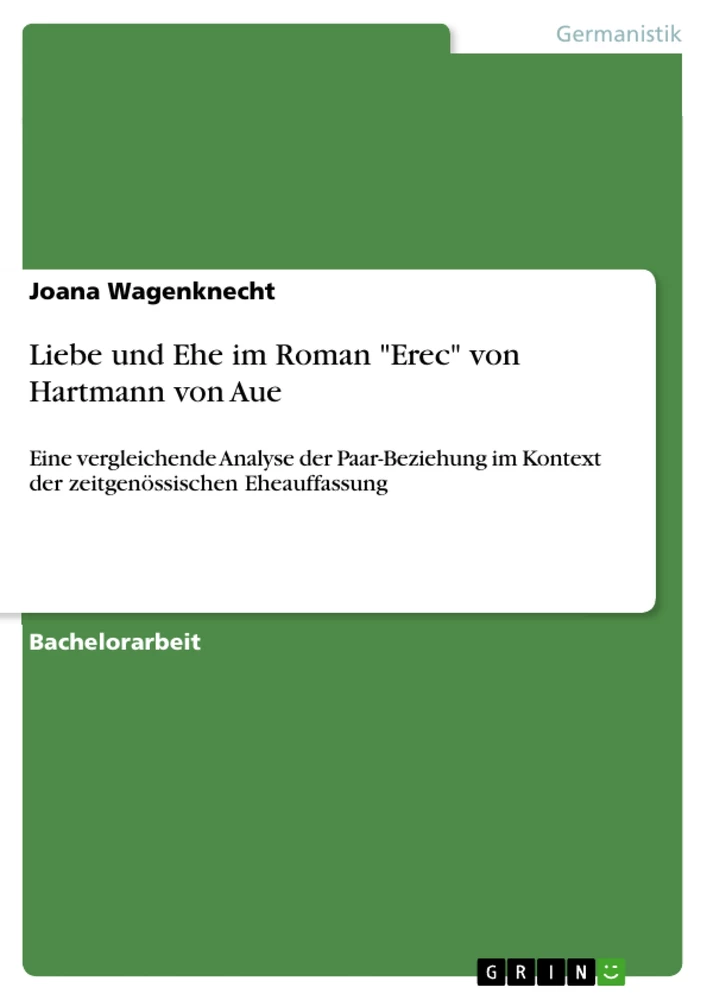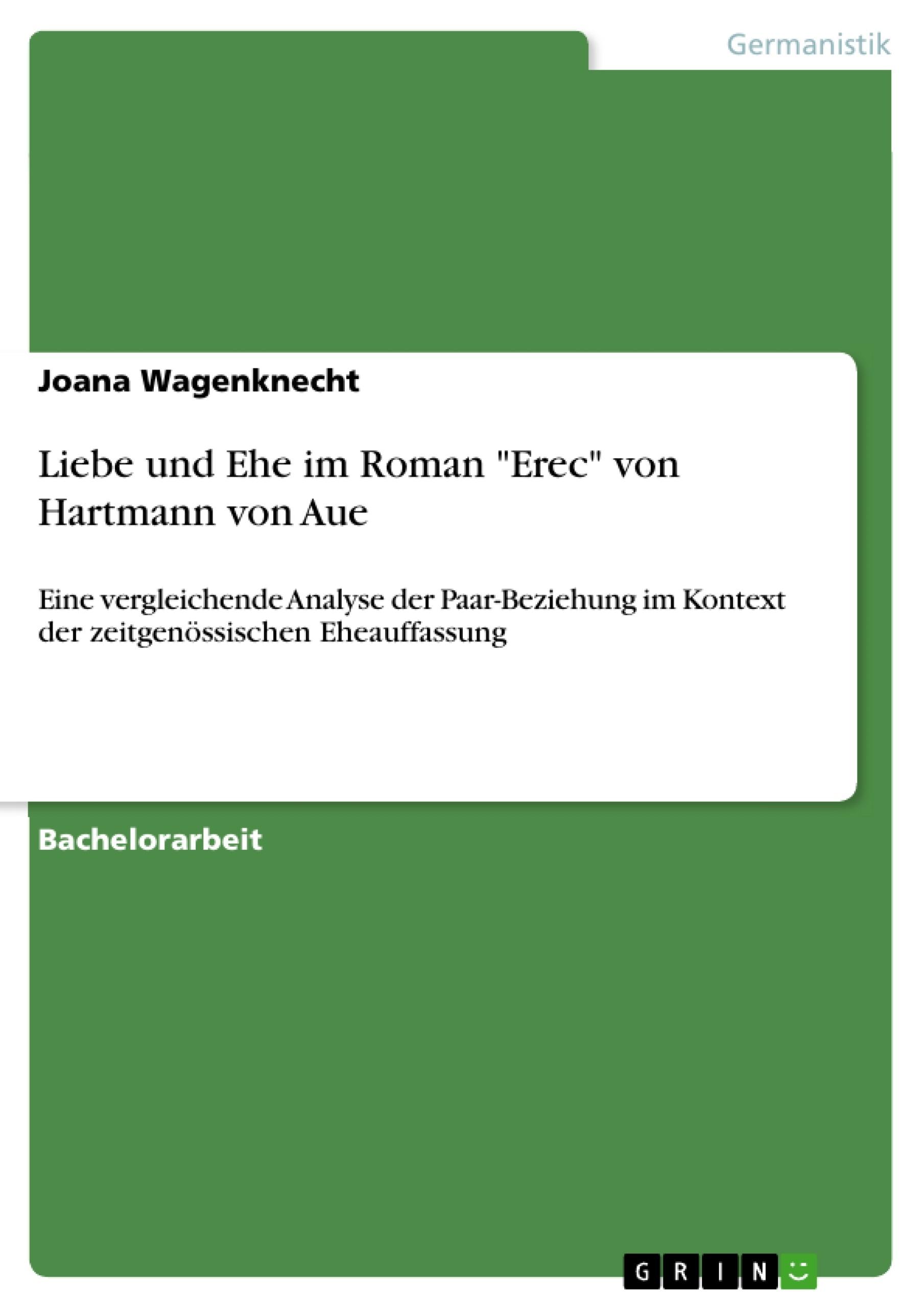In der Arbeit wird die Frage untersucht, inwiefern die Protagonisten des „Erec"-Romans Hartmanns von Aue einen Kontrast zur Liebes- und Eheauffassung ihrer Zeit darstellen und damit das Ideal eines höfisch liebenden Herrscherpaares anstreben.
Für das Verständnis, wie mit der Thematik Liebe und Ehe im „Erec“ Roman umgegangen wurde, ist es notwendig, die Eheauffassungen im historischen Kontext darzustellen, um das zum Diskurs stehende Thema untersuchen zu können. Dafür wird zunächst der Forschungsstand dargelegt, um im darauffolgenden Kapitel den historischen Kontext zu erläutern. Hier wird ein besonderes Augenmerk auf die Realität der zeitgenössischen Liebes- und Eheauffassung gelegt. Diese beinhalten die Auffassung der mittelalterlichen Kirche und die Darlegung der Theorie des Theologen Hugo von St. Viktor, die möglicherweise bei Hartmanns „Erec" zugrunde liegt.
Des Weiteren werden die feudale Eheauffassung der Adelsgesellschaft und der Einfluss der Frau im höfischen Kontext ausgeführt. Nachdem eine historische Grundlage geschaffen wurde, kann die Analyse des Romans in Kapitel der Arbeit in Hinblick auf die zeitgenössische Realität vorgenommen werden. Dabei wird die Entwicklung des Paares im Kontext des historischen Hintergrundes analysiert. Die Analyse beinhaltet außerdem einen Vergleich mit der französischen Vorlage Chrétien de Troyes, da die Adaption Hartmanns vor allem Veränderungen der Paar-Beziehung beinhaltete. Diese Analyse wird darauffolgend in den Analyseergebnissen in Kapitel 5 zusammengefasst dargestellt. Im Fazit dieser Arbeit werden die erarbeiteten Schwerpunkte zusammenfassend dargestellt und die angeführten Fragen beantwortet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsstand
- 3. Liebe und Ehe im Mittelalter
- 3.1. Theologische Ehepraxis
- 3.2. Exkurs - Hugo von St. Viktor
- 3.3. Feudale Ehepraxis
- 3.4. Der Einfluss der Frau im höfischen Kontext
- 3.5. Höfische Liebe im poetischen Diskurs
- 4. Liebe und Ehe im „Erec\"-Roman Hartmanns von Aue
- 4.1. Die erste Begegnung und der Beschluss der Ehe
- 4.2. Die Entstehung der Liebe und die Hochzeit
- 4.3. Die verligen-Szene
- 4.4. Die Aventiure-Fahrt
- 4.5. Die Joie de la court-Szene
- 5. Die Analyseergebnisse der Entwicklung der Paar-Beziehung
- 5.1. Die Unterschiede der Versionen Hartmanns von Aue und Chrétien de Troyes
- 5.2. Die Paar-Entwicklung zum gleichgestellten Herrscherpaar im Kontext der zeitgenössischen Eheauffassung
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Darstellung von Liebe und Ehe im mittelalterlichen Versroman „Erec“ Hartmanns von Aue im Kontext der zeitgenössischen Eheauffassung. Ziel ist es, die Frage zu untersuchen, inwiefern die Protagonisten des Romans einen Kontrast zu den zeitgenössischen Liebes- und Eheauffassungen darstellen und somit das Ideal eines höfisch liebenden Herrscherpaares anstreben.
- Analyse der Paar-Beziehung im „Erec“-Roman Hartmanns von Aue
- Vergleich mit der zeitgenössischen Eheauffassung
- Untersuchung der Rolle von Liebe und Minne im höfischen Kontext
- Entwicklung des Paares im Kontext der historischen Realität
- Vergleich mit dem französischen Vorbild Chrétien de Troyes
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und erläutert den historischen und literarischen Kontext des Romans. Kapitel 2 beleuchtet den aktuellen Forschungsstand zum Thema Liebe und Ehe im Mittelalter. Kapitel 3 untersucht die Eheauffassungen des Mittelalters, sowohl die theologische als auch die feudale Sichtweise, sowie den Einfluss der Frau im höfischen Kontext. Kapitel 4 analysiert die Darstellung von Liebe und Ehe im „Erec“-Roman Hartmanns von Aue, indem die Entwicklung der Paar-Beziehung und die Beziehung zum zeitgenössischen Kontext beleuchtet werden. Kapitel 5 präsentiert die Analyseergebnisse und vergleicht die Versionen Hartmanns von Aue und Chrétien de Troyes.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Liebe, Ehe, höfische Kultur, mittelalterliche Gesellschaft, "Erec"-Roman Hartmanns von Aue, Chrétien de Troyes, Minne, theologische Ehepraxis, feudale Eheauffassung, Einfluss der Frau im höfischen Kontext, Paar-Beziehung und zeitgenössische Eheauffassung. Darüber hinaus werden wichtige Konzepte wie Herrscherpaar, Aventiure-Fahrt und Joie de la court-Szene behandelt.
Häufig gestellte Fragen
Wie werden Liebe und Ehe im 'Erec' von Hartmann von Aue dargestellt?
Der Roman thematisiert die Entwicklung eines Paares hin zu einem idealen, gleichgestellten Herrscherpaar im Spannungsfeld zwischen individueller Minne und gesellschaftlichen Verpflichtungen.
Was bedeutet das Motiv des 'verligen' im Erec?
'Verligen' bezeichnet den Zustand, in dem Erec seine ritterlichen Pflichten vernachlässigt, weil er sich zu sehr dem privaten Eheglück mit Enite hingibt. Dies führt zur sozialen Krise.
Wie unterschied sich die mittelalterliche kirchliche von der feudalen Eheauffassung?
Die Kirche betonte zunehmend den Konsens der Partner (Konsensehe), während der Adel die Ehe oft als politisches und ökonomisches Instrument zur Bündnissicherung betrachtete.
Welche Rolle spielt die Frau im höfischen Kontext des Romans?
Enite ist nicht nur passives Objekt, sondern ihre Rolle wandelt sich im Laufe der Aventiure-Fahrt hin zu einer Partnerin, die aktiv zur Bewährung des Helden beiträgt.
Was ist die 'Joie de la court' Szene?
Es ist die abschließende Episode des Romans, in der Erec durch den Sieg über Mabonagrin eine erstarrte Form der Minne überwindet und die gesellschaftliche Freude (Joie) wiederherstellt.
Wie unterscheidet sich Hartmanns Version von Chrétien de Troyes?
Hartmann adaptierte die französische Vorlage und nahm spezifische Änderungen an der Paar-Beziehung vor, um sie stärker im Kontext deutscher zeitgenössischer Vorstellungen zu verankern.
- Quote paper
- Joana Wagenknecht (Author), 2020, Liebe und Ehe im Roman "Erec" von Hartmann von Aue, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1187508