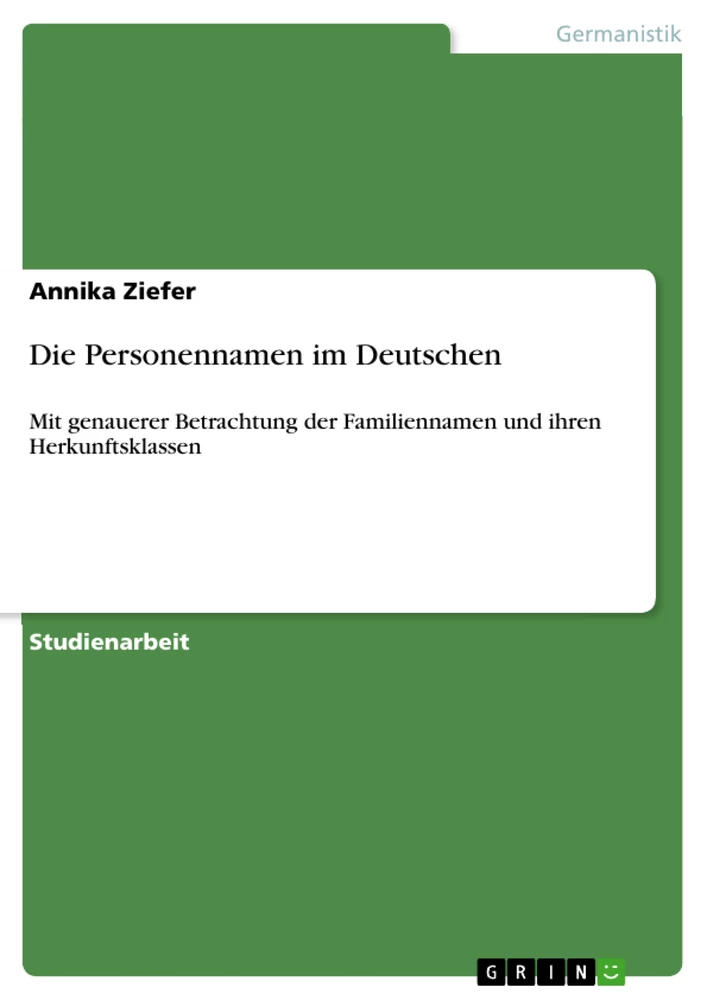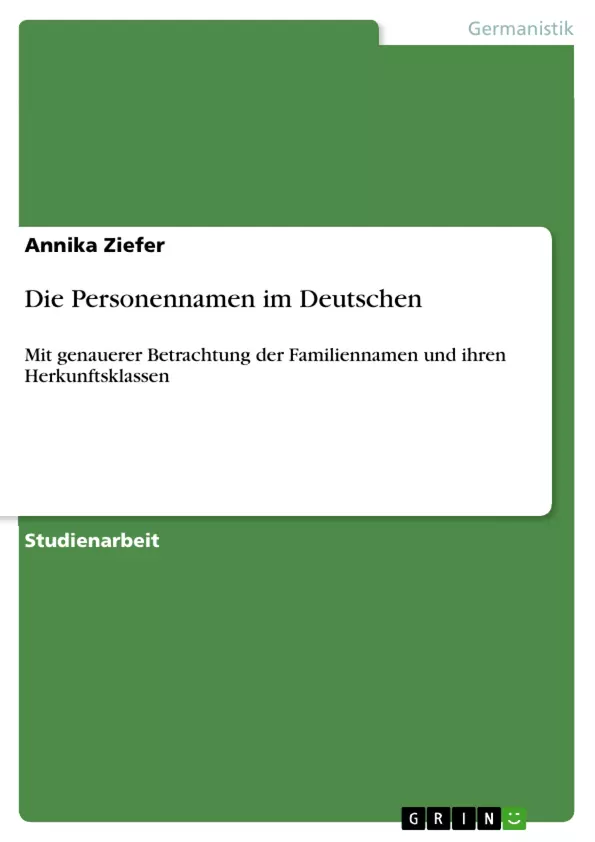In dieser Arbeit werden die Familiennamen in Deutschland, als Teil der Personennamen, genauer betrachtet, indem die bestehende Forschung zusammengefasst wird.
Dafür findet zunächst ein Überblick des Gegenstandsbereichs der Personennamen statt, bevor der Fokus auf die Familiennamen gelegt wird. Diese werden in ihre fünf Klassen unterteilt und anschließend wird zusätzlich kurz auf die wichtigsten diachronischen, diatopischen und diastratischen Aspekte eingegangen.
Ziel ist es, einen Überblick über ein vielschichtiges und noch längst nicht abgeschlossenes beziehungsweise vollständig erforschtes Themen- und Forschungsgebiet zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Personenname
- Der Familienname
- Familiennamenklassen
- Diachronischer, diatopischer und diastratischer Aspekt
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit den Familiennamen im Deutschen und setzt sich zum Ziel, die bestehenden Forschungsansätze zusammenzufassen und einen Überblick über dieses vielschichtige und noch nicht vollständig erforschte Themengebiet zu geben.
- Erläuterung des Personennamenbegriffs und seiner Gliederung
- Einordnung der Familiennamen in die verschiedenen Klassen
- Untersuchung der diachronischen, diatopischen und diastratischen Aspekte von Familiennamen
- Analyse der Bedeutung des Familiennamens für die Identifizierung und Charakterisierung von Personen
- Diskussion der Rolle von Namen in der Kultur- und Sozialgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Das Kapitel führt in die Thematik der Personennamen ein und betont deren Bedeutung für die menschliche Identifizierung. Es werden die grundlegenden Bestandteile des Personennamens, Vorname und Familienname, erläutert. Das Kapitel verdeutlicht die Rolle des Familiennamens als Kennzeichen der Zugehörigkeit zu einer Familie.
2. Der Personenname
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Namenkunde und den verschiedenen Arten von Personennamen. Es werden die grundlegenden Gruppen von Personennamen vorgestellt, wie z. B. Vornamen, Beinamen und Familiennamen. Es werden die Funktionen des Personennamens für die Kommunikation, Identifikation und Charakterisierung des Menschen betrachtet. Das Kapitel beleuchtet auch die verschiedenen Aspekte der Namensgebung, wie z. B. die Namensmode und die Bedeutung der Namen für die Kultur und Sozialgeschichte.
Schlüsselwörter
Personennamen, Familiennamen, Namenkunde, Anthroponyme, Toponyme, Namensgebung, Namenmode, Familiennamenklassen, Diachronie, Diatopie, Diastrie, Identifikation, Kulturgeschichte, Sozialgeschichte
Häufig gestellte Fragen
Wie sind Personennamen im Deutschen gegliedert?
Ein Personenname besteht in Deutschland in der Regel aus dem Vornamen (Rufnamen) und dem Familiennamen (Zunamen).
In welche Klassen werden Familiennamen unterteilt?
Die Namenforschung unterscheidet meist fünf Klassen: Berufsnamen, Herkunftsnamen, Wohnstättennamen, Übernamen (Eigenschaftsnamen) und Namen nach dem Vater (Patronymika).
Was ist der Unterschied zwischen Diachronie und Diatopie in der Namenkunde?
Diachronie betrachtet die historische Entwicklung der Namen über die Zeit, während Diatopie die regionale Verbreitung und Unterschiede von Namen (Dialekteinflüsse) untersucht.
Was verrät ein Übername über eine Person?
Übernamen basieren oft auf körperlichen Merkmalen (z.B. "Klein"), Charaktereigenschaften (z.B. "Fröhlich") oder markanten Lebensereignissen der Vorfahren.
Warum wurden Familiennamen überhaupt eingeführt?
Mit wachsender Bevölkerung im Mittelalter reichten Vornamen zur eindeutigen Identifizierung für Verwaltung, Steuerwesen und Rechtsprechung nicht mehr aus.
- Arbeit zitieren
- Annika Ziefer (Autor:in), 2022, Die Personennamen im Deutschen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1187522