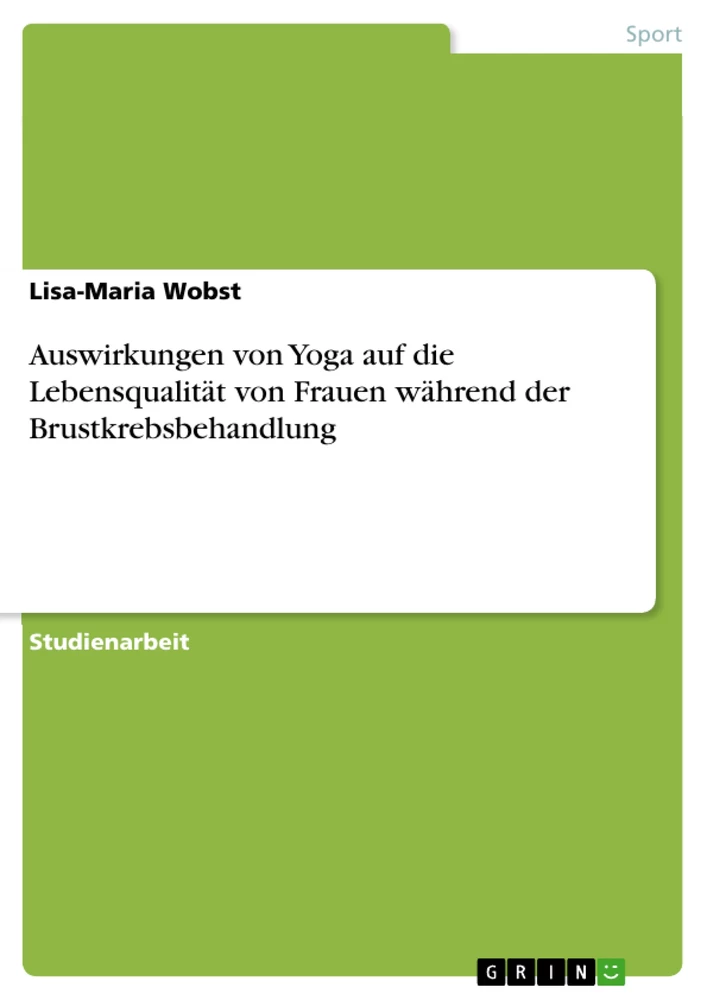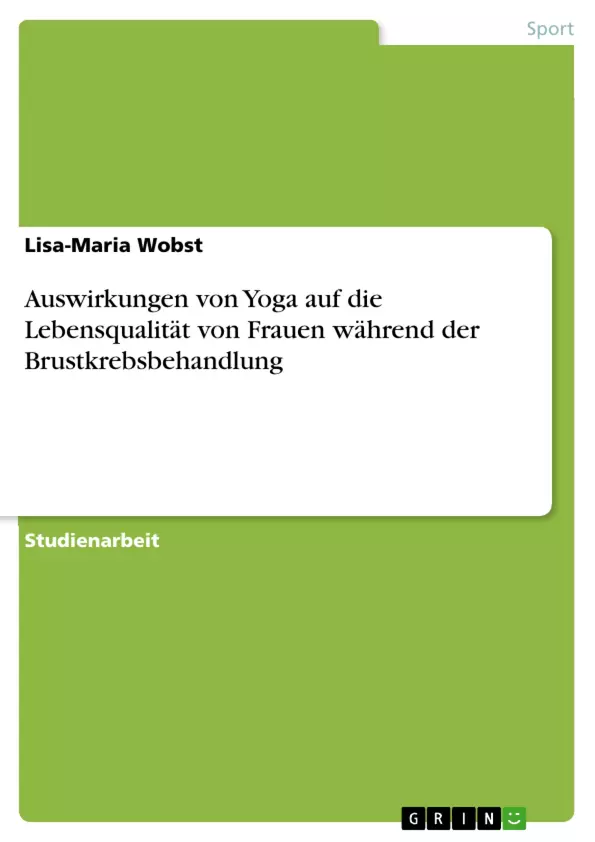In dieser Arbeit werden zwei randomisiert kontrollierte Studien, die die Auswirkungen von Yoga auf die Lebensqualität von Patientinnen während der Brustkrebstherapie untersuchen, kritisch bewertet. Brustkrebs ist die mit Abstand am häufigsten diagnostizierte Krebsart bei Frauen in Deutschland und in den industrialisierten Staaten der Welt. Im Jahr 2016 erkrankten allein in Deutschland etwa 69.000 Frauen neu an Brustkrebs. Zu den Säulen der Brustkrebstherapie zählen Operation, Chemotherapie und Strahlentherapie. Allerdings leiden Patient:innen während und nach der Krebstherapie oft unter diversen psychischen und körperlichen Begleiterscheinungen wie verminderter Leistungsfähigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Fatigue, Angstzuständen und Depression.
All dies kann sich negativ auf die Lebensqualität der Patient:innen auswirken. Die gesundheitsbezogene Lebensqualität ist bislang nicht einheitlich definiert, zumeist wird es aber als ein multidimensionales Konstrukt verstanden, welches die Funktionsfähigkeit und das subjektive Wohlbefinden in verschiedenen wichtigen Lebensbereichen umfasst. Um die Nebenwirkungen von Krebstherapien zu reduzieren, ist die Anwendung von körperlichem Training oftmals Teil des Behandlungskonzepts. Ergänzende, komplementärmedizinische Ansätze stellen dabei unter anderem die sogenannten Psyche-Körper-Interventionen dar. Zu diesen zählen beispielsweise Yoga, Hypnose, Autogenes Training und Kunsttherapien, wobei Yoga zu den am häufigsten genutzten und den am besten untersuchten, komplementären Therapien zählt.
Ziel dieser Interventionen ist es, die Symptomkontrolle zu optimieren oder die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Wissenschaftliche Untersuchungen zu den Vorteilen von Yoga begannen in den frühen 1970er Jahren mit Berichten über den Nutzen bei medizinischen Erkrankungen wie Bluthochdruck, Angstzuständen, Depressionen und Rückenschmerzen, um nur einige zu nennen. In den letzten zwei Jahrzehnten stieg die Zahl an Untersuchungen, darunter auch Systematische Übersichtsarbeiten und Meta-Analysen, welche zeigten, dass Yoga auch die gesundheitsbezogene Lebensqualität von Krebspatienten verbessern kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Wissenschaftliche Ziel- und Fragestellung
- 3. Methodik
- 3.1 Literaturrecherche
- 3.2 Ein- und Ausschlusskriterien
- 3.3 Bewertungskriterien für Studienqualität
- 4. Ergebnisse
- 4.1 Literaturrecherche
- 4.2 Beschreibung der eingeschlossenen Studien
- 4.2.1 Randomized, Controlled Trial of Yoga in Women With Breast Cancer Undergoing Radiotherapy
- 4.2.2 Iyengar-Yoga Compared to Exercise as a Therapeutic Intervention during (Neo)adjuvant Therapy in Women with Stage I-III Breast Cancer: Health-Related Quality of Life, Mindfulness, Spirituality, Life Satisfaction, and Cancer-Related Fatigue
- 4.3 Kritische Bewertung der Studien
- 4.3.1 Randomized, Controlled Trial of Yoga in Women With Breast Cancer Undergoing Radiotherapy
- 4.3.2 Iyengar-Yoga Compared to Exercise as a Therapeutic Intervention during (Neo)adjuvant Therapy in Women with Stage I-III Breast Cancer: Health-Related Quality of Life, Mindfulness, Spirituality, Life Satisfaction, and Cancer-Related Fatigue
- 4.4 Darstellung und Diskussion der Studienergebnisse
- 5. Diskussion
- 6. Schlussfolgerung und Ausblick
- 7. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Auswirkungen von Yoga auf die Lebensqualität von Frauen während der Brustkrebsbehandlung. Die Arbeit zielt darauf ab, die relevanten Studien zu diesem Thema zu identifizieren und zu bewerten, um einen fundierten Überblick über den aktuellen Stand der Forschung zu gewinnen.
- Bewertung der Auswirkungen von Yoga auf die Lebensqualität von Brustkrebspatientinnen
- Analyse der Studienmethodik und -qualität
- Identifizierung von Schlüsselthemen wie gesundheitsbezogene Lebensqualität, Fatigue und psychische Belastung
- Diskussion der potenziellen Vorteile von Yoga als komplementäre Therapieform
- Bewertung der wissenschaftlichen Evidenz für den Einsatz von Yoga in der Brustkrebstherapie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas und den aktuellen Forschungsstand beleuchtet. Anschließend wird die wissenschaftliche Ziel- und Fragestellung präzisiert. Kapitel 3 behandelt die Methodik der Literaturrecherche, die Auswahlkriterien für die Studien und die Bewertung der Studienqualität. In Kapitel 4 werden die Ergebnisse der Literaturrecherche präsentiert, wobei zwei spezifische Studien im Detail vorgestellt und kritisch bewertet werden. Kapitel 5 bietet eine umfassende Diskussion der Ergebnisse, wobei die Stärken und Schwächen der Studien sowie die Relevanz der Ergebnisse im Kontext der aktuellen Forschung beleuchtet werden. Abschließend werden Schlussfolgerungen gezogen und ein Ausblick auf zukünftige Forschungsbedarfe gegeben.
Schlüsselwörter
Brustkrebs, Yoga, Lebensqualität, komplementäre Therapie, gesundheitsbezogene Lebensqualität, Fatigue, psychische Belastung, randomisiert kontrollierte Studie, Studienqualität, Evidenzbasierte Medizin.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkt sich Yoga auf die Lebensqualität bei Brustkrebs aus?
Studien zeigen, dass Yoga als komplementäre Therapie das subjektive Wohlbefinden steigern und die Funktionsfähigkeit in verschiedenen Lebensbereichen während der Behandlung verbessern kann.
Kann Yoga die Nebenwirkungen einer Chemotherapie lindern?
Ja, Yoga kann dazu beitragen, Begleiterscheinungen wie Übelkeit, Erbrechen, Fatigue (Erschöpfung), Angstzustände und Depressionen zu reduzieren.
Was ist Fatigue im Zusammenhang mit Krebs?
Fatigue bezeichnet eine chronische, belastende Erschöpfung, die häufig während und nach der Krebstherapie auftritt und die Lebensqualität stark einschränkt.
Was sind Psyche-Körper-Interventionen?
Dies sind komplementärmedizinische Ansätze wie Yoga, Hypnose oder autogenes Training, die darauf abzielen, die Symptomkontrolle durch das Zusammenspiel von Geist und Körper zu optimieren.
Gibt es wissenschaftliche Belege für die Wirkung von Yoga?
Ja, die Arbeit bewertet randomisiert kontrollierte Studien, die positive Effekte von Yoga auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität und Achtsamkeit belegen.
Welche Rolle spielt Iyengar-Yoga in der Forschung?
Iyengar-Yoga wurde in Studien spezifisch mit herkömmlichem körperlichem Training verglichen, um dessen Einfluss auf Spiritualität, Lebenszufriedenheit und Fatigue zu untersuchen.
- Quote paper
- Lisa-Maria Wobst (Author), 2021, Auswirkungen von Yoga auf die Lebensqualität von Frauen während der Brustkrebsbehandlung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1188188