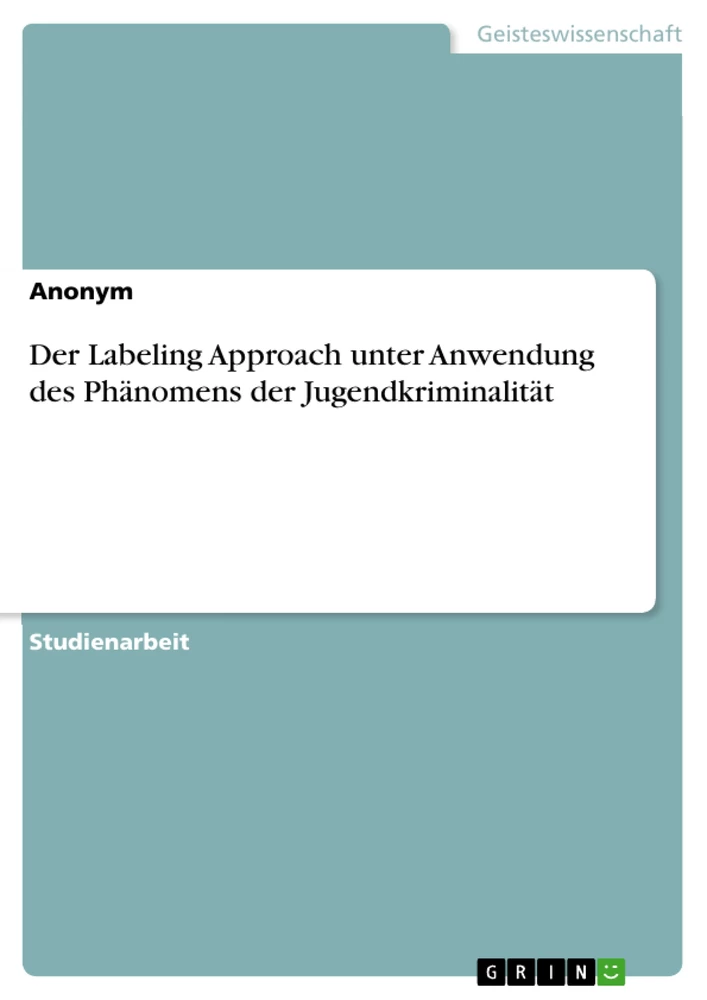Die vorliegende Hausarbeit möchte das Phänomen der Jugendkriminalität in Verbindung mit dem Labeling Approach bringen. Die Forschungsfrage hierbei lautet "Inwiefern lassen sich die verschiedenen Labeling-Perspektiven auf das Phänomen der Jugendkriminalität anwenden?". Im Folgenden wird zunächst die Jugendkriminalität als Phänomen kurz umrissen und es werden wichtige Charakteristika genannt. Daraufhin folgt eine kompakte Darstellung der verschiedenen Labeling-Perspektiven nach den Theoretikern Becker, Goffman, Lemert und Sack. Um der Forschungsfrage nachzugehen, wird im letzten Schritt eine Verbindung zwischen Phänomen und Theorie geschaffen. Es sollen Möglichkeiten der Anwendung der Theorien verdeutlicht und ein möglicher Erklärungsansatz für die Jugendkriminalität veranschaulicht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Jugendkriminalität
- Labeling Approach
- Labeling Approach nach Becker
- Labeling Approach nach Goffman
- Labeling Approach nach Lemert
- Labeling Approach nach Sack
- Jugendkriminalität in Verbindung mit Labeling Approach
- Beispiel des Labelings in der Jugendkriminalität
- Labeling Approach
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert das Phänomen der Jugendkriminalität im Lichte des Labeling Approach, einer zentralen Theorie der Kriminologie. Die Forschungsfrage zielt darauf ab, die verschiedenen Perspektiven des Labeling Approachs auf das Phänomen der Jugendkriminalität anzuwenden.
- Analyse des Labeling Approach als Reaktionstheorie der Kriminalisierung
- Untersuchung der verschiedenen Perspektiven des Labeling Approachs, u.a. Becker, Goffman, Lemert und Sack
- Verbindung des Labeling Approachs zur Erklärung von Jugendkriminalität
- Exploration des Einflusses von Etikettierungsprozessen auf die Entstehung und Wahrnehmung von Jugendkriminalität
- Bedeutung der formellen Sozialkontrolle im Kontext der Jugendkriminalität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema der Jugendkriminalität, wobei die mediale und politische Rezeption und die statistische Erfassung von Jugenddelikten beleuchtet werden. Anschließend wird der Labeling Approach als theoretischer Rahmen eingeführt, der die Entstehung von Kriminalität durch Definitions- und Zuschreibungsprozesse erklärt.
Im zweiten Kapitel wird die Jugendkriminalität als Phänomen genauer betrachtet, wobei die typischen Charakteristika von Jugenddelikten analysiert werden. Darüber hinaus werden die verschiedenen Perspektiven des Labeling Approachs von namhaften Theoretikern wie Becker, Goffman, Lemert und Sack vorgestellt.
Schlüsselwörter
Jugendkriminalität, Labeling Approach, Etikettierung, Reaktionsansatz, Kontrollparadigma, formelle Sozialkontrolle, Definitionsmacht, Außenseiter, Stigmatisierung, Jugendstrafrecht, Devianz, Kriminalisierung
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2021, Der Labeling Approach unter Anwendung des Phänomens der Jugendkriminalität, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1188226