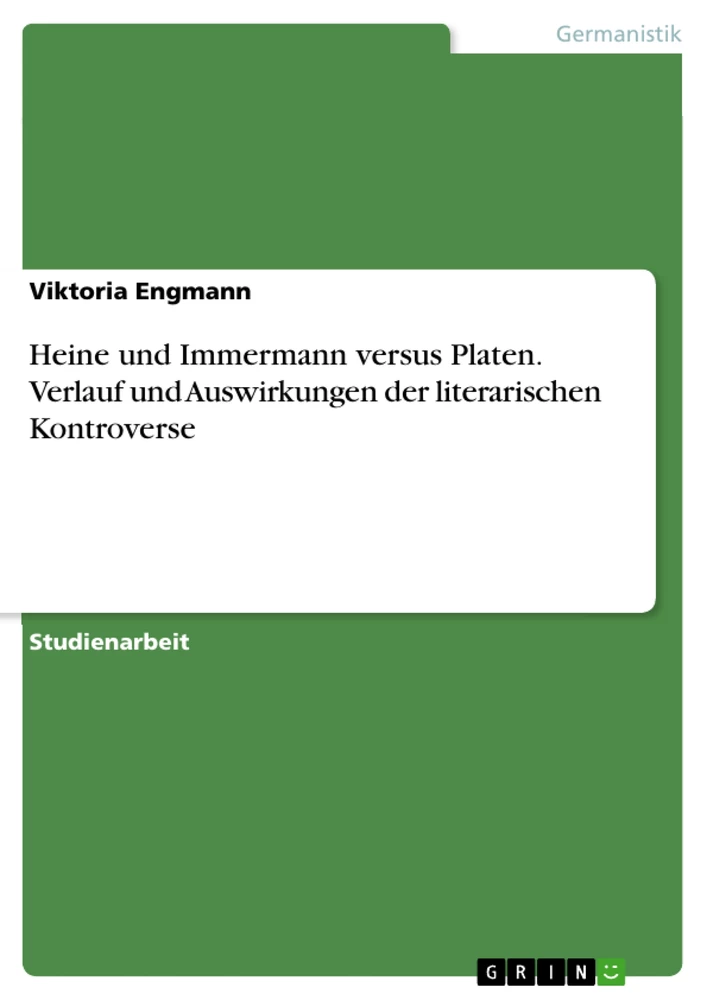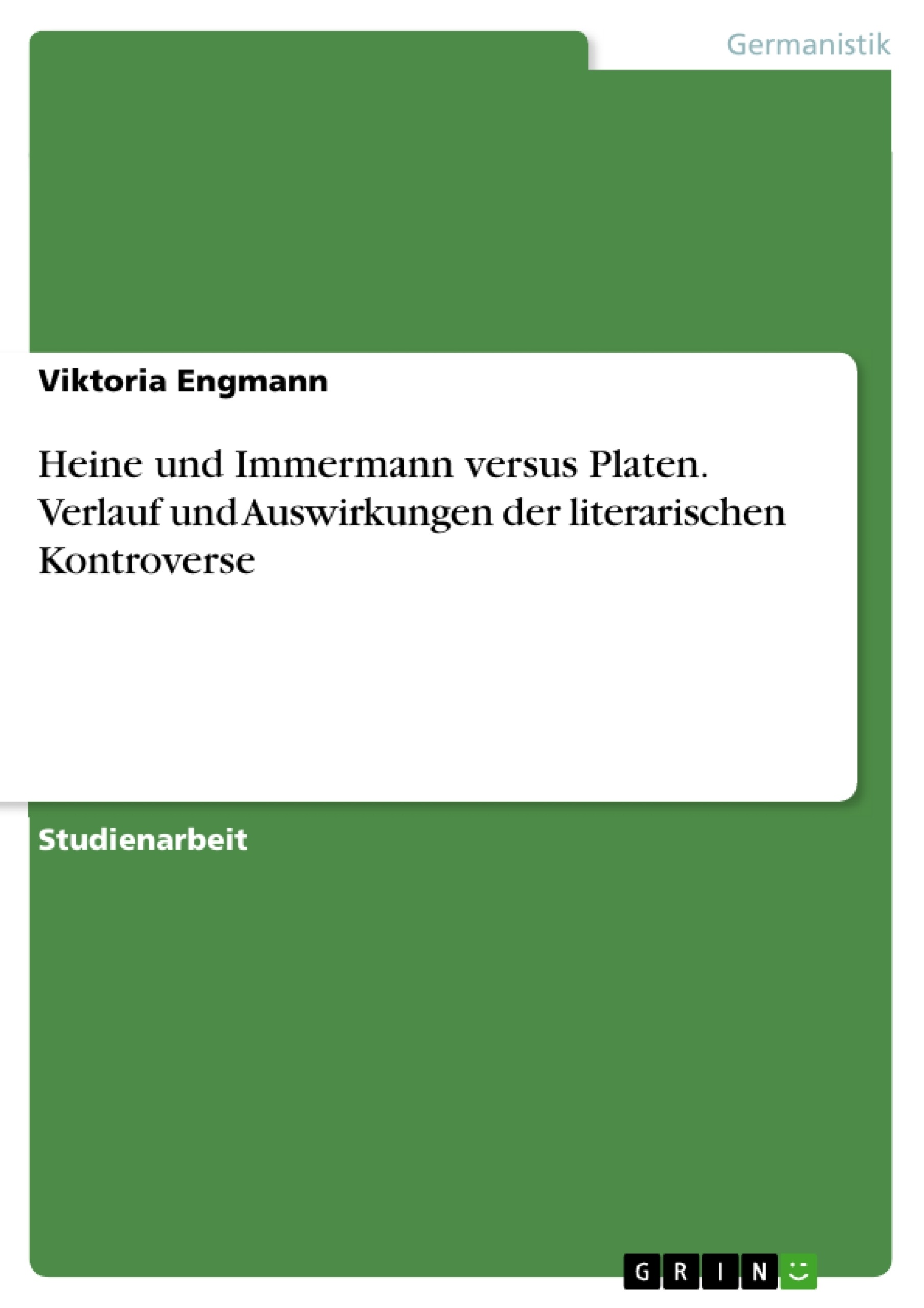Dieser Arbeit geht der Forschungsfrage nach, wie der literarische Streit zwischen Heinrich Heine und Karl Immermann gegen August von Platen entstand und verlief und welche Auswirkungen er speziell für Heinrich Heine hatte.
Es wird auf die literarischen Streitschriften im Allgemeinen und ihren Zweck eingegangen sowie speziell die Kontroverse zwischen Heine und Platen. Zudem wird der literarische Gegenstand, welcher zunächst der Auslöser für den Streit war, näher bestimmt. Des Weiteren wird der Streit mit den dazugehörigen literarischen Schriften chronologisch benannt und analysiert. Abschließend werden die Folgen des Streits betrachtet in Hinblick auf die Reaktionen und Kritiken von Heines Zeitgenossen sowie ein Blick aus der heutigen Heine-Forschung auf den Literaturstreit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Streitschriften und Skandale in der Literatur
- Die literarische Streitschrift
- Satire/Polemik bei Heine und Platen
- Der literarische Gegenstand
- Der literarische Streit Immermann/Platen/Heine
- Karl Immermanns “Xenien”
- August von Platens \"Der romantische Ödipus”
- Karl Immermanns “Der im Irrgarten der Metrik umhertaumelnde Kavalier”
- Heinrich Heines Platen-Polemik in “Die Bäder von Lucca”
- Auswirkungen des Streits
- Kritik von Zeitgenossen an Heine
- Beurteilung des Streits in der Heine Forschung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der literarischen Kontroverse zwischen Heinrich Heine und Karl Immermann gegen Graf August von Platen und ihren Auswirkungen auf Heines Werk. Im Zentrum der Untersuchung steht die Frage, wie dieser Streit entstand, verlief und welche Folgen er für Heine hatte.
- Die Rolle literarischer Streitschriften in der Romantik und der frühen Moderne
- Die Verwendung von Satire und Polemik als literarische Mittel im Streit zwischen Heine und Platen
- Die Analyse der einzelnen Werke, die den Streit auslösten, wie die Xenien von Immermann und Heines Platen-Polemik in "Die Bäder von Lucca"
- Die Rezeption des Streits durch Zeitgenossen und die aktuelle Forschung
- Die Bedeutung des Streits für Heines literarische Entwicklung und seine öffentliche Wahrnehmung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den Streit zwischen Heine und Platen, welcher in Heines "Die Bäder von Lucca" seinen Ursprung findet. Die Einleitung stellt die Hauptfiguren des Streits und den zeitlichen Kontext dar.
Streitschriften und Skandale in der Literatur: Dieses Kapitel beleuchtet die literarischen Streitschriften im Allgemeinen und setzt den Streit zwischen Heine und Platen in diesen Kontext. Es werden verschiedene Typologien von Streitschriften definiert und die Verwendung von Satire und Polemik im Kontext literarischer Auseinandersetzungen analysiert.
Der literarische Streit Immermann/Platen/Heine: Dieses Kapitel widmet sich der chronologischen Analyse des Streits, beginnend mit Karl Immermanns "Xenien" und endend mit Heines Platen-Polemik in "Die Bäder von Lucca". Hier werden die einzelnen Werke des Streits genauer untersucht und die Argumentationslinien der beteiligten Autoren dargestellt.
Auswirkungen des Streits: In diesem Kapitel werden die Folgen des Streits für Heine betrachtet. Es werden die Reaktionen und Kritiken von Heines Zeitgenossen und die Beurteilung des Streits in der aktuellen Heine-Forschung analysiert.
Schlüsselwörter
Der Streit zwischen Heinrich Heine und Graf August von Platen-Hallermünde ist ein zentraler Punkt in Heines literarischer Entwicklung. Die Analyse des Streits erfordert ein Verständnis von Begriffen wie "literarische Streitschrift", "Satire", "Polemik" und "Personalpolitik". Darüber hinaus sind wichtige Themen des Streits die literarische Qualität der beteiligten Autoren, die gesellschaftliche und politische Situation der Zeit sowie die Auswirkungen des Streits auf Heines Werk und dessen Rezeption.
Häufig gestellte Fragen
Worüber stritten sich Heinrich Heine und August von Platen?
Der Streit begann als literarische Auseinandersetzung über Metrik und Poetik, eskalierte jedoch schnell zu persönlichen Angriffen und Polemiken.
Welche Rolle spielte Karl Immermann in diesem Konflikt?
Immermann löste den Streit mit seinen „Xenien“ aus, in denen er Platens Dichtung verspottete, woraufhin Platen mit dem Lustspiel „Der romantische Ödipus“ antwortete.
Wie reagierte Heine in „Die Bäder von Lucca“ auf Platen?
Heine veröffentlichte eine scharfe Polemik, in der er Platen nicht nur literarisch angriff, sondern auch dessen Homosexualität öffentlich thematisierte.
Welche Auswirkungen hatte der Streit auf Heines Ruf?
Heines Zeitgenossen kritisierten die Härte und Persönlichkeit seiner Polemik scharf, was sein Ansehen in Deutschland zeitweise beschädigte.
Was war eine „literarische Streitschrift“ im 19. Jahrhundert?
Es war ein gängiges Genre, um ästhetische oder politische Differenzen öffentlich und oft satirisch-polemisch auszutragen.
- Quote paper
- Viktoria Engmann (Author), 2021, Heine und Immermann versus Platen. Verlauf und Auswirkungen der literarischen Kontroverse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1188360