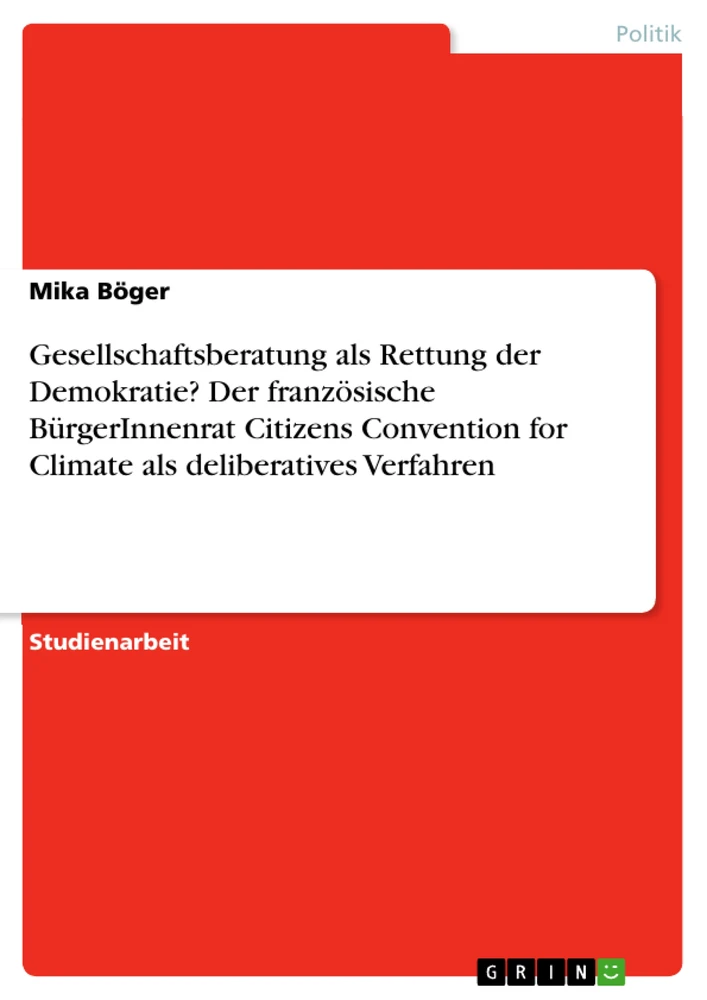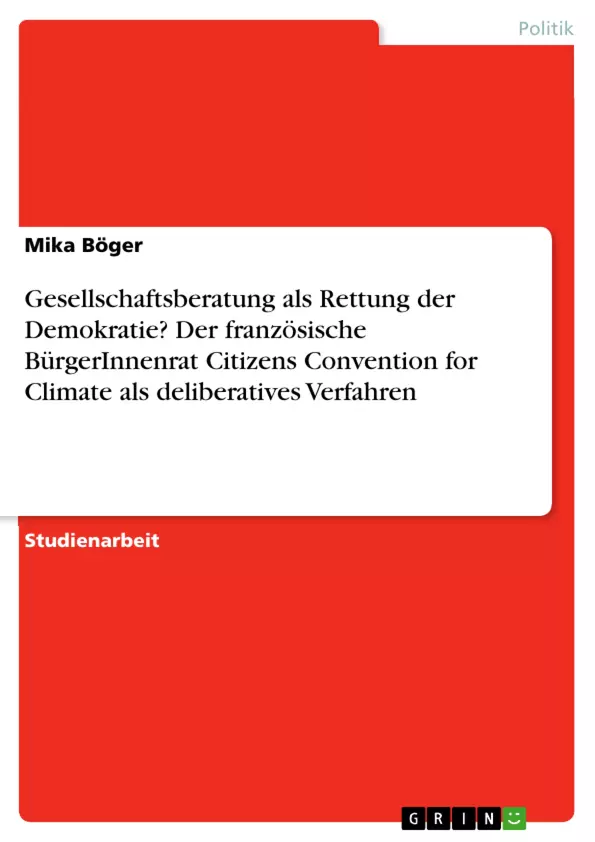Diese Hausarbeit wirft einen Blick auf den französischen BürgerInnenrat, die Citizens Convention for Climate. Vor dem Hintergrund der Hypothesen von bekannten PolitikwissenschaftlerInnen, welche einen demokratiefördernden Effekt in deliberativen Partizipationsmöglichkeiten von BürgerInnen in Politikprozessen sehen, wird die CCC mithilfe von Kriterien der OECD für gute deliberative Verfahren anhand eines ordinalen Skalenniveaus bewertet. Im Analyseteil sowie im Fazit wird Bezug auf die Methodik und die verwendeten Kategorien zur Beurteilung des BürgerInnenrates genommen und erläutert warum sich manche Kategorien in einem Zielkonflikt zueinander befinden, worunter dann auch die Qualität eines BürgerInnenrates leidet.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in die Umweltpolitik, ihre Relevanz für Partizipationsmöglichkeiten und die Citizens Convention for Climate
- Theoretische Einleitung
- Zu Politikberatung
- Zu Politikfeldern
- Deliberation
- Formen und Verfahren von Bürgerinnenbeteiligung
- Bürgerinnenbeteiligung als Chance
- Gesellschaftsberatung als deliberative Möglichkeit der Bürgerlnnenbeteiligung mit kollektiver Empfehlungsbildung
- Methodik
- Kategorien der OECD
- Analyse der Citizens Convention for Climate
- Ergebnisse und ein Resümee der Methodik
- Zur Zustimmung der ausgearbeiteten Maßnahmen und den Hürden von deliberativen Bürgerinnenverfahren
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Citizens Convention for Climate (CCC) in Frankreich, ein Beispiel für deliberative Bürgerinnenbeteiligung in der Umweltpolitik. Ziel ist es zu untersuchen, ob und inwiefern der CCC als Gesellschaftsberatung einzustufen ist und welche Bedeutung er für die Gestaltung partizipativer Politik hat.
- Der aktuelle Diskurs über Bürgerinnenbeteiligung und partizipative Politikberatung
- Deliberative Prozesse und ihre Relevanz für die Politikgestaltung
- Die Rolle von ExpertInnen in der Politikberatung
- Die Funktionsweise und Wirksamkeit des CCC als Bürgerinnenrat
- Die Bewertung des CCC als Beispiel für Gesellschaftsberatung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Relevanz der Umweltpolitik und die Rolle von Bürgerinnenbeteiligung. Anschließend wird der theoretische Rahmen der Arbeit erörtert, welcher die Konzepte von Politikberatung, Politikfeldern, Deliberation und Bürgerinnenbeteiligung beleuchtet. Das methodische Vorgehen der Arbeit wird im dritten Kapitel erläutert, bevor im vierten Kapitel die Analyse des CCC im Detail betrachtet wird. Im fünften Kapitel werden die Ergebnisse der Analyse zusammengefasst und diskutiert, einschließlich einer Bewertung des CCC als Gesellschaftsberatung und eines Ausblicks auf die Bedeutung von Bürgerinnenbeteiligung in der Politikberatung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Bürgerinnenbeteiligung, Politikberatung, Gesellschaftsberatung, Deliberation, Umweltpolitik, Klimawandel, Citizens Convention for Climate, Frankreich, partizipative Demokratie, Expertokratie, Technokratie.
- Quote paper
- Mika Böger (Author), 2022, Gesellschaftsberatung als Rettung der Demokratie? Der französische BürgerInnenrat Citizens Convention for Climate als deliberatives Verfahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1188387