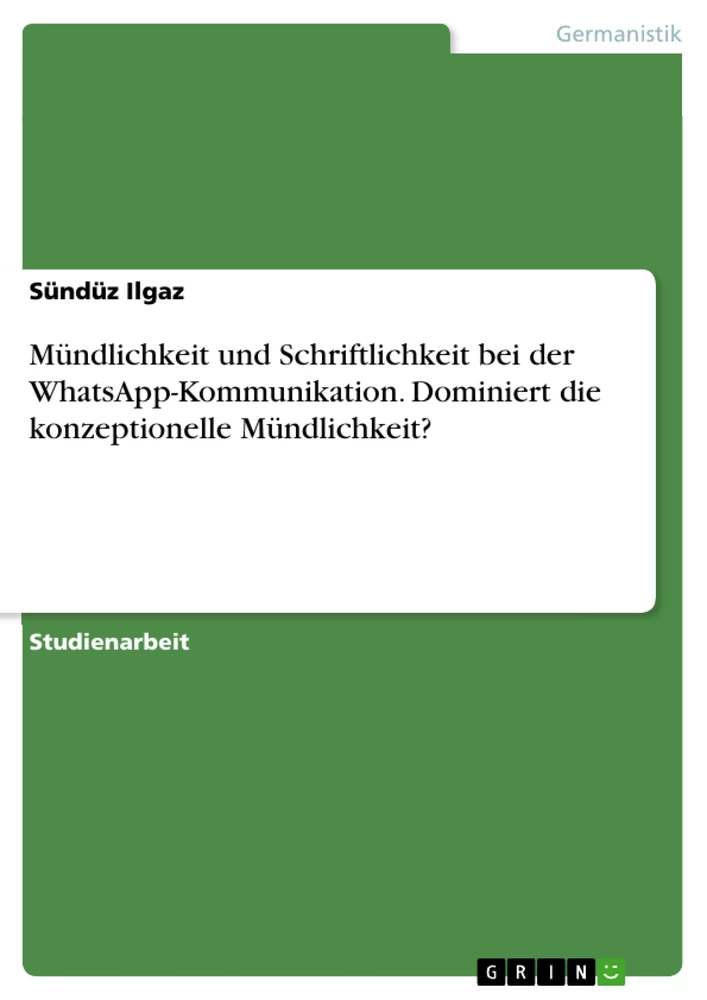Die Untersuchung der vorliegenden Arbeit konzentriert sich in diesem Zusammenhang auf die Dominanz der konzeptionellen Mündlichkeit bei der WhatsApp-Kommunikation. Zuerst wird das Modell der konzeptionellen Mündlichkeit nach Koch und Oesterreicher aufgegriffen. Dies schließt auch eine Definition der Bezeichnungen gesprochen/mündlich und geschrieben/schriftlich nach Ludwig Söll ein. Daraufhin werden "die Sprache der Nähe" und "die Sprache der Distanz" nach Koch und Oesterreicher erläutert. Im nächsten Schritt stehen die allgemeinen Merkmale der internetbasierten Kommunikation im Fokus, in die auch die WhatsApp-Kommunikation eingeordnet wird. Hiernach werden die Merkmale der konzeptionellen Mündlichkeit in der Chatkommunikation untersucht, worauf eine Erläuterung der Vorgehensweise bei der Erhebung der Daten und der Methodik der Analyse folgt. Darauf basierend werden zwei WhatsApp-Chats im Hinblick auf die Charakteristika der konzeptionellen Mündlichkeit und die Phänomene der Syntax und der Morphologie analysiert, um festzustellen, ob bei der WhatsApp-Kommunikation eine Dominanz der konzeptionellen Mündlichkeit zu erkennen ist. Abschließend werden die Ergebnisse dieser Arbeit unter Orientierung an der Problemstellung zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit: Betrachtung aus der sprachtheoretischen Sicht
- 2.1 Das Viefeldermodell nach Söll
- 2.2 Die Sprache der Nähe und Distanz nach Koch und Oesterreicher
- 2.3 Charakteristika der konzeptionellen Mündlichkeit bei der Quasi-synchronen Kommunikation
- 3. Daten und Methodik
- 4. Untersuchung der konzeptionellen Mündlichkeit bei der WhatsApp-Kommunikation
- 4.1 Ellipsen
- 4.2 Parataxen
- 4.3 Sprachlautveränderungen
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Dominanz der konzeptionellen Mündlichkeit in der WhatsApp-Kommunikation. Sie analysiert, inwiefern die Merkmale der konzeptionellen Mündlichkeit in Kurznachrichten Anwendung finden. Dazu werden zunächst die theoretischen Grundlagen der Mündlichkeit und Schriftlichkeit sowie die konzeptionelle Mündlichkeit nach Koch und Oesterreicher erörtert.
- Konzeptionelle Mündlichkeit in der WhatsApp-Kommunikation
- Untersuchung der Merkmale der konzeptionellen Mündlichkeit in Kurznachrichten
- Analyse der sprachlichen Gestaltung in WhatsApp-Chats
- Dominanz der konzeptionellen Mündlichkeit bei der WhatsApp-Kommunikation
- Bedeutung von Syntax und Morphologie in der WhatsApp-Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und beleuchtet die Relevanz von WhatsApp als Kommunikationsmedium. Kapitel zwei beschäftigt sich mit den sprachtheoretischen Grundlagen der Mündlichkeit und Schriftlichkeit, wobei das Modell der konzeptionellen Mündlichkeit nach Koch und Oesterreicher vorgestellt wird. Kapitel drei beschreibt die Methode der Datenerhebung und -analyse. Kapitel vier analysiert zwei WhatsApp-Chats im Hinblick auf die Merkmale der konzeptionellen Mündlichkeit, Syntax und Morphologie.
Schlüsselwörter
Konzeptionelle Mündlichkeit, WhatsApp-Kommunikation, Kurznachrichten, Sprache der Nähe, Sprache der Distanz, Syntax, Morphologie, Ellipsen, Parataxen, Sprachlautveränderungen.
- Quote paper
- Sündüz Ilgaz (Author), 2022, Mündlichkeit und Schriftlichkeit bei der WhatsApp-Kommunikation. Dominiert die konzeptionelle Mündlichkeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1188838