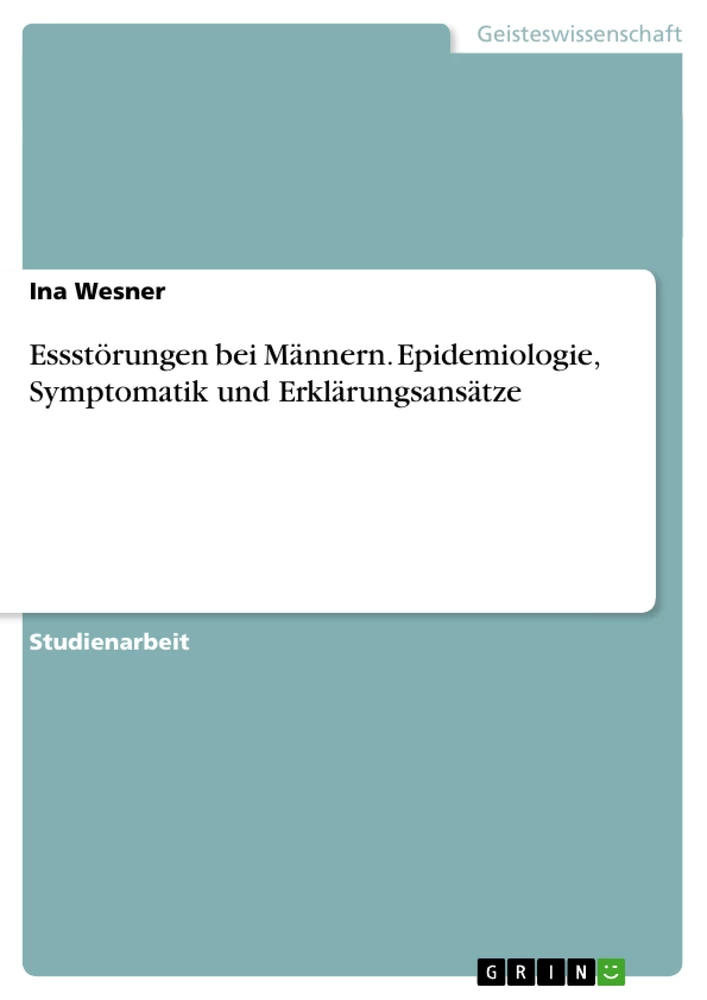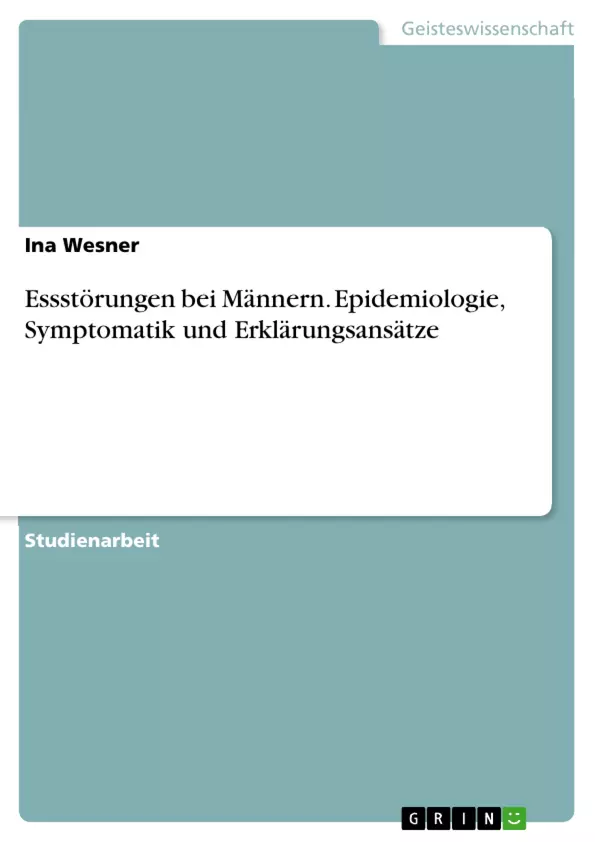Essstörungen werden auch heute noch als typisch weibliche Suchtkrankheit
missverstanden. Sowohl die Medien als auch die Wissenschaft und Gesellschaft
schenken der Betrachtung des gestörten Essverhaltens betroffener Frauen viel
Aufmerksamkeit. Dabei beinhaltete bereits der erste in der Menschheitsgeschichte
sorgfältig dokumentierte Fallbericht von Anorexia Nervosa auch die Beobachtung
eines männlichen 16-jährigeren Patienten (Morton, 1694, zitiert nach Mickalide,
1990).
Die frauenzentrierte Auffassung von Essstörungen wird zunehmend durch das
„Coming-Out“ der letzten Jahre verdrängt: Immer mehr an Essstörungen erkrankte
Männer überwinden die Hemmschwelle, bekennen sich zu ihrem Problem und
suchen professionelle Hilfe. Das Öffentlichwerden wird jedoch oft fälschlicherweise
als Zunahme der Zahl essgestörter Männer interpretiert.
Es wird deutlich, dass das Wissen über Essstörungen insbesondere bei Männern
begrenzt und unvollständig ist. Mit dieser Arbeit wird versucht, Kenntnisse über
Symptomatik und Ätiologie von männlichen Betroffenen zu vermitteln. Das nächste
Kapitel widmet sich der Epidemiologie, es folgen der Vergleich zwischen
männlichen und weiblichen Essgestörten und die charakteristischen Faktoren der
Essstörungen bei Männern.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Epidemiologie
- 1. Essstörungen - eine „Frauenkrankheit“?
- 2. Warum sind kaum Männer betroffen?
- 2.1. V-Form als männliches Körperideal
- 2.2. Zufriedenheit mit dem eigenen Körper und Strategien zur Körperveränderung
- 2.3. Essverhalten
- 2.4. Späteres Einsetzen der Pubertät
- 2.5. Psychoanalytische Perspektive: Die Geschlechtsidentität
- 2.6. Diagnostische Schwierigkeiten
- C. Symptomatik
- 1. Essstörungen bei Frauen und Männern im Vergleich
- 1.1. Gemeinsamkeiten
- 1.2. Unterschiede
- 2. Charakteristische Merkmale der Essstörungen bei männlichen Patienten
- 2.1. Sexualität und Verunsicherung in der geschlechtlichen Identität
- 2.1.1. Einstellungen gegenüber Sexualität und Sexualverhalten
- 2.1.2. Geschlechtsidentitätskonflikte und Homosexualität
- 2.1.3. Warum sind Homosexuelle eine Risikogruppe?
- 2.2. Biologische Auswirkungen
- 2.3. Komorbidität
- 2.4. Persönlichkeitsstruktur
- 2.5. Rollenunsicherheit
- 2.6. Genetische und familiäre Faktoren
- 2.7. Einfluss der beruflichen Tätigkeit
- D. Schlusswort
- E. Literaturliste
- F. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Essstörungen bei Männern. Sie soll ein tieferes Verständnis für die Epidemiologie, Symptomatik und Erklärungsansätze von Essstörungen bei Männern vermitteln. Dabei wird insbesondere auf die Frage eingegangen, warum Männer im Vergleich zu Frauen deutlich seltener von Essstörungen betroffen sind.
- Körperideale und Geschlechterrollen
- Körperwahrnehmung und Selbstbild
- Diagnostische Schwierigkeiten und Stigmatisierung
- Einfluss von Sexualität und Geschlechtsidentität
- Biologische und psychologische Faktoren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Essstörungen bei Männern ein und beleuchtet die historische Missdeutung von Essstörungen als ausschließlich weibliche Suchtkrankheit. Das Kapitel „Epidemiologie“ analysiert die Geschlechterverteilung von Essstörungen und beleuchtet die Gründe für die geringe Betroffenheit von Männern. Es werden verschiedene Faktoren wie Körperideale, Körperwahrnehmung und Geschlechtsidentität diskutiert. Das Kapitel „Symptomatik“ vergleicht die Symptome von Essstörungen bei Frauen und Männern und beleuchtet die spezifischen Merkmale von Essstörungen bei männlichen Patienten. Es werden Themen wie Sexualität, Geschlechtsidentität und Komorbidität behandelt.
Schlüsselwörter
Essstörungen, Männer, Epidemiologie, Symptomatik, Körperideal, Geschlechtsidentität, Sexualität, Diagnostik, Stigmatisierung, Komorbidität, Psychotherapie, Biologische Faktoren, Soziokulturelle Faktoren.
Häufig gestellte Fragen
Sind Essstörungen eine reine „Frauenkrankheit“?
Nein, dies ist ein Missverständnis. Bereits historische Fallberichte dokumentieren männliche Patienten, und immer mehr Männer suchen heute professionelle Hilfe.
Warum sind Männer seltener von Essstörungen betroffen?
Gründe liegen in unterschiedlichen Körperidealen (V-Form bei Männern), einer oft höheren Zufriedenheit mit dem Körpergewicht und dem späteren Einsetzen der Pubertät.
Welche Rolle spielt die Homosexualität bei männlichen Essstörungen?
Homosexuelle Männer gelten als Risikogruppe, was oft mit Geschlechtsidentitätskonflikten und einem höheren Druck bezüglich des äußeren Erscheinungsbildes erklärt wird.
Was sind diagnostische Schwierigkeiten bei Männern?
Da Essstörungen gesellschaftlich als "weiblich" stigmatisiert sind, überwinden Männer die Hemmschwelle zur Diagnose seltener, und Symptome werden von Ärzten oft nicht sofort erkannt.
Gibt es Unterschiede in der Symptomatik zwischen den Geschlechtern?
Während die psychischen Ursachen oft ähnlich sind, unterscheiden sich die Strategien zur Körperveränderung und die biologischen Auswirkungen auf den Organismus.
- Citar trabajo
- Diplom-Psychologin Ina Wesner (Autor), 2005, Essstörungen bei Männern. Epidemiologie, Symptomatik und Erklärungsansätze , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118896