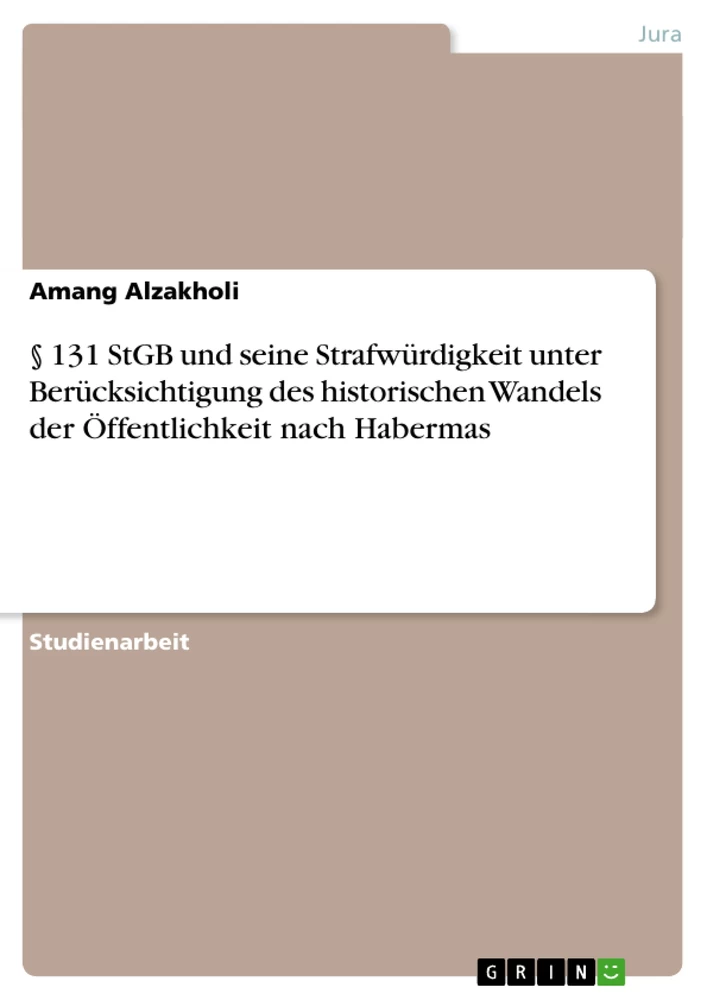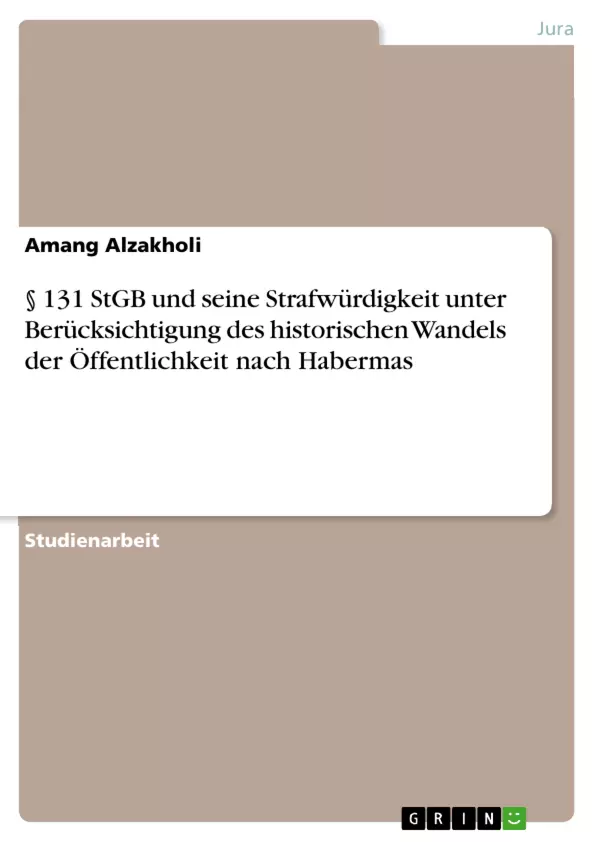Die Diskussion über den Zusammenhang von Gewaltdarstellungen und
real ausgeübter Gewalt ist nicht erst mit Aufkommen der Massenmedien
entstanden. Schilderungen von Gewalt gibt es bereits in Homers Odyssee,
und schon im Römischen Reich wurde über die negativen Einflüsse
von Gladiatorenkämpfen auf den menschlichen Charakter diskutiert.
Seit den 70er Jahren ist die Zahl von statistisch erfassten Gewalttaten in
Deutschland drastisch gestiegen. 1984 wird neben dem öffentlichrechtlichen
auch der privatwirtschaftliche Rundfunk zugelassen. Seither
nimmt die Häufigkeit von Gewaltdarstellungen in den Medien rasant zu.
Geschehen in der heutigen Zeit besonders abstoßende, unverständliche
Gewalttaten, müssen die Medien und der Konsum von medialer Gewalt
oft als Erklärung herhalten. Für ein breites Publikum ist diese Erklärung
leicht verständlich und, zumindest auf den ersten Blick, offensichtlich.
Neben Vorschriften des Jugendschutzes u.a. verbietet auch § 131 StGB
Gewaltdarstellungen. Das Besondere dieser Norm ist, dass ihre Intention
darin liegt, Erwachsene bzw. die Öffentlichkeit generell, vor dem Konsum
von medialer Gewalt zu „schützen“. Eine Kollision mit Grundrechten
wie Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit ist daher vorprogrammiert.
Der enorme Einfluss von Medien auf die Öffentlichkeit in allen Bereichen
des Lebens ist nicht zu leugnen. Es gilt zu überprüfen, ob und wie
sich z.B. die ca. 4000 Morde wöchentlich im deutschen Fernsehen auf
die Gesellschaft auswirken. Im Folgenden soll der § 131 StGB durchleuchtet,
seine Tatbestandsmerkmale und sein Rechtsgut erklärt werden.
Sodann sollen der Begriff „Öffentlichkeit“ und sein historischer Wandel
dargestellt werden. Entscheidend geprägt hat diesen Begriff der Soziologe
Jürgen Habermas. Nach Betrachtung der Norm und des Begriffs „Öffentlichkeit“
sollte sich herausstellen, ob ein § 131 StGB notwendig und
auch dazu geeignet ist, die Öffentlichkeit vor Gewalttaten zu schützen,
indem er Gewaltdarstellungen verbietet.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- § 131 StGB
- Gewaltdarstellung
- Literaturverzeichnis
- Lehrbücher
- Kommentare
- Zeitschriften
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Strafwürdigkeit von § 131 StGB unter Berücksichtigung des historischen Wandels der Öffentlichkeit nach Jürgen Habermas. Ziel ist es, die Entwicklung der öffentlichen Meinung und deren Einfluss auf die Strafbarkeit von Gewaltdarstellungen zu analysieren.
- Historische Entwicklung der Öffentlichkeit nach Habermas
- Definition und Strafbarkeit von Gewaltdarstellungen nach § 131 StGB
- Zusammenhang zwischen Öffentlichkeit und Strafbarkeit
- Aktuelle Relevanz von § 131 StGB im digitalen Zeitalter
- Kritik und Alternativen zu § 131 StGB
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einführung in § 131 StGB und die Problematik von Gewaltdarstellungen
- Kapitel 2: Die Theorie des öffentlichen Raums nach Jürgen Habermas
- Kapitel 3: Der Wandel der Öffentlichkeit im digitalen Zeitalter
- Kapitel 4: Die Strafbarkeit von Gewaltdarstellungen im Kontext der Öffentlichkeit
- Kapitel 5: Kritische Betrachtung von § 131 StGB und alternative Lösungsansätze
Schlüsselwörter
§ 131 StGB, Gewaltdarstellung, Öffentlichkeit, Medien, Strafbarkeit, Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, Digitalisierung, Meinungsfreiheit, Strafrecht, Medienrecht, Filmzensur, Jugendschutz, Menschenwürde.
- Arbeit zitieren
- Amang Alzakholi (Autor:in), 2008, § 131 StGB und seine Strafwürdigkeit unter Berücksichtigung des historischen Wandels der Öffentlichkeit nach Habermas , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/118947