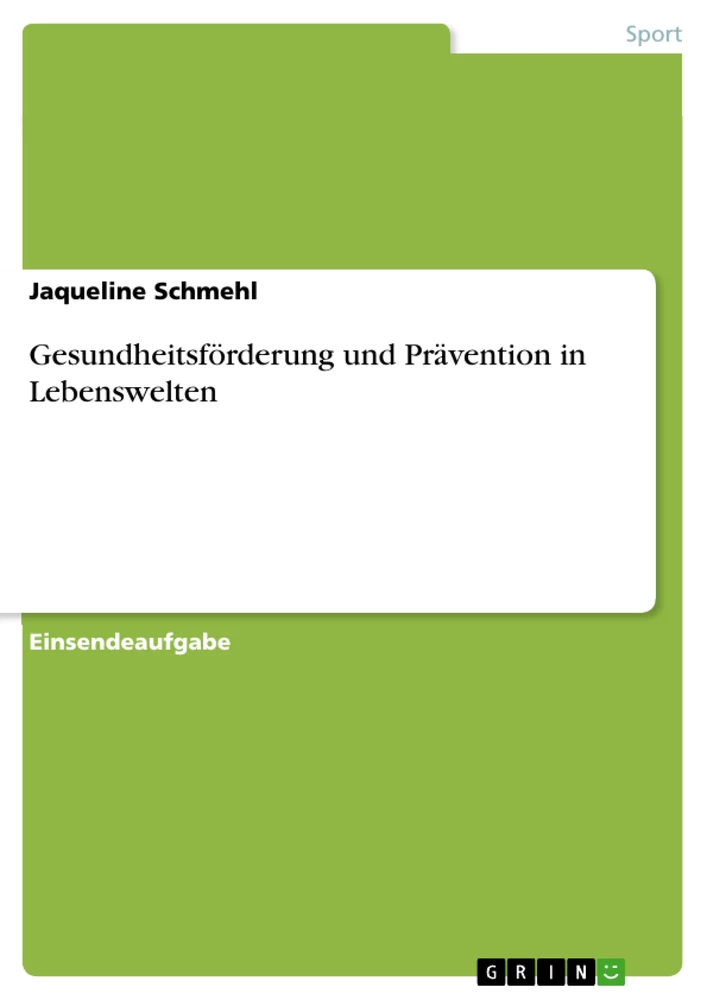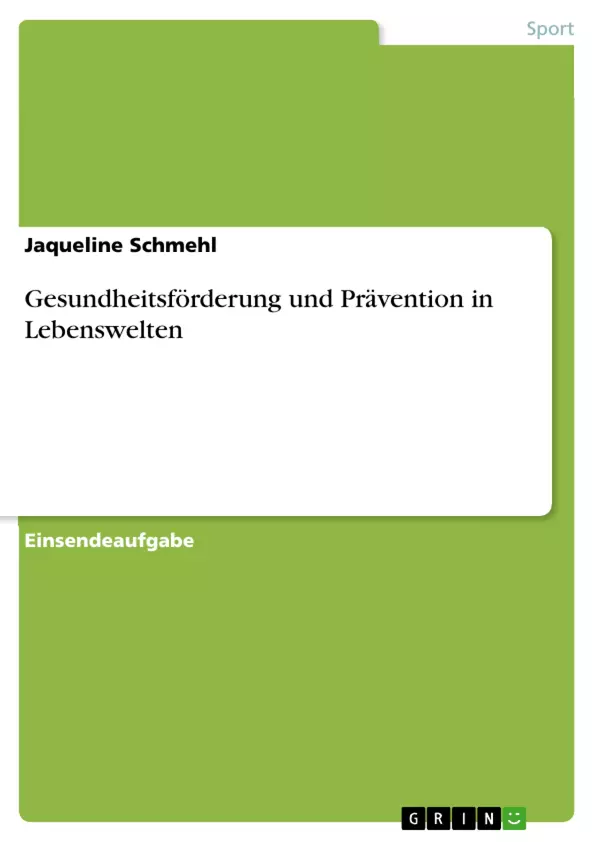Als Ausgangslage wird das Setting der Grundschule gewählt. Dabei werden die aktuelle Datenlage, sowie die zentralen Gesundheitsprobleme und -verhalten von Grundschulkindern analysiert. Somit liegt die Altersspanne, der in der folgenden Analyse betrachteten Kinder, zwischen 6 und 11 Jahren.
Inhaltsverzeichnis
1 ANALYSE DER AUSGANGSSITUATION
1.1 Gesundheitsbezogene Datenlage
1.1.1 Zentrale Gesundheitsprobleme von Grundschulkindern
1.1.2 Gesundheitsverhalten von Grundschulkindern
1.1.3 Grundschule geeignet als Schlüsselsetting?
1.2 Ableitung von Handlungsansätzen
1.2.1 Schaffen eines positiven Ernährungsverhaltens
1.2.2 Förderung und Aufrechterhaltung von körperlicher Aktivität
1.2.3 Reduzierung des Infektionsrisikos durch positives Hygieneverhalten
2 SCHWERPUNKTTHEMA FÜR EIN PROJEKT ZUR GESUNDHEITSFÖRDERUNG IM SETTING SCHULE
3 RECHERCHE MODELLPROJEKT
4 LITERATURVERZEICHNIS
5 TABELLENVERZEICHNIS
1 Analyse der Ausgangssituation
Als Ausgangslage wird das Setting der Grundschule gewählt. Dabei werden die aktuelle Datenlage, sowie die zentralen Gesundheitsprobleme und -verhalten von Grundschulkindern analysiert. Somit liegt die Altersspanne, der in der folgenden Analyse betrachteten Kinder, zwischen 6 und 11 Jahren.
1.1 Gesundheitsbezogene Datenlage
Die gesundheitsbezogene Datenlage wird nachfolgend in die Gesundheitsprobleme und das Gesundheitsverhalten von Grundschulkindern geteilt. Auch wird analysiert inwieweit diese als Schlüsselsetting anzusehen ist.
1.1.1 Zentrale Gesundheitsprobleme von Grundschulkindern
Zur Analyse der zentralen Gesundheitsprobleme von Grundschulkindern liefert eine bundesweite Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen (KiGGS) aufschlussreiche Ergebnisse. Es lässt sich feststellen, dass bereits 15,4% der Kinder und Jugendlichen im Alter von 3-17 Jahren übergewichtig (Holling et al., 2012) und davon 6% adipös sind (Ellert, Brettschneider & Ravens-Sieberer, 2014). Wird nun nur das zu analysierende Alter von 6-11 Jahren betrachtet, so sind 6,4% der Kinder mit einer steigenden Tendenz, bereits adipös (Kurth & Schaffrath Rosario, 2007).
Zudem muss die sozioökonomische Struktur betrachtet werden. Bei Kindern aus bildungsschwächeren Familien ist das Risiko für einen mittleren bis schlechten allgemeinen Gesundheitszustand um ein 3,6-faches erhöht (Lampert, Müters, Stolzenberg & Kroll, 2014). Somit lässt sich bereits im Grundschulalter eine negative Richtung feststellen, welche sich bis ins Erwachsenenalter weiter verschärft. Häufig ist der Krankheitsverlauf im Erwachsenenalter sogar noch schwerer, wenn sich die Adipositas bereits im Kindes- oder Jugendalter entwickelt hat (Zeiher, Starker & Kuntz, 2018). Wird diese Grundkenntnis nun in den Zusammenhang mit dem im nächsten Abschnitt folgenden Gesundheitsverhalten und die mangelnde körperliche Aktivität gesetzt, so veranschaulicht dies die Dringlichkeit der Präventionsmaßnamen. Ein weiteres Gesundheitsproblem, das sich im Grundschulalter ergibt, ist der ständige Kontakt zu anderen Schülern, der das Infektionsrisiko erhöht. Die häufigsten Erkrankungen sind dabei Atemwegserkrankung, die sich zu 88,5% in Form von grippalen Infekten äußern. Davon entwickeln 3/11 sich 19,9% zu einer Bronchitis und 18,5% zu einer Mandelentzündung. Mit 46,8% sind Magen-Darm-Erkrankungen die zweit häufigsten auftretenden Gesundheitsprobleme. Teilweise können sie auch in Kombination zu den bereits beschriebenen Atemwegserkrankungen auftreten (Kamtsiuris, Atzpodien, Ellert, Schlack & Schlaud, 2007).
1.1.2 Gesundheitsverhalten von Grundschulkindern
Laut KiGGS Studie treiben rund 69,9% der Mädchen und 70,4% der Jungen im Kindergarten- und Grundschulalter Sport Dabei halten jedoch nur 25,4% der Mädchen und 34,5% der Jungen die laut WHO ausreichenden tägliche Bewegungszeit ein (Manz et al., 2014). Außerdem zeigt sich, dass der sozioökonomische Status (SES), der aus dem Haushaltsnettoeinkommen und der beruflichen Ausbildung der Eltern berechnet wird, eine entscheidende Rolle in Beug auf das Gesundheitsverhalten der Kinder spielt. In der Alterspanne von 3 bis 17 Jahren treiben 62% der Mädchen mit einem niedrigen sozialen Status Sport, wohingegen 86,5% der Mädchen mit hohem sozialen Status Sport treiben. Bei den Jungen treiben 70,4% mit niedrigem sozialem Status und 87,7% mit einem hohen sozialen Status Sport. Ein ebenso wichtiger Faktor ist die sportliche Einstellung der Eltern. Sind diese mindestens eine Stunde pro Woche sportlich aktiv, so erhöht sich die Chance der Kinder ebenfalls Sport zu treiben um das doppelte. Auch im Hinblick auf das Ernährungsverhalten der Kinder liefert die KiGGS Studie aussagekräftige Daten. Die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln ist oftmals gegeben und verleitet zu einer erhöhten Energiezufuhr in Form von übermäßiger energiedichter Nahrungsmittelaufnahme und gilt somit gerade für Kinder als weiterer Risikofaktor für Adipositas (Cecchini & Warin, 2016). Nur 17,2% der Mädchen und 15,5% der Jungen im Alter von 3-10 Jahren verzehren die empfohlene Menge von 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag. Somit lässt sich ein unmittelbarer Bezug zum Übergewicht herstellen, denn eine ausgewogene Ernährung ist für Kinder besonders essenziell, da die Aufnahme von Vitaminen, Mineralstoffen und andere sekundären Pflanzenstoffen das physische und geistige Wachstum beeinflussen und fördern. Außerdem kann die empfohlene Obst und Gemüse Aufnahme dazu beitragen, dass Übergewicht vermieden wird, da Obst und Gemüse verhältnismäßig kalorienarm sind (Robert Koch-Institut, 2008). Auch hierbei spielt der sozioökonomische Status eine große Rolle, denn Kinder aus Familien mit niedrigem sozialem Status verzehren weitaus weniger Obst und Gemüse als Kinder mit hohem Sozialstatus, da gesunde Lebensmittel weitaus teurer sind, als Fast Food
1.1.3 Grundschule geeignet als Schlüsselsetting?
In der Grundschule lassen sich folgende drei Argumente formulieren, die als Schlüsselsetting für Gesundheitsförderung anzusehen sind:
1. optimale Zugangsmöglichkeiten zu den Kindern durch erlernen erster Sozialkompetenzen
2. Ein zentraler Lebensraum mit geregeltem Tagesablauf
3. Eine hohe pädagogische Rolle in Verbindung mit einem hohen Einfluss auf die Familie und das Umfeld
Gerade im Kindergarten- und Grundschulalter entwickeln Kinder erste Sozialkompetenzen und beginnen mit dem Sozialisationsprozess der Gesundheitskompetenzen. Somit sind diese Jahre die Jahre, in denen die Kinder am empfänglichsten sind von ihren Vorbildern zu lernen und sich Dinge zu kopieren, die sie für ihr Leben erlernen und integrieren möchten. Lebt man ihnen folglich eine gesundheitsorientierte Lebensweise vor, wird diese in der Regel von den Kindern übernommen.
Zudem erlernen sie in der Grundschule das erste Mal einem geregelten Tagesablauf zu folgen und Vorgehensweisen, wie zum Beispiel gesundheitsfördernde Rituale in ihren Alltag zu integrieren. Die Schule wird somit zum zentralen Lebensraum der Kinder und hat einen großen Einfluss auf die Zukunft der Kinder.
Der Grundschule kommt durch ihre schichtübergreifende pädagogische Rolle eine große Bedeutung auf dem Gebiet der Gesundheitsförderung zu und nimmt großen Einfluss auf die Erziehung der Kinder und ergänzend wird der Zugang zu den Erziehungsberechtigten möglich und es können die Ressourcen und Potenziale für gesundheitsbewusstes Verhalten in den Familien verbessert werden (Wustmann, 2008, S. 183).
1.2 Ableitung von Handlungsansätzen
Im nächsten Schritt werden alle Daten zusammengefügt, sodass Handlungsansätze abgeleitet werden können.
1.2.1 Schaffen eines positiven Ernährungsverhaltens
Zunächst soll ein positives Ernährungsverhalten und ein entsprechendes Speisenangebot geschaffen werden. Hierbei kann sowohl eine zusätzliche Lehrveranstaltung, als auch eine Einbindung in ein bestimmtes Unterrichtsfach entwickelt werden, um den Kindern bereits im jungen Alter gewisse Grundkompetenzen, in Bezug auf Ernährung, zu vermitteln. Die evtl. vorhandene Mensa oder das Kiosk sollten ebenfalls gesunde Speisen und weniger kalorienreiche Lebensmittel anbieten, um die Versuchung zu mildern und Kindern einer niedrigen Schicht die Chance einer gesünderen Ernährung zu ermöglichen. Besonders im Kindesalter ist eine ausgewogene Ernährung für die mentale und physische Gesundheit erforderlich. Gleichzeitig führt sie zum Wachstum und stärkt das Immunsystem vor infektiösen Atemwegs- und Magen-Darm-Infekten.
1.2.2 Förderung und Aufrechterhaltung von körperlicher Aktivität
Einher geht das Ernährungsverhalten mit der Förderung und Aufrechterhaltung von körperlicher Aktivität. Problematisch ist hierbei in erster Linie die überwiegend sitzende Lehrstoffvermittlung im Klassenraum. Als Ausgleich hierzu sollten Bewegungspausen und -aufgaben in den Unterricht eingebaut werden, um bereits während des Unterrichts einer Inaktivität vorzubeugen. Mit AG-Angeboten kann jedem Kind die Möglichkeit geboten werden etwas zu finden, das dem Kind Spaß macht. So können auch außerschulische sportliche Aktivitäten gefördert werden. Hierbei sind Kooperationen mit Sportvereinen sinnvoll. Insgesamt sollte ein positives Bild von Bewegung und Sport entwickelt und eine gewisse Normalität erzeugt werden, was nur über eine kontinuierlich geplante Aktivität stattfinden kann.
1.2.3 Reduzierung des Infektionsrisikos durch positives Hygieneverhalten
Im dritten Handlungsansatz soll das Infektionsrisiko gesenkt werden, indem den Schülern ein gesundheitsbewusstes Hygieneverhalten beigebracht wird. Dies kann in Form von regelmäßigem Händewaschen und dem Desinfizieren und Lüften der Räume geschehen. Durch diese Maßnahmen wird das Infektionsrisiko, dass durch den zwischenmenschlichen Kontakt der Kinder im Klassenraum oder auf dem Pausenhof entsteht, für Atemwegsinfektionen und Magen-Darm-Erkrankungen gesenkt.
2 Schwerpunktthema für ein Projekt zur Gesundheitsförderung im Setting Schule
Die Maßnahme zur Gesundheitsförderung richtet sich an Grundschulkinder in der Altersspanne von 6-11 Jahren unabhängig von Sozialstatus und Gesundheitszustand. Im Folgenden werden Maßnahmen der Verhaltens- und Verhältnisprävention unter einem übergeordneten Interventionsziel und den daraus entstandenen Teilzielen und Inhalten veranschaulicht.
Tab. 1: Analyse des Schwerpunktthemas: Projekt zur bedarfsgerechten und gesunden Ernährung für Grundschulkinder (eigene Darstellung)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Grundschule ein wichtiges Setting für Gesundheitsförderung?
Die Grundschule erreicht Kinder in einer prägenden Phase (6-11 Jahre), bietet einen geregelten Tagesablauf und ermöglicht den Zugang zu allen sozialen Schichten, um frühzeitig Gesundheitskompetenzen zu vermitteln.
Welche Gesundheitsprobleme sind bei Grundschulkindern besonders verbreitet?
Laut KiGGS-Studie sind Übergewicht (15,4 % bei 3-17-Jährigen) und Adipositas sowie häufige Infektionskrankheiten (Atemwegs- und Magen-Darm-Erkrankungen) zentrale Probleme.
Wie beeinflusst der sozioökonomische Status (SES) die Gesundheit von Kindern?
Kinder aus bildungsschwächeren Familien haben ein deutlich höheres Risiko für einen schlechten Gesundheitszustand und leiden häufiger unter Bewegungsmangel und ungesunder Ernährung.
Welche Handlungsansätze gibt es zur Bewegungsförderung in der Schule?
Empfohlen werden Bewegungspausen im Unterricht, sportliche AG-Angebote und Kooperationen mit Sportvereinen, um der überwiegend sitzenden Tätigkeit entgegenzuwirken.
Wie kann das Infektionsrisiko in der Schule gesenkt werden?
Durch die Vermittlung von positivem Hygieneverhalten, wie regelmäßigem Händewaschen, sowie durch regelmäßiges Lüften und Desinfizieren der Räume.
- Arbeit zitieren
- Jaqueline Schmehl (Autor:in), 2021, Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1189544