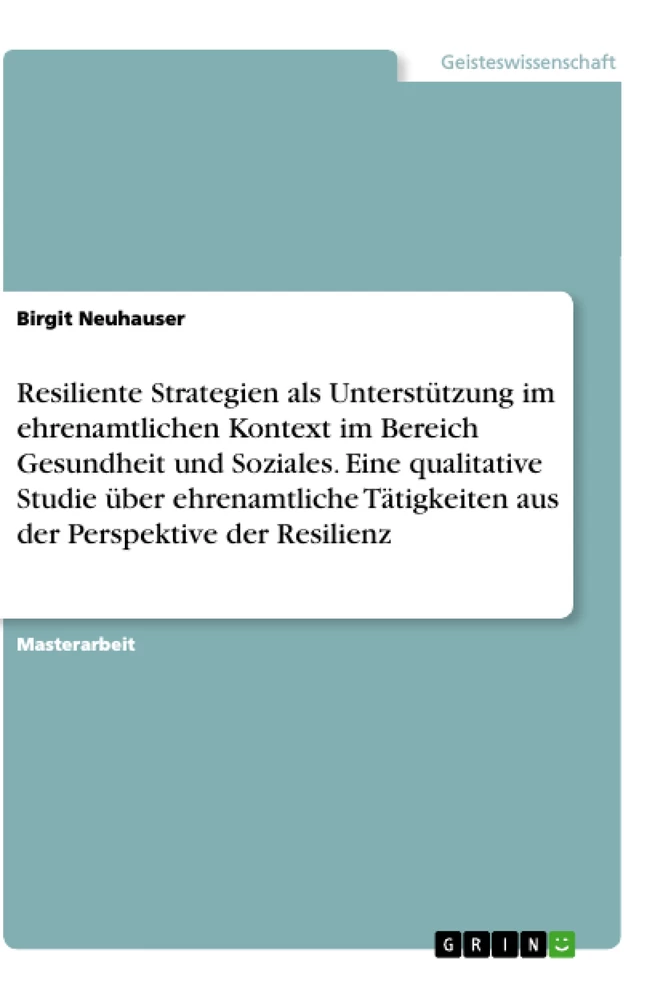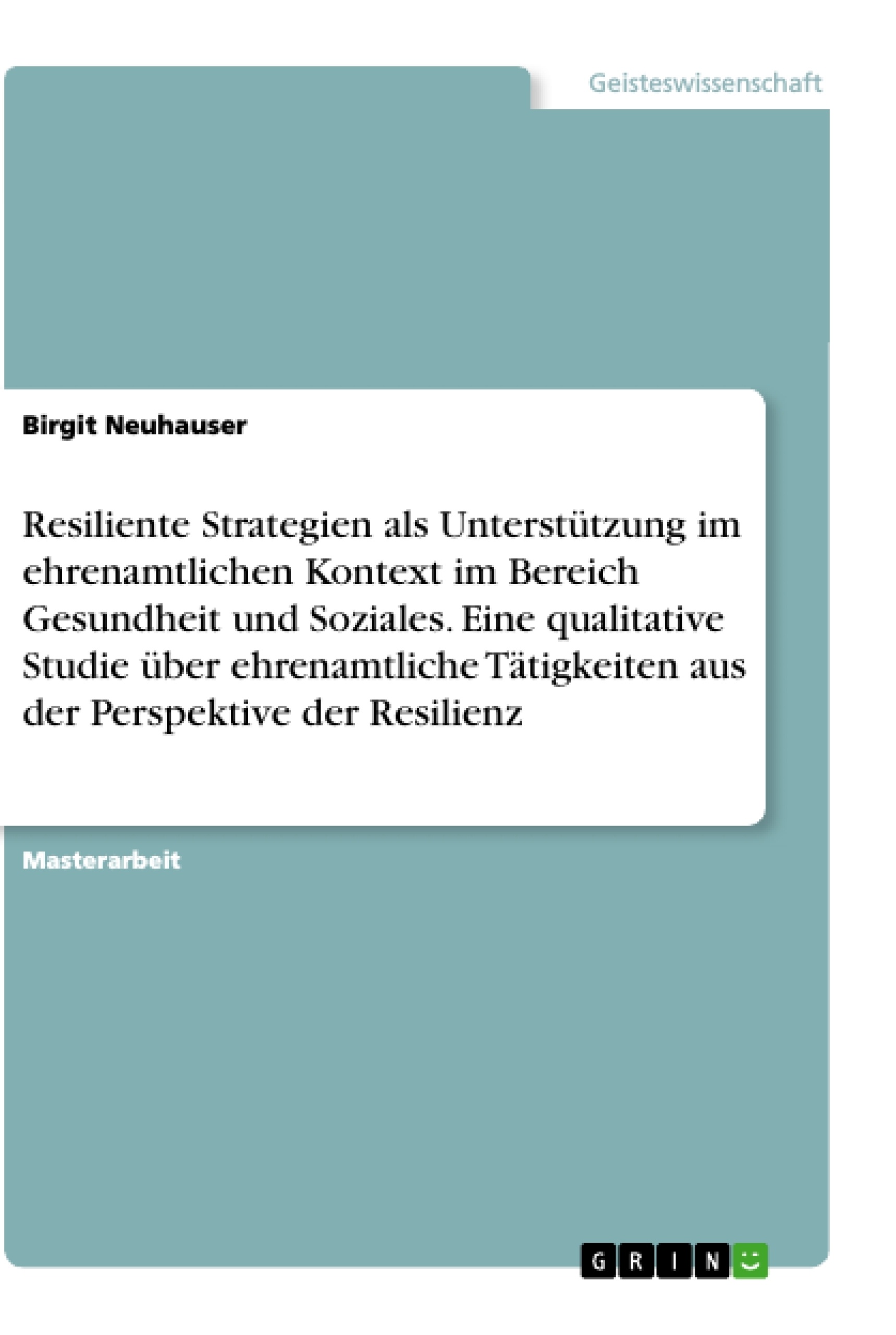Die Studie befasst sich mit der Bedeutung und dem Stellenwert von "Resilienz" bei ehrenamtlich Tätigen. Hauptsächliches Ziel ist es, darzustellen, welche Wirkungen die Erfahrungen im "Ehrenamt" auf die Entwicklung der individuellen Resilienz haben und umgekehrt, ob sich die Resilienzdisposition auf das Engagement im Ehrenamt auswirkt.
Dazu wurde mittels Daten, Studien und dem aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstand auf Ehrenamt, Motivation und Resilienz eingegangen. Der empirische Teil beschreibt die qualitative Erhebung, bei der elf ehrenamtlich Tätige mittels eines teilstrukturierten Interviews befragt wurden. Im Zuge der Befragung erfolgte zeitgleich ein valider Test über den jeweiligen Resilienzfaktor.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Forschungsfragen
- Zielsetzung und Erkenntnisgewinn
- Vorgehensweise
- Systemabgrenzung
- Sachliche, räumliche und zeitliche Abgrenzung
- Ehrenamtlichkeit
- Begriffsvielfalt von Ehrenamt und dessen Bereiche
- Freiwilliges Engagement in Österreich - Erhebungsdaten 2012
- Beteiligungsquoten an der Freiwilligenarbeit in Österreich
- Beteiligungsquote nach Alter
- Freiwilliges Engagement in der Steiermark - Studie aus 2011
- Welche Motivationen haben Menschen zu helfen?
- Motivation und Motivationstheorien
- Self-determination Theorie (SDT)
- Motivationstypen
- Motive und Herausforderungen für ehrenamtliches Arbeiten
- Volunteers Function Inventory (VFI)
- Gründe und Motive für die Freiwilligenarbeit in der Steiermark
- Herausforderungen beim Ehrenamt
- Resilienz
- Salutogenese
- Resilienz - Begriffserklärung und Definition
- Resilienzfaktoren - die sieben Säulen
- Die drei Grundhaltungen
- Optimismus
- Akzeptanz
- Lösungsorientierung
- Die vier Fähigkeiten
- Selbstregulation
- Verantwortung übernehmen
- Beziehungen gestalten
- Zukunft gestalten
- Das Zusammenspiel der Merkmale und die Balance zwischen den Resilienzfaktoren
- Aktueller Stand der Resilienzforschung
- Empirische Untersuchung
- Forschungsfragen
- Methoden der Datenerhebung
- Triangulation
- Leitfaden-Interview (teilstrukturiertes Interview)
- Fragebogen RS-13
- Sampling
- Setting
- Auswahl der InterviewpartnerInnen
- Interview-Organisation und Durchführung
- Vorüberlegungen
- Pretests/Anpassung des Leitfaden-Interviews
- Methoden der Datenauswertung
- Aufbereitung des Datenmaterials
- Qualitative Inhaltsanalyse
- Beschreibung der Vorgehensweise
- Interviewbereitschaft der Probanden
- Darstellung und Ergebnisse der Untersuchung
- Darstellung der Interviews
- Tätigkeiten/Ausbildungen der InterviewpartnerInnen
- Dauer der ehrenamtlichen Tätigkeit im Vergleich zum Alter der InterviewpartnerInnen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Bedeutung von Resilienz im ehrenamtlichen Kontext. Sie zielt darauf ab, die Wechselwirkungen zwischen Erfahrungen im Ehrenamt und der Entwicklung der individuellen Resilienz zu untersuchen. Dabei wird untersucht, wie sich das Ehrenamt auf die Resilienz auswirkt und umgekehrt, wie sich die Resilienzdisposition auf das Engagement im Ehrenamt auswirkt.
- Ehrenamtliches Engagement und seine Bedeutung im Bereich Gesundheit & Soziales
- Resilienz und ihre Relevanz für die Bewältigung von Herausforderungen im Ehrenamt
- Motivationen und Motive für ehrenamtliches Arbeiten
- Der Einfluss von Resilienz auf die Motivation und das Engagement im Ehrenamt
- Qualitative Analyse von Erfahrungen ehrenamtlich Tätiger im Hinblick auf Resilienzfaktoren
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problemstellung und die Forschungsfragen der Arbeit dar. Sie definiert den Forschungsgegenstand und die Zielsetzung, wobei die Bedeutung von Resilienz im ehrenamtlichen Kontext hervorgehoben wird.
- Ehrenamtlichkeit: Dieses Kapitel behandelt die Begriffsvielfalt und Bereiche des Ehrenamts. Es beleuchtet die Bedeutung des Engagements in Österreich und der Steiermark anhand relevanter Statistiken.
- Welche Motivationen haben Menschen zu helfen?: Dieses Kapitel befasst sich mit Motivationstheorien und insbesondere der Self-determination Theorie (SDT). Es untersucht verschiedene Motivationstypen und die Bedeutung intrinsischer und extrinsischer Motivation im Kontext des Ehrenamts.
- Motive und Herausforderungen für ehrenamtliches Arbeiten: Das Kapitel analysiert Motive und Herausforderungen im Ehrenamt. Es beleuchtet die Bedeutung des Volunteers Function Inventory (VFI) sowie die Gründe und Motive für die Freiwilligenarbeit in der Steiermark.
- Resilienz: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Resilienz und untersucht die sieben Säulen der Resilienz. Es beschreibt die drei Grundhaltungen (Optimismus, Akzeptanz, Lösungsorientierung) sowie die vier Fähigkeiten (Selbstregulation, Verantwortung übernehmen, Beziehungen gestalten, Zukunft gestalten).
- Empirische Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die Methoden der Datenerhebung, insbesondere die Anwendung von Leitfaden-Interviews und dem Fragebogen RS-13. Es erklärt die Auswahl der InterviewpartnerInnen, die Interview-Organisation und Durchführung sowie die Methoden der Datenauswertung.
Schlüsselwörter
Die Masterarbeit beschäftigt sich mit den Themen Ehrenamtlichkeit, Resilienz, Motivation und qualitative Forschung im Kontext von Gesundheit & Soziales. Wichtige Konzepte sind die Self-determination Theorie (SDT), das Volunteers Function Inventory (VFI) sowie die sieben Säulen der Resilienz. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen von Erfahrungen im Ehrenamt auf die Entwicklung der individuellen Resilienz und umgekehrt.
- Quote paper
- Birgit Neuhauser (Author), 2019, Resiliente Strategien als Unterstützung im ehrenamtlichen Kontext im Bereich Gesundheit und Soziales. Eine qualitative Studie über ehrenamtliche Tätigkeiten aus der Perspektive der Resilienz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1189564