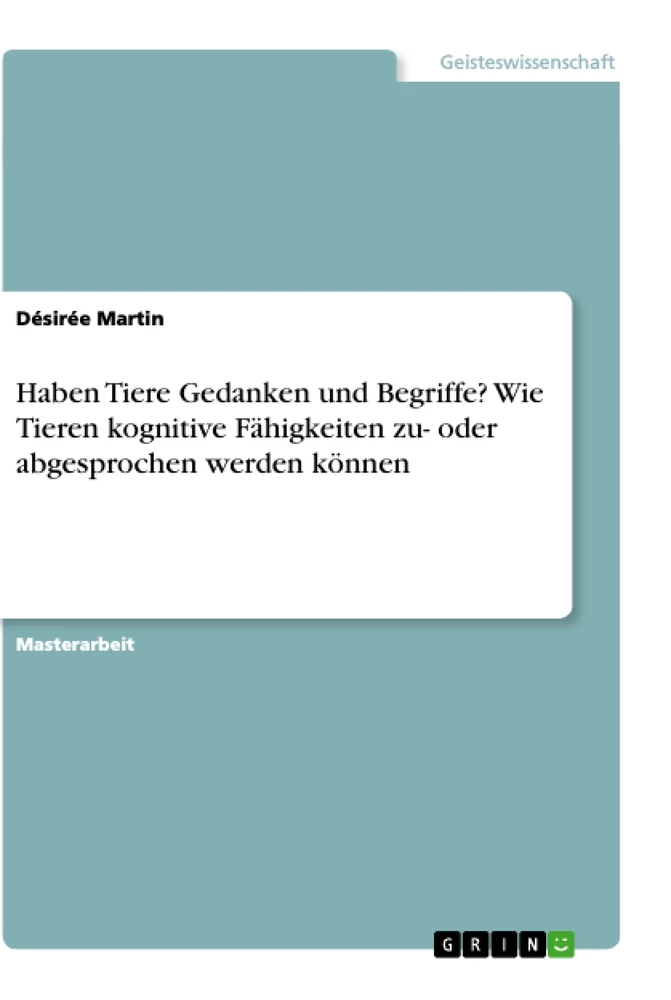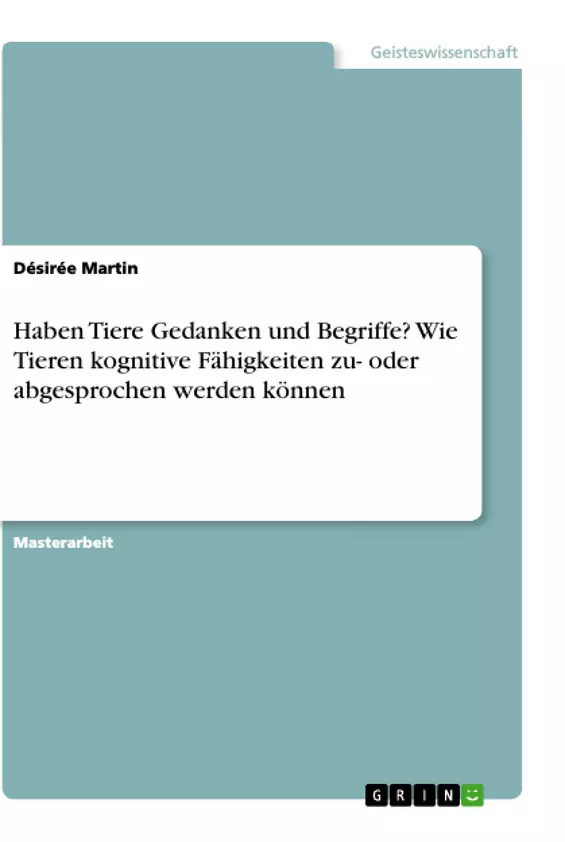Was ist der Mensch? Was macht Menschsein aus? Das sind gewiss sehr alte Fragen. Dass sie immer noch gestellt werden, liegt daran, dass sie notorisch schwer zu beantworten sind. Gesucht wird nicht nur eine Antwort in eigener Sache, auch die Maßstäbe für Frage und Antwort müssen erst noch gefunden werden. Nicht viel anders ist es mit der Frage, was Tiere sind. Auch eine Antwort darauf hängt davon ab, ob wir uns als ähnlich begreifen oder uns abgrenzen, ob wir Unterschiede betonen oder Gemeinsames.
In der Philosophie beschäftigt sich bereits im antiken Griechenland Aristoteles mit der Stellung von Menschen und Tieren in der Natur. Für Menschen hebt er ein einzigartiges Vermögen der Vernunft hervor. Der Verstand als kategorialer Unterschied zwischen Tier und Mensch ist seither im Fokus der Debatte um die Fähigkeiten der Tiere.
Eine Aufgabe der theoretischen Philosophie besteht dabei darin, zu klären, ob und unter welchen Umständen kognitive Zuschreibungen an Tiere erlaubt sind. Wie kann eine solche Aufgabe gelöst werden? Ein Problem dabei ist das Fremdpsychische. Kurz: es fehlt die Möglichkeit, aus beobachtetem Verhalten von Tieren direkt kognitive bzw. geistige Fähigkeiten abzuleiten und zuzuschreiben.
Um Verhaltensweisen von Tieren überhaupt deutbar zu machen, brauchen wir einen Zugang, der es erlaubt, Verhalten so zu interpretieren, dass die Ergebnisse nicht nur unsere Kognitionen spiegeln. Diesen Zugang zu finden wird die erste Aufgabe sein.
In der Tier-Mensch-Debatte tauchen immer wieder die gleichen Begriffe wie KOGNITION, REPRÄSENTATION, VORSTELLUNG, ÜBERZEUGUNG, HANDELN, INTENTIONALITÄT, RATIONALITÄT und SPRACHE auf. Wenn wir diese verstehen und deutlich unterscheiden können, können wir womöglich auch die Bedingungen für Tierkognitionen erhellen. Eine zweite Aufgabe wird deshalb darin bestehen, ein begrifflich geeignetes Instrumentarium dafür zu entwickeln, beobachtetes Verhalten von Tieren zu erklären.
Auch die Entscheidung, um welche Tiere es gehen soll, ist beim Versuch einer Verhaltensinterpretation von Bedeutung. Da viele unterschiedliche Tiergattungen und -arten viele verschiedene Merkmale tragen und Fähigkeiten besitzen, sind einige besser für eine Verhaltensinterpretation geeignet als andere. In dieser Arbeit beziehe ich mich vor allem auf die Forschung an Primaten, bei denen hoch entwickelte Fähigkeiten nachgewiesen werden konnten, exemplarisch werde ich aber auch Experimente mit Vögeln und Beobachtungen an Hunden berücksichtigen.
Inhaltsverzeichnis
- Tiere und Menschen in der Philosophiegeschichte: Gemeinsames, Trennendes und die Frage nach dem Geist
- Vorgehen und Ziele der Arbeit
- Im Kontext von Differenzialismus und Assimilationismus
- Methodische Überlegungen und Entscheidungen – auf der Suche nach der besten Erklärung
- Repräsentationen, Vorstellungen und Einführung in Intentionalität
- Intentionalität: Überzeugungen
- Intentionalität: Überzeugungen und Handlungen
- Haben Tiere Gedanken?
- Der Begriff des Denkens
- Ein Stufenmodell kognitiver Fähigkeiten
- Zuschreibungen, Beobachtungen, Experimente I: Rabenvögel
- Zuschreibungen, Beobachtungen, Experimente II: Primaten
- Haben Tiere Begriffe?
- Sind Begriffe als mentale Repräsentationen, als abstrakte Gegenstände oder als Fähigkeiten zu verstehen?
- Begriffe als Fähigkeiten: Glocks Version
- Begriffe oder Unicepte?
- Fazit: Haben Tiere Gedanken und Begriffe?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Tiere Gedanken und Begriffe haben. Sie untersucht verschiedene philosophische Positionen und wissenschaftliche Ansätze, die sich mit der Zuschreibung kognitiver Fähigkeiten an Tiere auseinandersetzen. Dabei werden die Grenzen zwischen Mensch und Tier beleuchtet und die methodischen Herausforderungen der Erforschung tierischer Kognition beleuchtet.
- Untersuchung des historischen Diskurses über Mensch und Tier in der Philosophie
- Analyse der Positionen des Differenzialismus und Assimilationismus
- Diskussion der Rolle von Intentionalität, Repräsentationen und Überzeugungen bei Tieren
- Erforschung der Frage, ob Tiere Gedanken und Begriffe haben können
- Bewertung verschiedener Methoden und Ansätze zur Erforschung kognitiver Fähigkeiten bei Tieren
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel setzt sich mit der philosophischen Debatte über Mensch und Tier auseinander und stellt die historischen Positionen von Aristoteles, Descartes und Montaigne dar. Es werden die zentralen Argumente für die Annahme oder Verneinung eines kategorialen Unterschieds zwischen Mensch und Tier vorgestellt. Das zweite Kapitel erläutert das Vorgehen und die Ziele der Arbeit. Es werden die methodischen Herausforderungen der Erforschung tierischer Kognition sowie die Relevanz der Begriffe Intentionalität, Repräsentation, Überzeugung, Handeln, Rationalität und Sprache für die Analyse tierischen Verhaltens betont. Die Kapitel drei und vier widmen sich den Begriffen Repräsentation, Vorstellung, Intentionalität und Überzeugung. Dabei wird die Frage untersucht, inwiefern diese Begriffe auf Tiere angewendet werden können und wie sich die Überzeugungen von Tieren von denen von Menschen unterscheiden.
Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, ob Tiere Gedanken haben. Es werden verschiedene Ansätze zur Analyse tierischen Verhaltens und die Rolle von Experimenten bei der Erforschung tierischer Kognition beleuchtet. Im sechsten Kapitel wird die Frage nach der Existenz von Begriffen bei Tieren behandelt. Dabei werden verschiedene Definitionen von Begriffen diskutiert und die Theorie von Glock zu Begriffen als Fähigkeiten vorgestellt. Das siebte Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und bietet eine Antwort auf die Frage, ob Tiere Gedanken und Begriffe haben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen KOGNITION, REPRÄSENTATION, VORSTELLUNG, ÜBERZEUGUNG, HANDELN, INTENTIONALITÄT, RATIONALITÄT und SPRACHE im Kontext der Frage, ob Tieren Gedanken und Begriffe zugeschrieben werden können. Die Analyse untersucht verschiedene philosophische und wissenschaftliche Positionen und setzt sich mit der methodischen Herausforderung der Erforschung tierischer Kognition auseinander. Die Arbeit betrachtet sowohl historische Ansätze als auch aktuelle Forschungsergebnisse und analysiert die Grenzen zwischen Mensch und Tier in Bezug auf kognitive Fähigkeiten.
Häufig gestellte Fragen
Haben Tiere Gedanken im philosophischen Sinne?
Die Arbeit untersucht, ob kognitive Zuschreibungen wie Gedanken erlaubt sind, wobei das Problem des "Fremdpsychischen" die direkte Ableitung erschwert.
Was unterscheidet Assimilationismus von Differenzialismus?
Assimilationismus betont die Ähnlichkeit zwischen Mensch und Tier, während der Differenzialismus kategoriale Unterschiede (wie Vernunft oder Sprache) hervorhebt.
Können Tiere Begriffe besitzen?
Nach Philosophen wie Glock können Begriffe als Fähigkeiten verstanden werden; die Arbeit diskutiert, ob Tiere über solche mentalen Repräsentationen verfügen.
Welche Rolle spielt Intentionalität bei Tieren?
Intentionalität bezieht sich auf die Gerichtetheit von Überzeugungen und Handlungen; es wird geprüft, ob Tiere zielgerichtet und rational handeln.
Welche Tierarten werden in der Kognitionsforschung oft herangezogen?
Primaten stehen im Fokus, aber auch Experimente mit Rabenvögeln und Beobachtungen an Hunden liefern wichtige Hinweise auf hoch entwickelte kognitive Fähigkeiten.
- Arbeit zitieren
- Désirée Martin (Autor:in), 2022, Haben Tiere Gedanken und Begriffe? Wie Tieren kognitive Fähigkeiten zu- oder abgesprochen werden können, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1189758