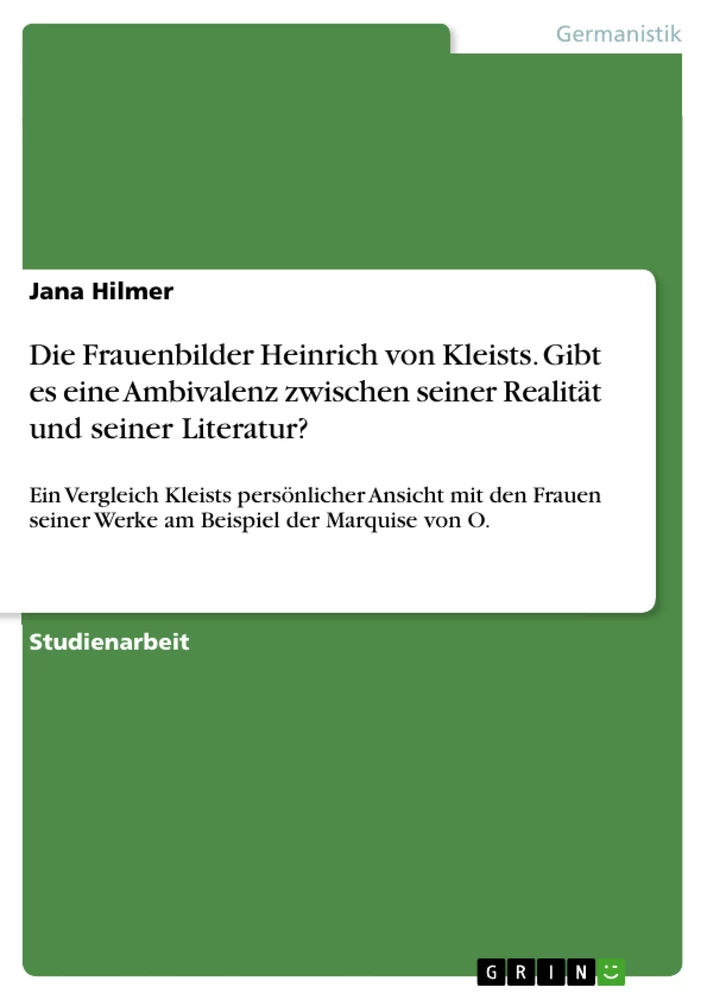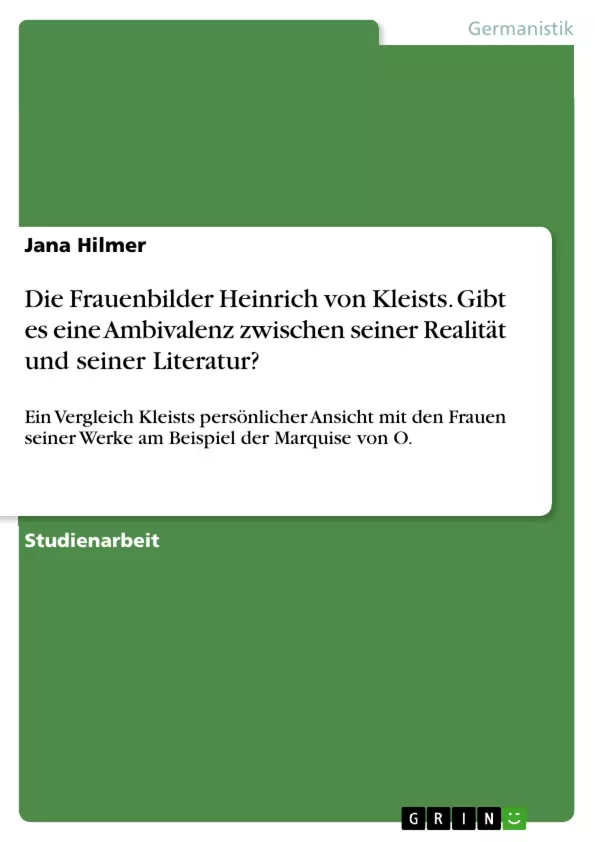Diese studentische Hausarbeit wurde mit 1,0 bewertet und befasst sich mit Heinrich von Kleists Novelle "Die Marquise von O." und dem darin suggerierten Frauenbild. Dieses wird in ein Verhältnis gesetzt mit den Ansichten von Kleist und seinen Zeitgenossen um 1800, wie etwa Rousseau. Die Figur der Marquise wird anhand der drei weiblichen Rollen, die sie in der Novelle einnimmt, charakterisiert. Außerdem werden ihr Verhalten, ihre Körpersprache und ihre Wortwahl analysiert. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden mit dem Frauenideal von Kleist und seinen Zeitgenossen vergleichen. Die Arbeit enthält ein vollständiges und umfangreiches Quellenverzeichnis.
Das Thema Frauenbilder und Emanzipation beschäftigt mich persönlich schon lange. So war ich in unserem Kleist-Seminar überaus fasziniert von der Darstellung der weiblichen Protagonistinnen und deren Einordnung in die fiktive Gesellschaft und die zwischenmenschlichen Beziehungen in Heinrich von Kleists Werken. Bei der weiteren Recherche für diese Arbeit erstaunte mich, dass Kleist vor allem tapfere und starke Frauencharaktere geschaffen hatte, da er selbst, wie man etwa an seinen Briefen an seine Verlobte Wilhelmine von Zenge festmachen kann, in der realen Welt eine eher zeittypische, chauvinistische Einstellung zu dem Thema hatte. Käthchen "Feuerprobe", der Sieg Penthesileas über Achilles oder die tödlich endende Mission Lisbeths beim Kurfürsten im Kohlhaas konterkarieren das traditionelle Rollenverständnis der damaligen Zeit.
Inwiefern Kleist das Verhältnis der Geschlechter in seinen Werken verändert, möchte ich in dieser Arbeit vor allem unter Zuhilfenahme der Novelle Die Marquise von O. klären. Entspricht die Protagonistin dieses Werkes der damaligen Rollenzuweisung und der gesellschaftlich manifestierten Erwartungen?
Um diese Frage zu klären, werde ich zunächst auf das Frauenbild um 1800 und auf Heinrich von Kleists persönliches Frauenideal eingehen. Anschließend werde ich die charakteristischen Figurenmerkmale der Marquise von O. herausarbeiten und damit in ein Verhältnis setzen, so-dass ich anhand dessen hoffentlich meine Forschungsfrage "Die Frauenbilder Kleists – gibt es eine Ambivalenz zwischen seiner Realität und seiner Literatur?" beantworten kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Frauenbild um 1800
- Das Frauenbild Kleists
- Die Marquise von O...
- Tochter durch Zufall, Ehefrau aus Kalkül, Witwe durch Tragik?
- Charakteristische Figurenmerkmale
- Körpersprache und Wortwahl
- Fazit und Beantwortung der Forschungsfrage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Frauenbild Heinrich von Kleists im Kontext des 19. Jahrhunderts und erforscht die Ambivalenz zwischen Kleists persönlicher Ansicht und der Darstellung von Frauen in seinen literarischen Werken. Die Arbeit fokussiert auf die Novelle „Die Marquise von O.“ und analysiert die Protagonistin im Hinblick auf ihre Einordnung in die damalige Rollenzuweisung und die gesellschaftlichen Erwartungen.
- Das Frauenbild um 1800 und seine philosophischen Wurzeln
- Die Darstellung von Frauen in Kleists Werken im Vergleich zu seiner persönlichen Ansicht
- Die Analyse der Figur der Marquise von O. im Hinblick auf ihre Rolle in der Gesellschaft
- Die Ambivalenz zwischen Realität und Literatur in Kleists Frauenbildern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Kontext der Arbeit vor, indem sie die Faszination des Autors für die Darstellung von Frauen in Kleists Werken und die scheinbare Diskrepanz zwischen seinen persönlichen Ansichten und den Frauenfiguren seiner Werke beleuchtet. Kapitel 2 behandelt das Frauenbild um 1800, das stark von Rousseau geprägt war. Es wird dargestellt, wie Frauen in der Gesellschaft und der Familie als dem Mann untergeordnet angesehen wurden. Kapitel 2.1 beleuchtet Kleists persönliches Frauenbild, das sich im Widerspruch zu den traditionellen Ansichten seiner Zeit befindet. Es zeigt, dass Kleist die Bildung der Frau als essentiell für ihre selbstbestimmte Lebensführung sah, obwohl er auch seine eigene, patriarchalische Sichtweise auf die Geschlechterrollen nicht verschwieg.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind das Frauenbild, Emanzipation, Ambivalenz, Heinrich von Kleist, Marquise von O., Rollenzuweisung, gesellschaftliche Erwartungen, Literatur und Realität.
Häufig gestellte Fragen
Welches Frauenbild wird in der Novelle "Die Marquise von O." vermittelt?
Die Marquise wird als Figur analysiert, die zwischen den Rollen der Tochter, Ehefrau und Witwe steht und dabei oft Stärke zeigt, die dem zeitgenössischen Ideal widerspricht.
Gibt es einen Widerspruch zwischen Kleists Privatleben und seiner Literatur?
Ja, während Kleist in Briefen oft chauvinistische Ansichten vertrat, schuf er in seinen Werken auffallend tapfere und starke Frauencharaktere.
Wie sah das allgemeine Frauenbild um 1800 aus?
Es war stark von Denkern wie Rousseau geprägt, die Frauen primär in einer dem Mann untergeordneten, häuslichen Rolle sahen.
Was analysiert die Arbeit bezüglich der Körpersprache der Marquise?
Die Untersuchung beleuchtet, wie Kleist durch nonverbale Kommunikation und Wortwahl die innere Verfassung und den Widerstand seiner Protagonistin ausdrückt.
Welche Rolle spielt die Emanzipation in Kleists Werken?
Kleist konterkariert oft traditionelle Rollenmuster, indem er Frauen in Situationen zeigt, in denen sie aktiv handeln und gesellschaftliche Erwartungen herausfordern.
- Arbeit zitieren
- Jana Hilmer (Autor:in), 2021, Die Frauenbilder Heinrich von Kleists. Gibt es eine Ambivalenz zwischen seiner Realität und seiner Literatur?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1190026