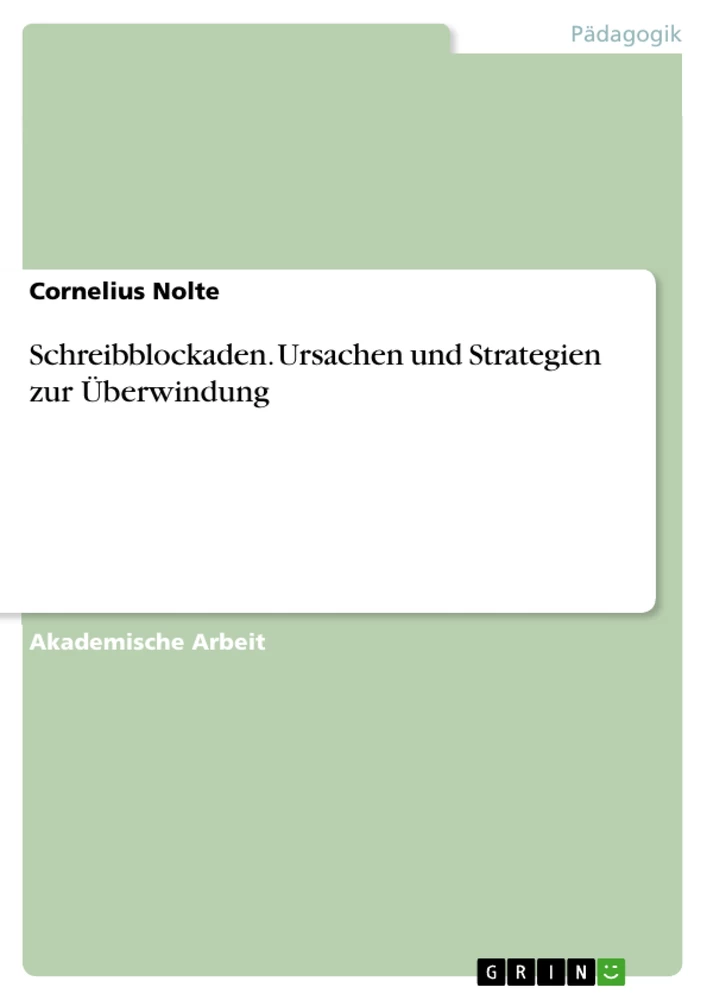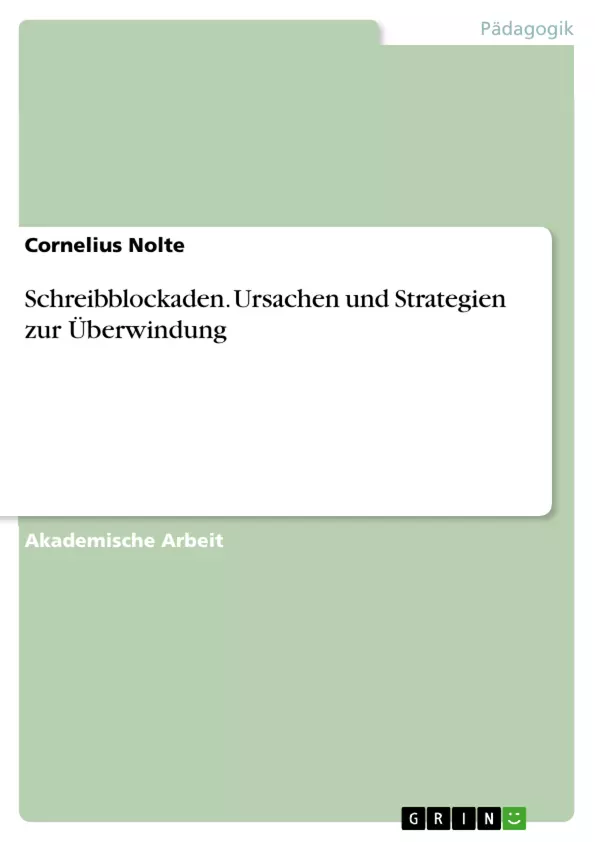Ziel dieser Arbeit ist das Nennen und Beschreiben der wichtigsten Erscheinungsformen und möglicher Ursachen einer Schreibblockade sowie das Aufzeigen von Möglichkeiten, wie Schreibblockaden überwunden werden können.
Es kommt so gut wie in jeder Arbeit die Zeit, in der der Schreibfluss ins Stocken gerät oder ganz zum Stillstand kommt. Dieser Vorgang ist zunächst nicht ungewöhnlich und wird gar als notwendiger Schritt im Schreibprozess angesehen, da dieser oft dem für die Arbeit notwendigen Nachdenken geschuldet ist. Das Phänomen der „schwangeren Pausen“ bezeichnet in diesem Zusammenhang Gedanken, die im Autor heranwachsen, um in den nächsten Sätzen verwendet zu werden. Kann der Autor seine Arbeit allerdings auch nach einer längeren Phase nicht beginnen oder fortsetzen oder wird der Schreibfluss wiederholt durch Unterbrechungen gestoppt, so liegt der Verdacht auf eine Schreibblockade nahe. Diese kann jederzeit im Schreibprozess eintreten und ist nicht nur bei ungeübten Schreibern zu beobachten, sondern auch bei professionellen Autoren. Folglich können Blockaden dieser Art beim Schreiben eines Buches, einer Doktorarbeit oder aber auch eines vergleichsweise simpel erscheinenden Briefes auftreten. Die Erscheinungsformen der Schreibblockade variieren dabei genauso wie deren Ursprünge von Autor zu Autor. Letztere müssen Schreibblockaden jedoch nicht hilflos gegenüberstehen, können diese doch mit den richtigen Ansätzen wieder gelöst oder bereits vor Auftreten proaktiv vermieden werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ziel dieser Arbeit
- Aufbau dieser Arbeit
- Grundlagen
- Definition der Schreibblockade
- Erscheinungsformen von Schreibblockaden
- Hauptteil
- Ursachen für Schreibblockaden
- Strategien zur Überwindung von Schreibblockaden
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Schreibblockade. Sie erklärt die verschiedenen Erscheinungsformen und möglichen Ursachen dieser Blockade und bietet Lösungsansätze zur Überwindung.
- Definition und Erscheinungsformen der Schreibblockade
- Ursachen für Schreibblockaden, z. B. emotionale oder motivationale Faktoren, äußere Einflüsse, mangelnde Vorbereitung
- Strategien zur Überwindung von Schreibblockaden, wie z. B. Kreativitätstechniken, Entspannungstechniken, Planung und Strukturierung
- Das Abrufen und Anwenden von Schreibkompetenzen
- Die Rolle von Prokrastination und Angst bei Schreibblockaden
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Schreibblockade ein und beschreibt die Situation, in der der Schreibfluss stockt oder zum Stillstand kommt. Sie erläutert, dass Schreibblockaden ein häufiges Phänomen sind, das in allen Phasen des Schreibprozesses auftreten kann und sowohl bei ungeübten Schreibern als auch bei professionellen Autoren beobachtet werden kann. Das Ziel der Arbeit ist es, die wichtigsten Erscheinungsformen und Ursachen einer Schreibblockade zu beschreiben sowie Lösungsansätze aufzuzeigen.
Grundlagen
In diesem Kapitel wird der Begriff „Schreibblockade“ definiert und die wichtigsten Erscheinungsformen vorgestellt. Charakteristisch für Schreibblockaden sind ein Mangel an brauchbaren Ideen und die Suche nach Gründen für die Blockade. Der blockierte Schreiber fühlt sich unwohl, ratlos und hilflos und hat den Eindruck, nicht mehr schreiben zu können. Es werden verschiedene Aspekte beleuchtet, wie z. B. die Bedeutung von Schreibkompetenzen, die Rolle von äußeren Anforderungen und die zeitliche Einordnung von Blockaden im Schreibprozess.
Hauptteil
Ursachen für Schreibblockaden
Dieser Abschnitt befasst sich mit den Ursachen von Schreibblockaden. Es werden verschiedene Faktoren beleuchtet, die zu Blockaden führen können, z. B. emotionale und motivationale Faktoren, äußere Einflüsse, mangelnde Vorbereitung, Angst vor Misserfolg, Perfektionismus und Prokrastination.
Strategien zur Überwindung von Schreibblockaden
Dieser Abschnitt stellt verschiedene Strategien zur Überwindung von Schreibblockaden vor. Es werden sowohl kreative Techniken als auch Entspannungstechniken, Zeitmanagementmethoden und Planungstechniken beschrieben. Darüber hinaus werden die Bedeutung von Schreibkompetenzen, die Rolle von Feedback und die Wichtigkeit der positiven Selbstmotivation hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Schreibblockade, Schreibprozess, Schreibkompetenzen, Ursachen, Strategien, Überwindung, Erscheinungsformen, Prokrastination, Angst, Perfektionismus, Kreativität, Entspannung, Planung, Struktur, Motivation, Selbstmotivation, Feedback.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Schreibblockade und wie äußert sie sich?
Eine Schreibblockade ist ein Stillstand im Schreibprozess, bei dem der Autor trotz Bemühens keine Sätze formulieren kann. Sie äußert sich oft durch Ratlosigkeit, Angst und Prokrastination.
Sind Schreibblockaden ein normales Phänomen?
Ja, kurze Unterbrechungen (sog. "schwangere Pausen") sind Teil des Denkprozesses. Problematisch wird es erst, wenn die Arbeit über längere Zeit nicht fortgesetzt werden kann.
Was sind die häufigsten Ursachen für Schreibblockaden?
Ursachen können Perfektionismus, Angst vor Misserfolg, mangelnde Vorbereitung, emotionale Faktoren oder auch zu hohe äußere Erwartungen sein.
Welche Strategien helfen bei der Überwindung von Blockaden?
Hilfreich sind Kreativitätstechniken (z.B. Freewriting), Entspannungsübungen, klare Zeitplanung, das Einholen von Feedback und die Reduzierung von Perfektionismus.
Können auch professionelle Autoren von Blockaden betroffen sein?
Ja, Schreibblockaden treten unabhängig von der Erfahrung auf – sie können beim Schreiben von Briefen ebenso vorkommen wie bei Dissertationen oder Romanen.
- Quote paper
- Cornelius Nolte (Author), 2019, Schreibblockaden. Ursachen und Strategien zur Überwindung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1190116