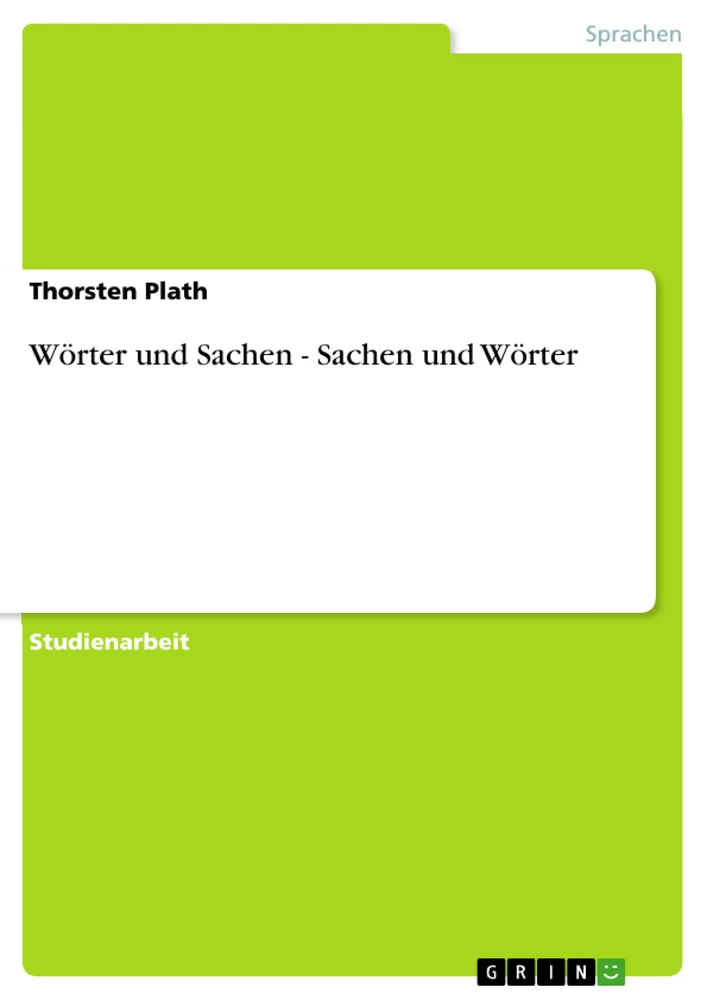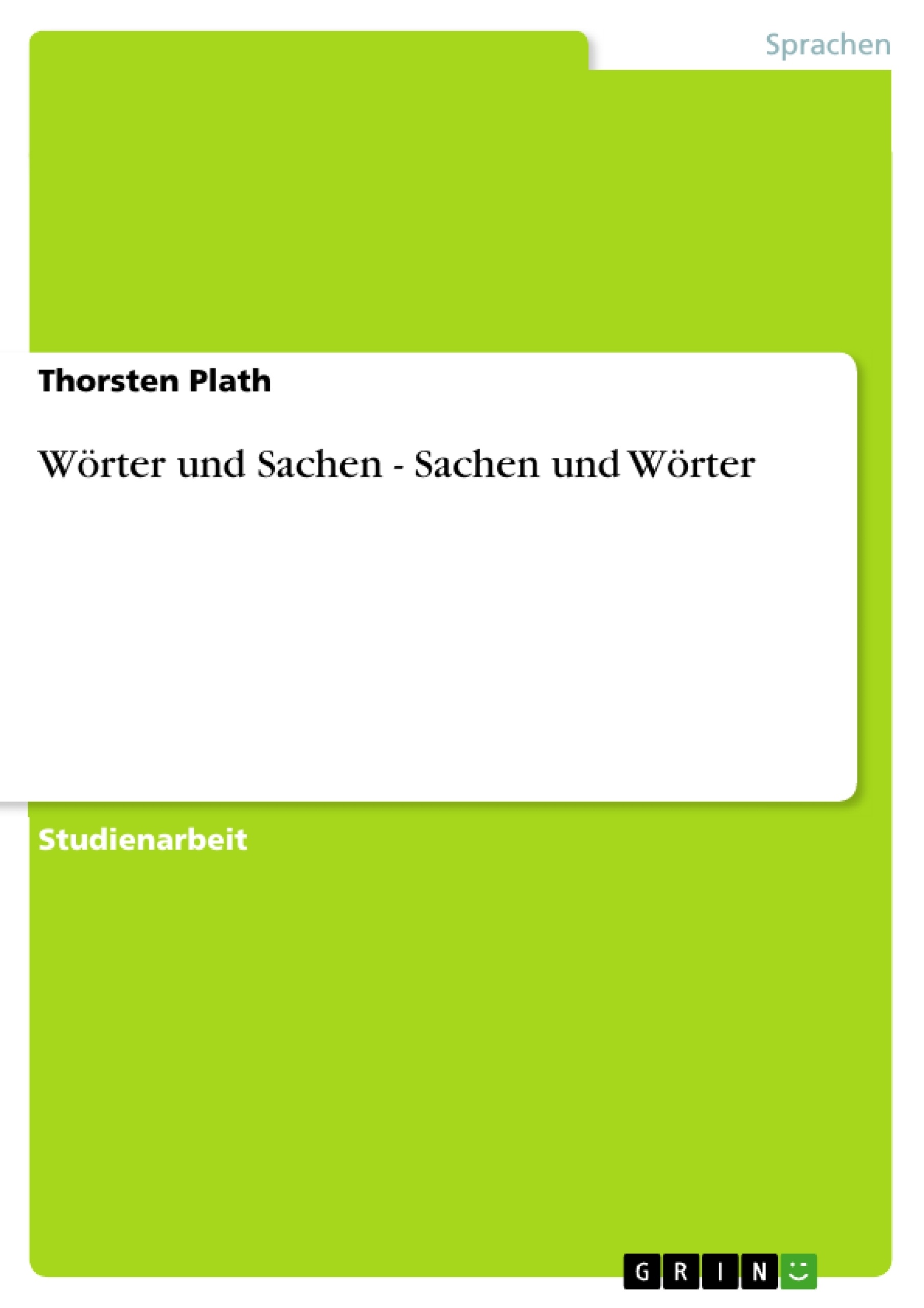Die Forschungsrichtung `Wörter und Sachen´ hat nicht nur die Geschichte der romanischen, sondern auch vielerlei anderer Sprachwissenschaften geprägt, bis zum heutigen Zeitpunkt. So wird sie gern bis auf Jacob Grimms Aussage aus dem Jahre 1848 zurückgeführt: „Sprachforschung, der ich anhänge und von der ich ausgehe, hat mich noch nie in der weise befriedigen können, daß ich nicht immer gern von den wörtern zu den sachen gelangt wäre“ (Grimm 1848, XI). Wirklichen Einfluss auf die wissenschaftliche Diskussion aber begann die Forschungsrichtung letztendlich mit den Arbeiten des Indogermanisten Rudolf Meringer zu entfalten, der sich, ausgehend von der Hausforschung, ungefähr seit 1891 der Sachforschung zuwendete, wobei er sich explizit in der Tradition Jacob Grimms sah (Hüttenbach 1977, 77f.). Sein romanistischer Kollege in Graz, Hugo Schuchardt, Schüler von Friedrich Diez, wendete sich ungefähr zu derselben Zeit ebenfalls der Sachforschung zu. Beide Wissenschaftler müssen gemeinsam als Väter der Forschungsrichtung angesehen werden, sie haben zu gleichen Teilen den Verdienst, die Bedeutung der Sachforschung für die Sprachwissenschaft in der sprachwissenschaftlichen Betrachtung etabliert zu haben.
Zunächst als Gegenbewegung zu den strikten Lautgesetzen der Junggrammatiker gegründet, mit dem Ziel, die Sprachbetrachtung um die Wortbedeutung zu erweitern (Meringer e.a., WuS 1 (1909) 1f.), nahm die Forschungsrichtung nicht nur der Lehre der Junggrammatiker recht schnell den Rang als bestimmende Theorie der Sprachwissenschaften ihrer Zeit den Rang ab, sie kann für die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts bis in die zwanziger Jahre desselben hinein als ein die Sprachwissenschaft anleitendes methodisches Prinzip angesehen werden. So kann man gut und gern von einer jahrzehntelangen Blütezeit der Forschungsrichtung sprechen. Das allein rechtfertigte bereits eine Auseinandersetzung mit ihr im Rahmen der Betrachtung und Untersuchung der Geschichte der romanischen Sprachwissenschaft.
Ihr Verdienst war es, die Sprachwissenschaft ihrer Zeit aus den Ketten der strikten Anwendung der junggrammatischen Lehre von den Lautgesetzen befreit und die Sprachbetrachtung in synchroner wie auch in diachroner Sichtweise erweitert zu haben, dies darzustellen wird Aufgabe dieser Arbeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Auseinandersetzung mit dem Thema „Wörter und Sachen“ – „Sachen und Wörter“ im Rahmen der Geschichte der romanischen Sprachwissenschaft
- Aufgaben- und Fragestellung der vorliegenden Arbeit
- Rudolf Meringer gegen Hugo Schuchardt
- Der Gelehrtenstreit
- Würdigung der Auseinandersetzungen
- Wörter und Sachen - Rudolf Meringer
- Das Leitmotiv der Zeitschrift ,,Wörter und Sachen“
- Die Position Meringers
- Sachen und Wörter - Hugo Schuchardt
- Sachwortgeschichte
- 'Sache' vor 'Wort'
- Das Verständnis von 'Sache'
- Alte und neue Anwendungsgebiete
- Alte Anwendungsgebiete (vor 1945)
- Neue Anwendungsgebiete (nach 1945)
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Forschungsrichtung „Wörter und Sachen“, die insbesondere im frühen 20. Jahrhundert die romanische Sprachwissenschaft, aber auch andere Bereiche der Sprachwissenschaft, stark beeinflusst hat. Die Arbeit analysiert die Entstehung dieser Richtung, die zentralen Vertreter Rudolf Meringer und Hugo Schuchardt, sowie die Bedeutung und Anwendung des Prinzips „Wörter und Sachen“ in der Sprachwissenschaft.
- Die Entwicklung der Forschungsrichtung „Wörter und Sachen“
- Die Positionen von Rudolf Meringer und Hugo Schuchardt
- Der Einfluss von „Wörter und Sachen“ auf die Sprachwissenschaft
- Die Bedeutung der Sachforschung für die Sprachbetrachtung
- Die Anwendung des Prinzips „Wörter und Sachen“ in verschiedenen Kontexten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Forschungsrichtung „Wörter und Sachen“ ein, beschreibt ihre historische Entwicklung und die Rolle von Jacob Grimm, Rudolf Meringer und Hugo Schuchardt. Anschließend werden die Aufgaben und Fragestellungen der Arbeit vorgestellt, die sich auf die Analyse der Ansätze und die Gegenüberstellung der Positionen von Meringer und Schuchardt konzentrieren.
Das Kapitel „Rudolf Meringer gegen Hugo Schuchardt“ beleuchtet den Gelehrtenstreit zwischen den beiden Sprachwissenschaftlern, der durch ihre unterschiedlichen Ansätze und den Wunsch nach Anerkennung als Vertreter der Forschungsrichtung ausgelöst wurde. Die Arbeit untersucht die Entstehung des Streits, die Positionen beider Wissenschaftler und die Auswirkungen des Streits auf die Bekanntheit und Rezeption der Forschungsrichtung.
Im Kapitel „Wörter und Sachen - Rudolf Meringer“ werden die zentralen Ideen und Positionen Meringers dargestellt, die er in seinem Werk „Wörter und Sachen“ entwickelt hat. Die Arbeit analysiert Meringers Leitmotiv, seine Position zur Bedeutung der Sachforschung und seine Auseinandersetzung mit der Hausforschung.
Das Kapitel „Sachen und Wörter - Hugo Schuchardt“ befasst sich mit Schuchardts Werk „Sachen und Wörter“, in dem er seine Ansätze zur Sachwortgeschichte und zur Beziehung zwischen „Sache“ und „Wort“ entwickelt. Die Arbeit untersucht Schuchardts Definition von „Sache“, seine Kritik an der strikten Anwendung der junggrammatischen Lehre und seine Bedeutung für die Entwicklung der Sprachwissenschaft.
Das Kapitel „Alte und neue Anwendungsgebiete“ analysiert die verschiedenen Anwendungsgebiete des Prinzips „Wörter und Sachen“ in der Sprachwissenschaft. Die Arbeit differenziert zwischen den Anwendungsgebieten vor und nach 1945 und zeigt die Entwicklung und den Einfluss der Forschungsrichtung auf die Sprachbetrachtung.
Schlüsselwörter
Schlüsselbegriffe, die im Zentrum dieser Arbeit stehen, sind „Wörter und Sachen“, „Sachen und Wörter“, Sachforschung, Lautgesetze, Junggrammatik, Hausforschung, Sachwortgeschichte, Ferdinand de Saussure, Sprachzeichen, außersprachliche Wirklichkeit, Sprachbetrachtung, synchrone und diachrone Sichtweise, methodisches Prinzip, wissenschaftliche Diskussion, Gelehrtenstreit, Rudolf Meringer, Hugo Schuchardt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Forschungsrichtung „Wörter und Sachen“?
Es handelt sich um eine sprachwissenschaftliche Methode, die Wörter stets in Verbindung mit den realen Gegenständen (Sachen) untersucht, die sie bezeichnen. Sie bildete eine Gegenbewegung zu den rein abstrakten Lautgesetzen der Junggrammatiker.
Wer waren die Begründer dieser Richtung?
Als „Väter“ gelten der Indogermanist Rudolf Meringer und der Romanist Hugo Schuchardt, die Ende des 19. Jahrhunderts begannen, die Sachforschung für die Sprachwissenschaft zu etablieren.
Worüber stritten Rudolf Meringer und Hugo Schuchardt?
Es gab einen Gelehrtenstreit über die methodische Priorität und die Anerkennung als führende Vertreter der Richtung. Meringer betonte die Sachforschung, während Schuchardt die Sachwortgeschichte weiterentwickelte.
Welchen Einfluss hatte die „Wörter und Sachen“-Bewegung auf die Sprachwissenschaft?
Sie befreite die Sprachwissenschaft von der strikten Anwendung der junggrammatischen Lautgesetze und erweiterte die Sprachbetrachtung um die Wortbedeutung und die außersprachliche Wirklichkeit.
Was bedeutet der Fokus auf „Sache vor Wort“ bei Schuchardt?
Schuchardt vertrat die Ansicht, dass man die Geschichte und Beschaffenheit eines Gegenstands verstehen muss, um die Entwicklung des dazugehörigen Wortes und seiner Bedeutung korrekt analysieren zu können.
Wie entwickelte sich die Forschungsrichtung nach 1945?
Die Arbeit unterscheidet zwischen alten Anwendungsgebieten (z.B. Hausforschung) vor 1945 und neuen Anwendungsgebieten nach 1945, wobei die Methode weiterhin als wichtiges Prinzip der synchronen und diachronen Sprachbetrachtung gilt.
- Quote paper
- Thorsten Plath (Author), 2001, Wörter und Sachen - Sachen und Wörter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11903