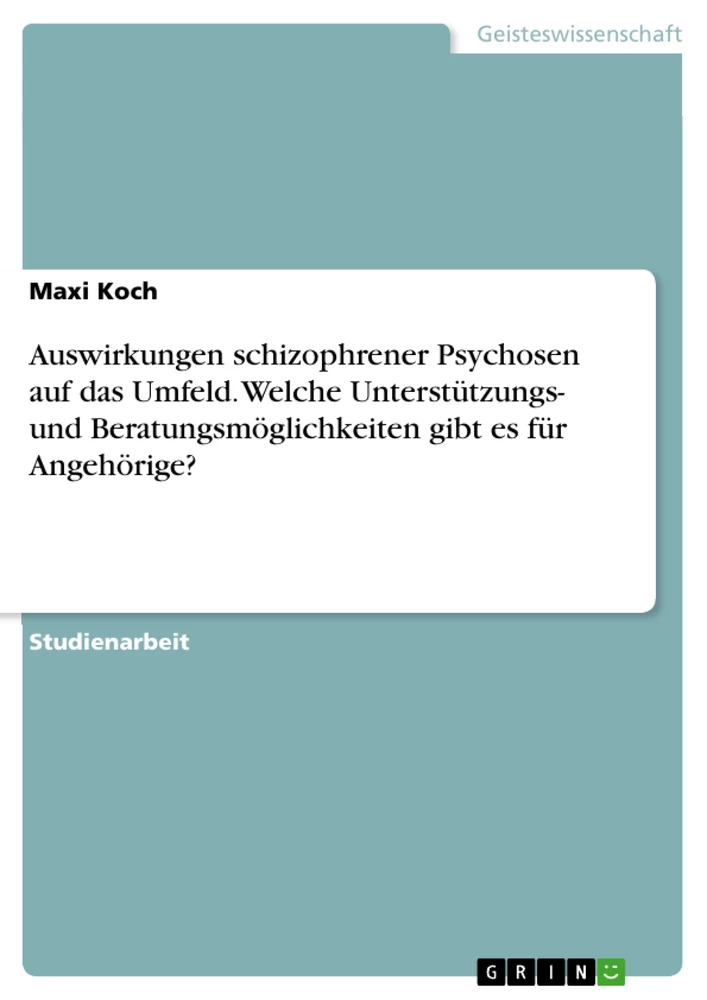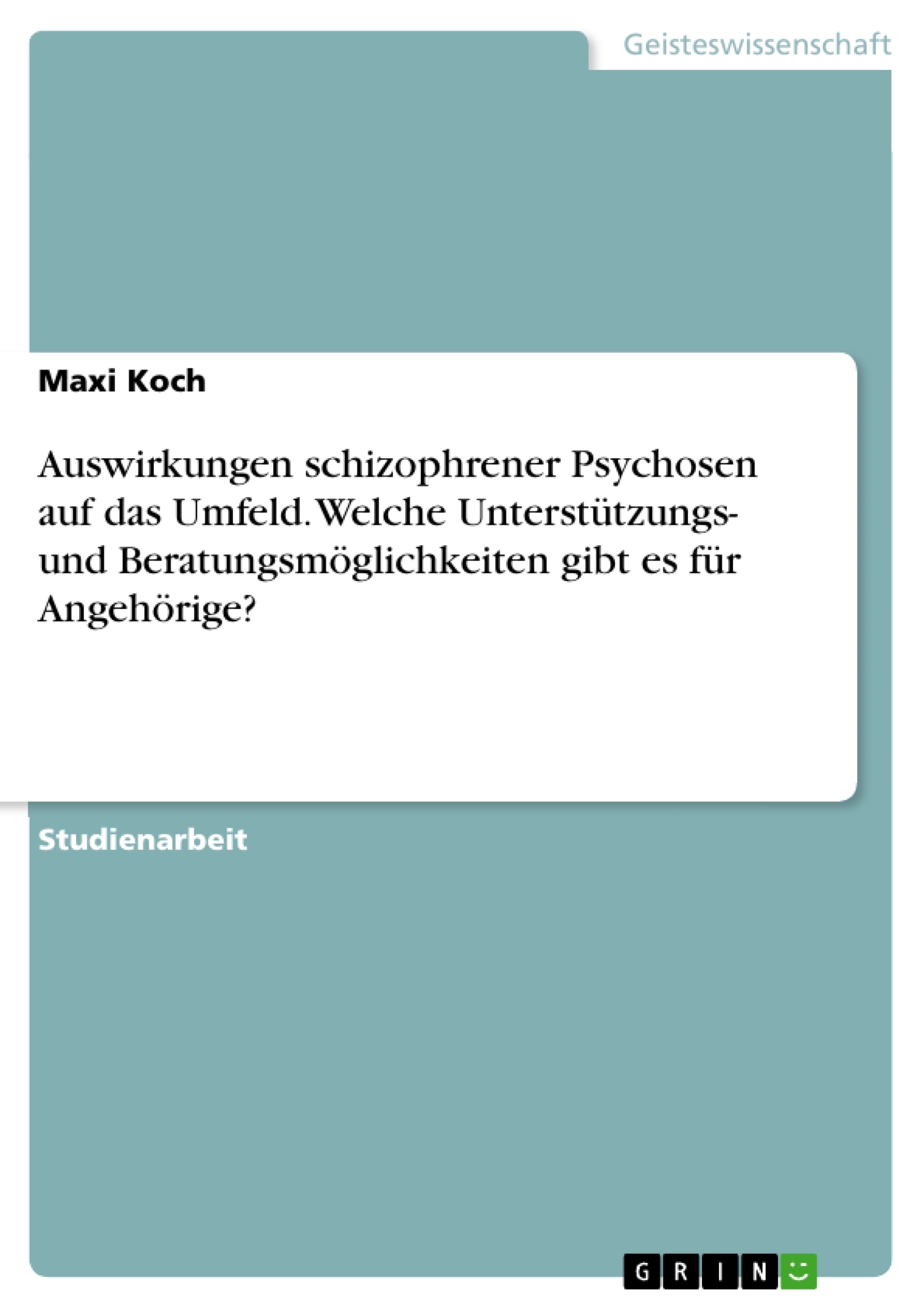Die vorliegende Hausarbeit setzt sich mit dem Krankheitsbild der Schizophrenie auseinander und fokussiert dabei die Auswirkungen der Psychose auf das soziale Umfeld der Betroffenen.
Es wird näher beleuchtet, welche Beratungsmöglichkeiten für Angehörige vorliegen und inwiefern diese aufzusuchen sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Krankheitsbild Schizophrenie
- Entstehung psychischer Störungen
- Auswirkungen psychische Erkrankungen auf das Umfeld der Betroffenen
- Auswirkungen Schizophrenie auf das Umfeld der Betroffenen
- Psychoedukation
- Beratung von Betroffenen und ihren Angehörigen
- Beratung in psychiatrischen Kliniken
- Beratung in ambulanten Einrichtungen
- Beratung in Praxiseinrichtungen
- Telefon- und Onlineberatung
- Familientherapie
- Selbsthilfe- und Angehörigengruppen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit den Auswirkungen schizophrener Psychosen auf das Umfeld der Betroffenen und den verfügbaren Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten für Angehörige. Sie analysiert die Entstehung und Ursachen der Krankheit, beleuchtet die vielfältigen Auswirkungen auf das soziale Umfeld und präsentiert verschiedene Ansätze der Beratung und Unterstützung für Angehörige.
- Entstehung und Ursachen der schizophrenen Psychose
- Auswirkungen auf das soziale Umfeld der Betroffenen
- Beratung und Unterstützungsmöglichkeiten für Angehörige
- Psychoedukation und ihre Rolle in der Bewältigung der Erkrankung
- Familientherapie als Instrument der Unterstützung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Krankheitsbild der Schizophrenie vor und hebt die Bedeutung der Auswirkungen auf das soziale Umfeld, insbesondere auf Angehörige, hervor. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, diese Thematik zu beleuchten und verschiedene Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für Angehörige aufzuzeigen.
1. Krankheitsbild Schizophrenie
Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung und den Ursachen der schizophrenen Psychose. Es beleuchtet die Geschichte des Krankheitsbildes und die verschiedenen Ansätze zur Definition. Außerdem werden die Symptome und die verschiedenen Verlaufsformen der Krankheit diskutiert.
2. Auswirkungen psychische Erkrankungen auf das Umfeld der Betroffenen
Dieser Abschnitt analysiert die Auswirkungen der schizophrenen Psychose auf das Umfeld der Betroffenen. Er beleuchtet die Herausforderungen, mit denen Angehörige konfrontiert sind, und die besonderen Bedürfnisse, die im Zusammenhang mit der Erkrankung entstehen.
3. Beratung von Betroffenen und ihren Angehörigen
Dieses Kapitel widmet sich verschiedenen Ansätzen der Beratung und Unterstützung für Betroffene und ihre Angehörigen. Es präsentiert verschiedene Einrichtungen und Möglichkeiten, die sich auf die Bedürfnisse des sozialen Umfelds konzentrieren.
Schlüsselwörter
Schizophrenie, Psychose, Angehörige, Unterstützung, Beratung, Psychoedukation, Familientherapie, Selbsthilfegruppen, Sozialpsychiatrie, psychiatrische Erkrankungen, Auswirkungen, Umfeld, Belastungen, Krankheitserleben, Therapie, Behandlung, psychosoziale Beratung.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkt sich Schizophrenie auf das soziale Umfeld aus?
Die Erkrankung führt oft zu massiven Belastungen für Angehörige, da sie mit Verhaltensänderungen, Ängsten und der Pflegebedürftigkeit des Betroffenen umgehen müssen.
Was ist Psychoedukation für Angehörige?
Es handelt sich um Schulungen, die Angehörigen fundiertes Wissen über die Krankheit vermitteln, um den Umgang mit dem Patienten zu erleichtern und die Rückfallquote zu senken.
Welche Beratungsmöglichkeiten gibt es für Familienmitglieder?
Angehörige können Hilfe in psychiatrischen Kliniken, ambulanten Einrichtungen, Selbsthilfegruppen oder durch Familientherapie finden.
Gibt es anonyme Beratungsangebote?
Ja, Telefon- und Onlineberatung bieten eine niederschwellige Möglichkeit, erste Informationen und Unterstützung bei psychischen Krisen zu erhalten.
Warum ist Familientherapie bei Schizophrenie sinnvoll?
Sie hilft dabei, Kommunikationsmuster innerhalb der Familie zu verbessern und Stressfaktoren zu reduzieren, was positiv auf den Krankheitsverlauf des Betroffenen wirkt.
- Quote paper
- Maxi Koch (Author), 2022, Auswirkungen schizophrener Psychosen auf das Umfeld. Welche Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten gibt es für Angehörige?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1190350