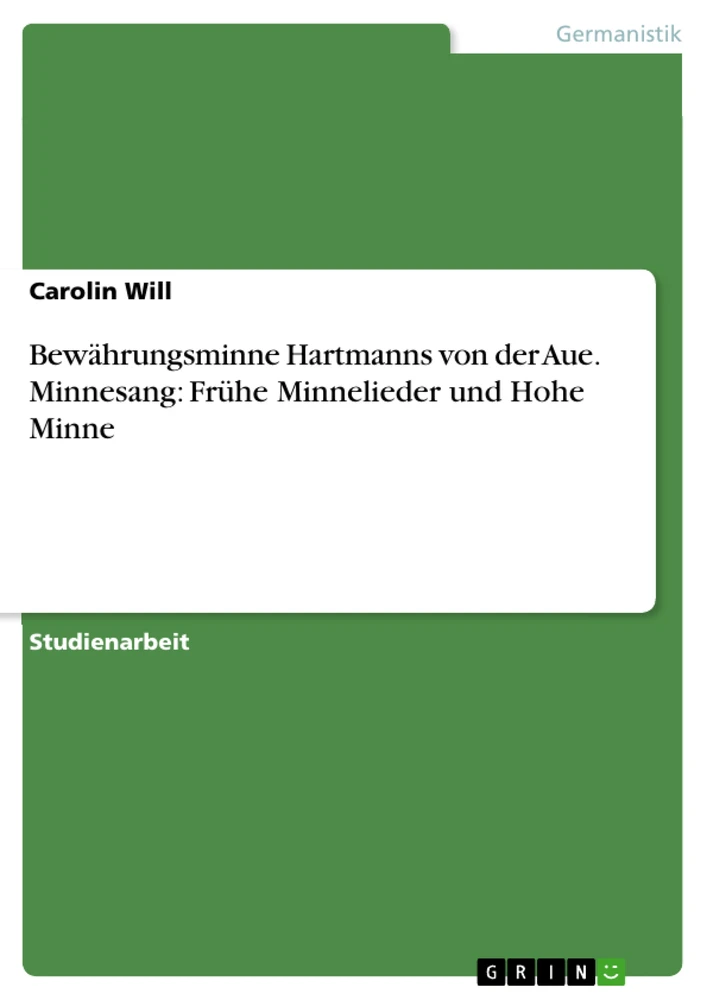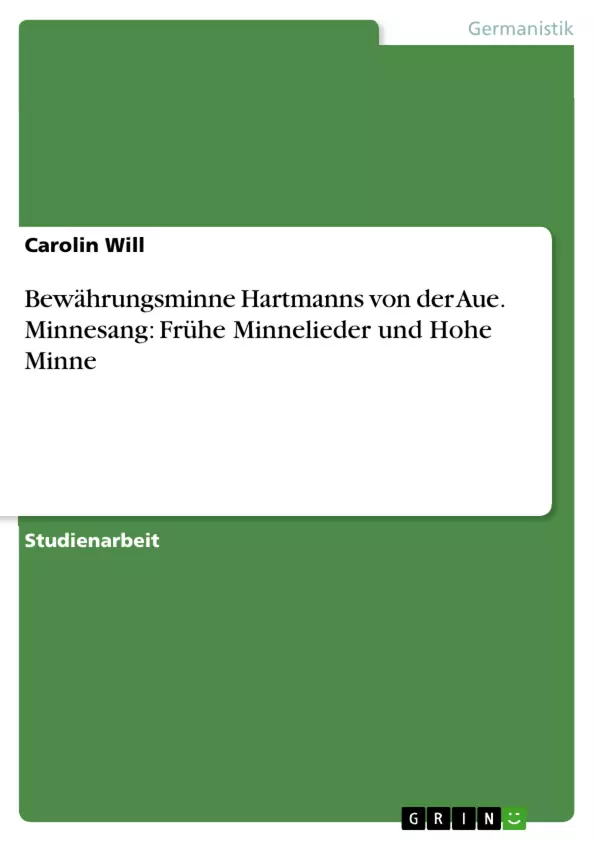In der vorliegenden Arbeit wird die spezifische Beziehungsdynamik von minnendem und frouwe als Bewährungsminne bezeichnet und als Konzept näher ausgearbeitet. Beispielhaft wird dies am Minnekonzept Hartmanns von der Aue getan, dessen Werke sich durch ihre vielseitigen Ansätze für eine solche Betrachtung anbieten. Dabei wird mit Blick auf den Umfang der Arbeit auf einen beschränkten Kreis von Themen einzugehen sein. Ausgewählt wurden für diese vorliegende Arbeit vier Aspekte: soziale Aspekte, die mit der Selbstinszenierung des Minnesängers als Lehrer entstehen und die Auswirkungen, die eine gescheiterte Minnebewährung nach sich zieht, und inhaltliche bzw. thematische Details wie die Verwendung von Kreuzzugsmetaphorik und der Zeitgestaltung.
Inhaltsverzeichnis
- Bewährungsminne Hartmanns von der Aue - Erarbeitung eines neuen Konzepts
- Soziale Aspekte der Bewährungsminne
- Selbstinszenierung und gesellschaftliche Positionierung des sich bewährenden Sängers
- Soziale Auswirkungen des Scheitern im Minnedienst
- Inhaltliche Aufarbeitung der Bewährungsminne
- Zeitliche Aspekte der Minnebewährung
- Kreuzzug als Folie für die Minnebewährung
- Wie bewährt sich der Sänger im Minnedienst?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Konzept der Bewährungsminne, das sich in der Beziehung zwischen minnendem Sänger und frouwe im Minnesang des 12. Jahrhunderts zeigt. Die Arbeit fokussiert auf Hartmanns von der Aue Werke, da diese durch ihre vielseitigen Ansätze für eine Analyse der Bewährungsminne geeignet sind. Die Arbeit möchte beleuchten, wie sich der Sänger in dieser Beziehung sowohl gesellschaftlich als auch gegenüber der Dame bewährt.
- Selbstinszenierung des Sängers und seine Rolle im höfischen Kontext
- Soziale Auswirkungen des Scheiterns im Minnedienst
- Zeitliche Dimensionen der Bewährung und die Verbindung zur Kreuzzugsidee
- Die ewige Bewährung im Minnedienst und ihre Verbindung zu anderen Dienstformen wie Herrendienst und Gottesdienst
- Die didaktische Funktion des Minnesangs und die Rolle des Sängers als Lehrinstanz
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Abschnitt der Arbeit analysiert die Selbstinszenierung des Sängers in der höfischen Gesellschaft. Dabei wird untersucht, wie sich der Sänger durch seine Taten im Namen der Dame als würdiger Verehrer und Mitglied des Hofes präsentiert. Im zweiten Abschnitt wird das Scheitern des Minnedienstes und dessen Auswirkungen auf den Sänger untersucht. Es wird gezeigt, dass selbst im Falle des Scheiterns der Dienst oft fortgesetzt wird und die Selbsterkenntnis um die Gründe des Scheiterns dem Sänger sogar eine Autoritätsposition als Lehrinstanz gegenüber den Zuhörern verleiht.
Schlüsselwörter
Bewährungsminne, Hartmann von Aue, Minnesang, höfische Gesellschaft, Selbstinszenierung, Scheitern, Minnedienst, Kreuzzug, Gottesdienst, Herrendienst, didaktische Funktion, Lehrinstanz
- Quote paper
- Carolin Will (Author), 2022, Bewährungsminne Hartmanns von der Aue. Minnesang: Frühe Minnelieder und Hohe Minne, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1190363