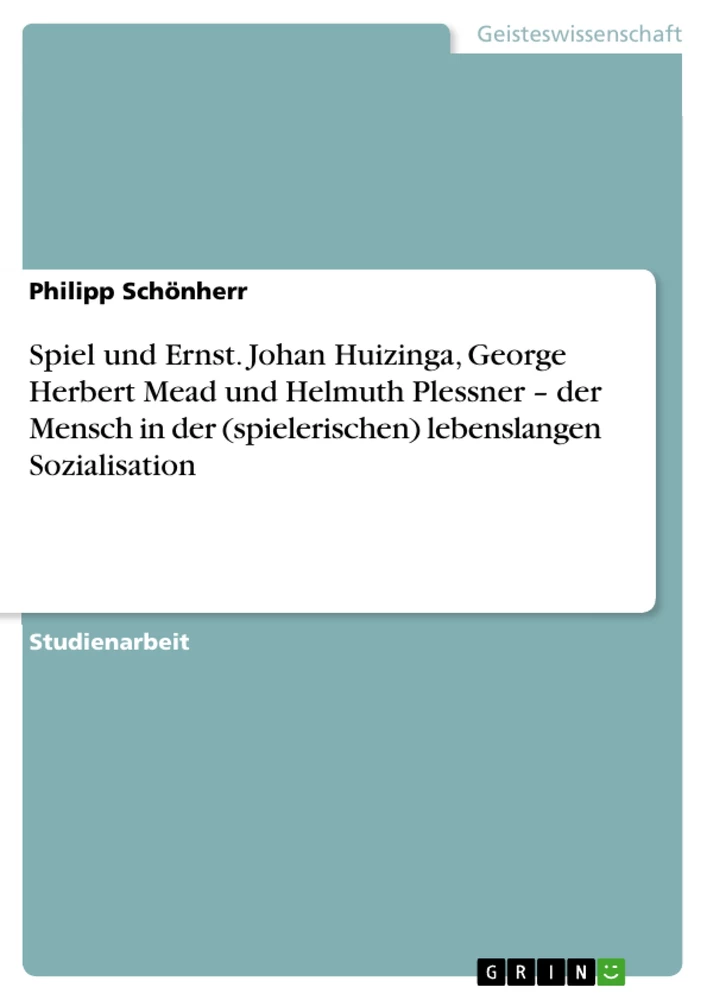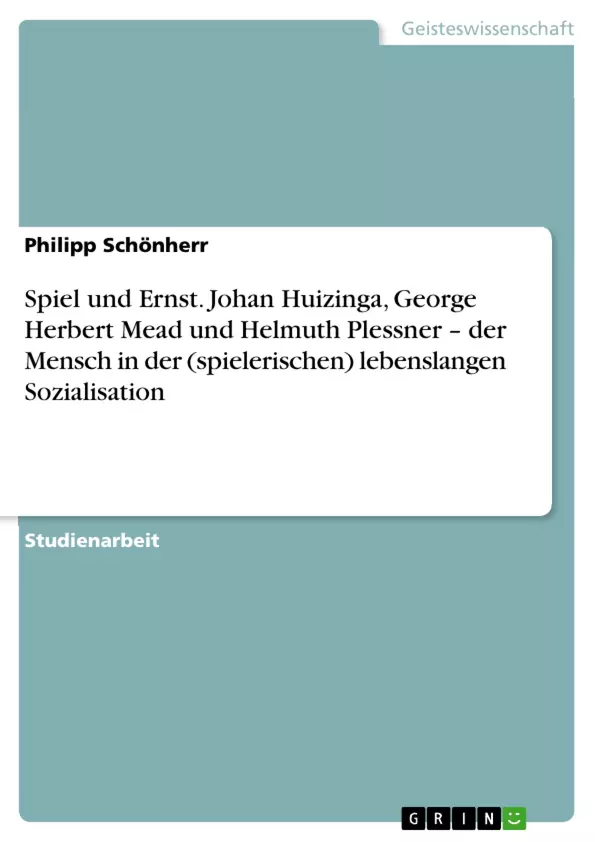Zunächst wird sich diese Untersuchung, in Anlehnung an Huizinga, mit dem antagonistischen Begriffspaar des Spiels und des Ernstes auseinandersetzten. Es wird hervorgehoben, dass eine allzu strikte Trennung dieser Sphären des menschlichen Seins keineswegs so klar voneinander zu unterscheiden sind, dass Spiel und Ernst sich bedingen und, dass, selbst wenn eine strikte Separation angenommen wird, es dennoch Verbindungen auf der konstitutionellen Ebene jener Begriffe gibt.
Daran anknüpfend werden – gewissermaßen den Kern dieser Untersuchung ausmachend – zum einen George Herbert Meads Mind, Self & Society und Helmuth Plessners Grenzen der Gemeinschaft im Fokus stehen. Meads Text präsentiert eine Theorie, welche die Entstehung und Weiterentwicklung des 'Selbst', d.h. der eigenen Persönlichkeit als einen sozialintegrativen Prozess beschreibt und, der zumindest in der jüngeren Forschung, Analog zum Konzept des 'lebenslangen Lernens' aufgefasst wird. Kontinuität in der Weiterentwicklung der Persönlichkeit ist ein zentraler Aspekt und wie zu zeigen sein wird, weißt diese Elemente eines Spiels auf. Auf einer stärker differenzierten Ebene ist Plessners Auseinandersetzung mit den Spielarten im sozialen Miteinander angesiedelt. Wenn Mead gewissermaßen eine allgemeine Theorie zur Entstehung des Selbst formuliert, ist es bei Plessner der Erhalt und die Behauptung des Selbst in sozialen Interaktionen, d.h. der Sozialisation. Diese zeichnet sich einmal mehr durch Überschneidungen mit spielerischen Elementen aus, sei es in spezifischen Rollen die übernommen werden, die sich aus Normen ergeben, aus Selbstschutz oder weil sie eine Frage der Empathie darstellen.
Abschließend und im Rückgriff auf Plessner und Mead und Wittpoth, sollen Überlegungen angestellt werden, was denn eigentlich dagegen spräche, den Homo ludens in den erlesenen Kreis des Homo faber und des Homo sapiens, als Beschreibungsformen der menschlichen Ontologie aufzunehmen?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Spiel mit dem Ernst
- 2.1 Spielerische Entwicklung des Selbst in sozialen Kontexten
- 2.2 Spielarten der sozialen Interaktion
- 2.3 Gespielte Rollen - der homo ludens als Teil der menschlichen Ontologie
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Beziehung zwischen Spiel und Ernst im menschlichen Leben, insbesondere im Kontext der lebenslangen Sozialisation. Sie analysiert, wie spielerische Aktivitäten zur Entwicklung des Selbst und zur sozialen Interaktion beitragen. Die Arbeit bezieht sich dabei auf die Theorien von Johan Huizinga, George Herbert Mead und Helmuth Plessner.
- Das Verhältnis von Spiel und Ernst im menschlichen Leben
- Die Rolle des Spiels in der Entwicklung des Selbst
- Spiel als Form sozialer Interaktion
- Der "homo ludens" und seine Bedeutung für die menschliche Ontologie
- Lebenslanges Lernen und die Bedeutung des Spiels in verschiedenen Lebensphasen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit Huizingas These, dass Spiel älter als Kultur ist und bereits bei Tieren beobachtet werden kann. Sie beleuchtet die lange Geschichte des Spiels, beginnend bei Aristoteles bis hin zu modernen Computerspielen, und verweist auf das Beispiel des "Royal Game of Ur" als Beweis für die historische Bedeutung des Spiels. Die Einleitung stellt die Frage nach der Bedeutung des Spiels in verschiedenen Lebensphasen – Kindheit, Erwachsenenalter und Alter – und thematisiert die gängige Vorstellung, dass Spiel hauptsächlich mit Kindheit und Alter assoziiert wird, während das Erwachsenenalter eher von Ernst geprägt ist. Die Arbeit kündigt an, diese Sichtweise zu hinterfragen und die Rolle des Spiels im gesamten menschlichen Leben zu untersuchen.
2. Das Spiel mit dem Ernst: Dieses Kapitel analysiert die komplexe Beziehung zwischen Spiel und Ernst. Es wird argumentiert, dass eine strikte Trennung dieser beiden Sphären nicht möglich ist und dass sie sich gegenseitig bedingen. Das Kapitel greift auf die Theorien von George Herbert Mead (Mind, Self & Society) und Helmuth Plessner (Grenzen der Gemeinschaft) zurück, um die Entwicklung des Selbst als einen sozialintegrativen Prozess zu beschreiben, der auch spielerische Elemente beinhaltet. Es wird betont, dass der erwachsene Mensch ebenso ein Spieler ist und durch spielerisches Handeln soziale Regeln und Interaktionen erlernt und navigiert. Der Kapitel betrachtet die Dynamik des Selbst und die flexiblen 'Spielregeln' des Lebens, die sich in verschiedenen Lebensbereichen (Familie, Beruf etc.) unterscheiden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Das Spiel mit dem Ernst"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Beziehung zwischen Spiel und Ernst im menschlichen Leben, insbesondere im Kontext der lebenslangen Sozialisation. Sie analysiert, wie spielerische Aktivitäten zur Entwicklung des Selbst und zur sozialen Interaktion beitragen und bezieht sich dabei auf die Theorien von Johan Huizinga, George Herbert Mead und Helmuth Plessner.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Verhältnis von Spiel und Ernst, der Rolle des Spiels in der Selbstentwicklung, Spiel als Form sozialer Interaktion, der Bedeutung des "homo ludens" für die menschliche Ontologie und dem lebenslangen Lernen im Kontext des Spiels in verschiedenen Lebensphasen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Eine Einleitung, das Hauptkapitel "Das Spiel mit dem Ernst" und ein Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die historische Bedeutung des Spiels. Das Hauptkapitel analysiert die komplexe Beziehung zwischen Spiel und Ernst und bezieht dabei verschiedene soziologische Theorien mit ein. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie wird die Beziehung zwischen Spiel und Ernst dargestellt?
Die Arbeit argumentiert gegen eine strikte Trennung von Spiel und Ernst. Sie betont, dass beide Sphären untrennbar miteinander verbunden sind und sich gegenseitig bedingen. Das spielerische Element wird als integraler Bestandteil der menschlichen Entwicklung und sozialen Interaktion angesehen, der über alle Lebensphasen hinweg relevant ist.
Welche Theorien werden herangezogen?
Die Arbeit stützt sich auf die Theorien von Johan Huizinga (Homo Ludens), George Herbert Mead (Mind, Self & Society) und Helmuth Plessner (Grenzen der Gemeinschaft), um die Entwicklung des Selbst und die soziale Interaktion im Kontext des Spiels zu analysieren.
Welche Rolle spielt der "homo ludens"?
Der "homo ludens" (spielender Mensch) wird als ein essentieller Aspekt der menschlichen Ontologie betrachtet. Die Arbeit untersucht, wie spielerisches Handeln zum Verständnis menschlicher Sozialisation und zur Navigation sozialer Regeln beiträgt.
Wie wird die Bedeutung des Spiels in verschiedenen Lebensphasen dargestellt?
Die Arbeit hinterfragt die gängige Vorstellung, dass Spiel hauptsächlich mit Kindheit und Alter assoziiert wird, während das Erwachsenenalter von Ernst geprägt ist. Sie betont die Bedeutung des Spiels für alle Lebensphasen und analysiert dessen Rolle in der Entwicklung des Selbst und der sozialen Interaktion über den gesamten Lebenslauf.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Der Inhalt des Fazits ist in der bereitgestellten HTML-Vorschau nicht explizit aufgeführt. Es lässt sich aber folgern, dass das Fazit die Ergebnisse der Analyse der Beziehung zwischen Spiel und Ernst zusammenfasst und deren Bedeutung für die menschliche Entwicklung und soziale Interaktion unterstreicht.)
- Citar trabajo
- B. A. Philipp Schönherr (Autor), 2021, Spiel und Ernst. Johan Huizinga, George Herbert Mead und Helmuth Plessner – der Mensch in der (spielerischen) lebenslangen Sozialisation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1190406