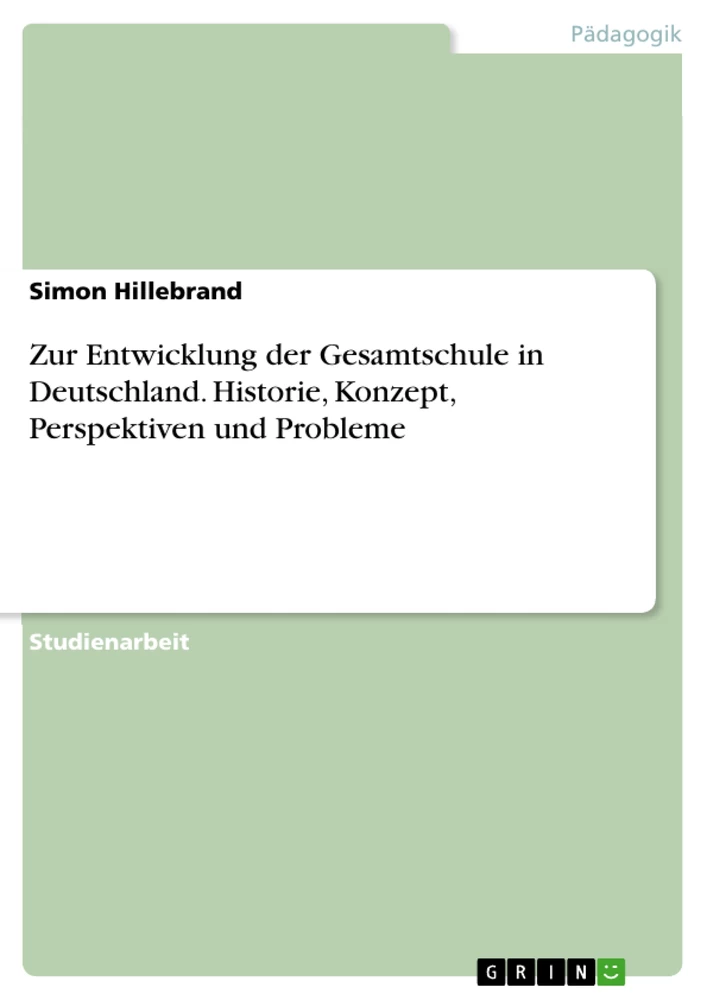Die Arbeit thematisiert die Entstehungsgeschichte sowie Grundprinzipien und Kernideen des Konzepts der Gesamtschule. Es wird herausgestellt, wie und wann sich die Gesamtschule aus dem bis dato bereits bestehenden Schulsystem entwickelt hat und welche politischen sowie gesellschaftlichen Interessen diesem Streben zu Grunde liegen. Warum war eine neue Schulform notwendig?
Im Anschluss daran wird sowohl auf die schulorganisatorischen Aspekte als auch auf die Ziele und Aufgaben der Gesamtschule eingegangen. Des Weiteren werden die pädagogischen Konzepte, Aufgaben und Ziele der Gesamtschule erläutert, sodass darauffolgend eine Bilanz gezogen werden kann. Welche Probleme weist dieses Konzept auf und welche Perspektiven eröffnet es? Hat die Gesamtschule noch eine Zukunft?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historie und Entstehung der Gesamtschulen in Deutschland
- 2.1 Die deutsche Schulpolitik nach 1945
- 2.2 Zeit für Veränderung? – Der Reformwille der 1960er Jahre
- 3. Die Idee Gesamtschule
- 4. Pädagogische Prinzipien und Organisation der Gesamtschule
- 5. Probleme und Perspektiven der Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen
- 6. Fazit und Ausblick
- 7. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Entstehung der Gesamtschule in Deutschland, untersucht ihre Kernideen und Grundprinzipien und beleuchtet ihre Entwicklung aus dem bestehenden Schulsystem. Sie betrachtet die politischen und gesellschaftlichen Interessen, die diese Entwicklung vorangetrieben haben, und beleuchtet die Notwendigkeit einer neuen Schulform. Zudem werden die schulorganisatorischen Aspekte, Ziele und Aufgaben der Gesamtschule sowie ihre pädagogischen Konzepte, Aufgaben und Ziele untersucht.
- Die Entstehungsgeschichte der Gesamtschule in Deutschland
- Die Rolle der Schulpolitik in der Nachkriegszeit
- Die pädagogischen Prinzipien und organisatorischen Strukturen der Gesamtschule
- Die Herausforderungen und Chancen der Gesamtschule
- Die Gesamtschule im Kontext der deutschen Bildungslandschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Entstehung und Entwicklung der Gesamtschule in Deutschland ein. Es skizziert die politische und gesellschaftliche Situation der Nachkriegszeit, die zur Diskussion einer neuen Schulform führte. Kapitel Zwei beleuchtet die deutsche Schulpolitik nach 1945 und die Bemühungen der Alliierten, das deutsche Bildungswesen zu reformieren. Kapitel Drei befasst sich mit der Entstehung der Gesamtschule und ihren pädagogischen Prinzipien.
Schlüsselwörter
Gesamtschule, Schulreform, deutsche Schulpolitik, Nachkriegszeit, pädagogische Prinzipien, Organisation, Probleme, Perspektiven, Bildungswesen, Demokratie, Chancengleichheit.
- Quote paper
- Simon Hillebrand (Author), 2022, Zur Entwicklung der Gesamtschule in Deutschland. Historie, Konzept, Perspektiven und Probleme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1190604