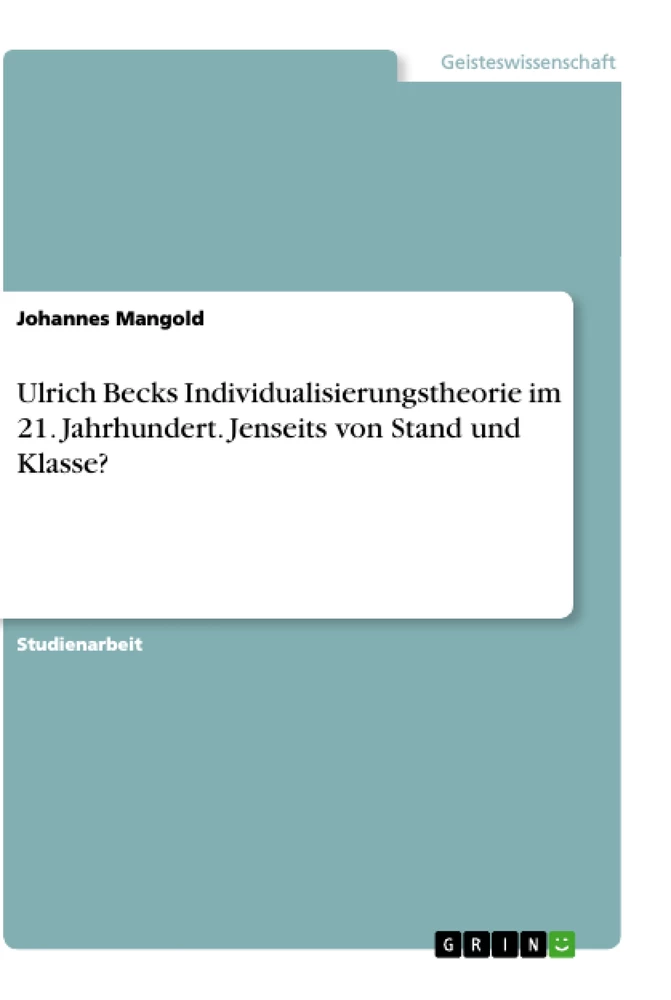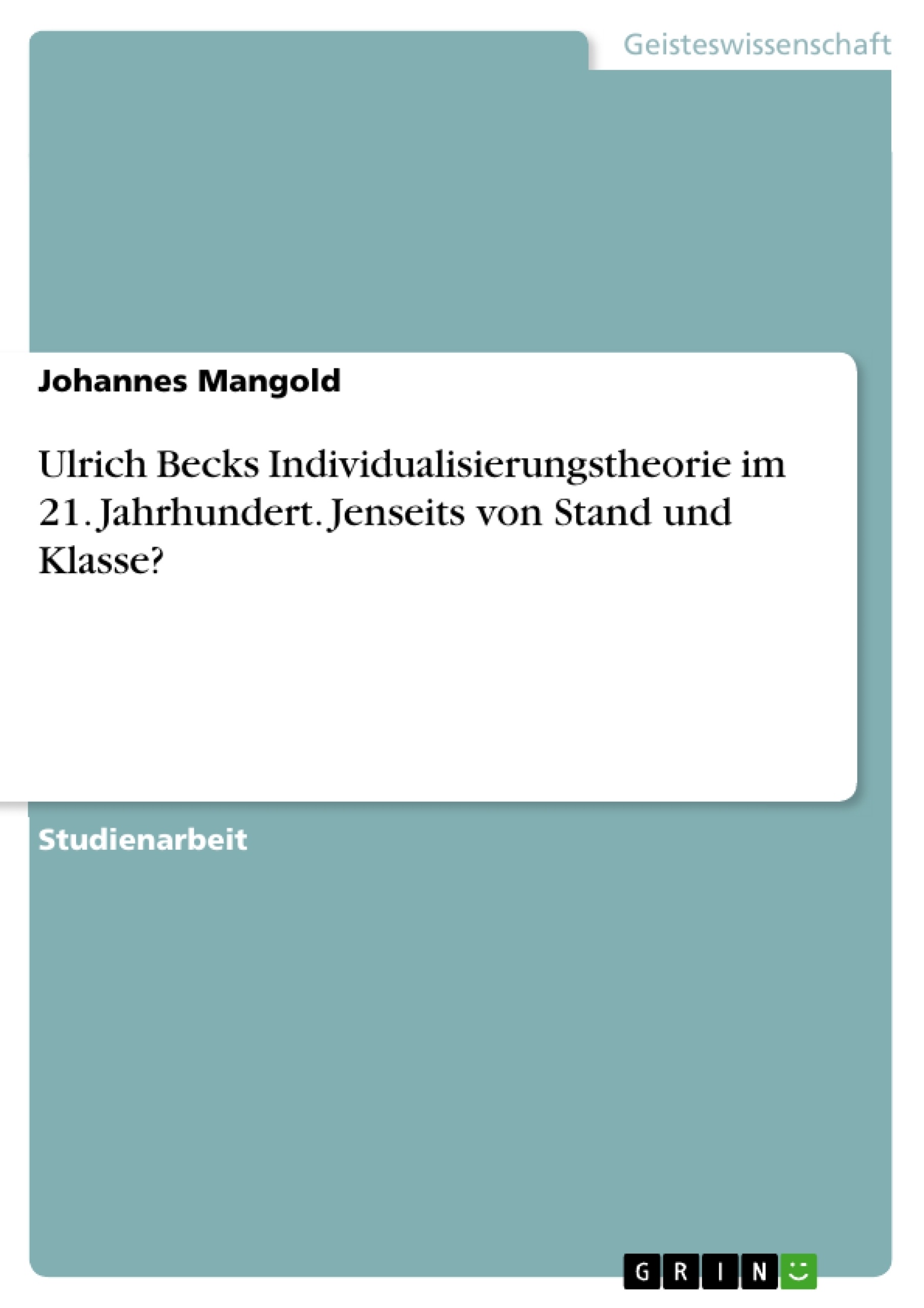Diese Arbeit beschäftigt sich mit der (möglicherweise aufgelösten) Klassengesellschaft in der wiedervereinten Bundesrepublik. Als Erstes aber springt diese Arbeit in die 1980er Jahre, in der der bekannte deutsche Soziologe Ulrich Beck (1944-2015) einen Text mit der Überschrift: „Jenseits von Stand und Klasse. Auf dem Weg in die individualisierte Arbeitnehmergesellschaft“ verfasste. Wie diese Überschrift schon anklingen lässt, stellt Beck die zentrale These auf, dass sich bei gleichbleibenden Ungleichheitsverhältnissen, Klassenbindungen aufgrund der Abschwächung von sozialen Risiken am Arbeitsmarkt und dem gestiegenen Wohlstand in allen Klassen auflösen und sich eine individualisierte Arbeitsgesellschaft entwickelt.
Hier stellt sich die Frage, ob diese These noch auf die heutige Gesellschaft anwendbar ist und wie stark die von Ulrich Beck vorhergesagten Individualisierungsschübe in der heutigen Arbeitsgesellschaft auftreten. Beck stellt eine weitere Anzahl von spannenden Hypothesen vor, jedoch konzentriert sich diese Arbeit auf die Frage, inwieweit soziale Absicherung und die damit verbundene Auflösung von Klassenidentitäten in der heutigen Arbeitsgesellschaft noch verbreitet ist.
1 Einleitung
Im Zuge der Corona-Krise im Jahr 2020 herrschte in der öffentlichen Debatte sehr stark die Einstellung, dass das Virus alle Menschen in Deutschland in gleicher Weise treffen würde. Doch verstärkt Sozialwissenschaftler*innen zeigen durch Untersuchungen auf, dass die Corona-Pandemie verstärkt die einkommensschwächere Bevölkerung treffe. Auch der Soziologe Oliver Nachtwey beschreibt in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, dass „Deutschland eine Klassengesellschaft ist und Menschen aus der Unterklasse ein höheres Infektionsrisiko haben.“1
Auch diese Arbeit beschäftigt sich mit der (möglicherweise aufgelösten) Klassengesellschaft in der wiedervereinten Bundesrepublik. Als Erstes aber springt diese Arbeit in die 1980er Jahre, in der der bekannte deutsche Soziologe Ulrich Beck (1944-2015) einen Text mit der Überschrift: „ Jenseits von Stand und Klasse. Auf dem Weg in die individualisierte Arbeitnehmergesellschaft“ verfasste . Wie diese Überschrift schon anklingen lässt, stellt Beck die zentrale These auf, dass sich bei gleichbleibenden Ungleichheitsverhältnissen, Klassenbindungen auf Grund der Abschwächung von sozialen Risiken am Arbeitsmarkt und dem gestiegenen Wohlstand in allen Klassen auflösen und sich eine individualisierte Arbeitsgesellschaft entwickelt.2
Hier stellt sich die Frage, ob diese These noch auf die heutige Gesellschaft anwendbar ist und wie stark die, von Ulrich Beck vorhergesagten Individualisierungsschübe in der heutigen Arbeitsgesellschaft auftreten. Beck stellt eine weitere Anzahl von spannenden Hypothesen vor, jedoch konzentriert sich diese Arbeit auf die Frage: inwieweit soziale Absicherung und die damit verbundene Auflösung von Klassenidentitäten in der heutigen Arbeitsgesellschaft noch verbreitet ist?
Die Arbeit ist in verschiedene Abschnitte gegliedert und das erste Kapitel widmet sich theoretischen Konzepten der Klassengesellschaft. Dort wird aufgezeigt, was unter einer Klassengesellschaft überhaupt verstanden wird und welche verschiedenen theoretischen Konzepte von Klassengesellschaften existieren. Im nächsten Schritt sollen ausführlich die zentralen Punkte von Becks Individualisierungstheorie vorgestellt werden.
Beck analysiert auch verschiedene Antriebskräfte, welche den Individualisierungsprozess bedingen, diese werden auch thematisiert und vorgestellt.
Als letzten Punkt werden noch die von Beck bilanzierten Gefahren und Risiken einer individualisierten Gesellschaft dargestellt.
In einem weiteren Schritt sollen diese Thesen auf die Arbeitsgesellschaft ab den 2000er Jahren übertragen und überprüft werden. Hier liegt verstärkt der Fokus auf subjektive Wahrnehmung von Klassenbindungen und inwieweit noch ein Arbeitsmarkt mit geringen sozialen Unsicherheiten existiert. Zum Ende der Arbeit sollen die Ergebnisse kurz zusammengefasst werden und noch einmal auf die Forschungsfrage eingegangen werden. Aber auch ein Ausblick über weitere zu erforschende Sachverhalte soll gewagt werden.
2 Theorien der Klassengesellschaft
Bevor die These zur Entwicklung der Arbeitsgesellschaft von Ulrich Beck herausgearbeitet und dargestellt wird, soll in diesem Kapitel geklärt werden, was unter dem Begriff der Klasse beziehungsweise Klassenstrukturen verstanden wird. Denn eine zentrale These von Beck ist: „Wir leben heute in der Bundesrepublik bereits in Verhältnissen jenseits der Klassengesellschaft“.3 Für das Verstehen dieser Aussage ist natürlich von immenser Bedeutung , was der Begriff der Klassengesellschaft impliziert. In diesem Kapitel soll veranschaulicht werden, welche Klassenbegriffe und theoretische Konzepte existieren und was unter diesen Theorien verstanden wird. Einer der ersten Soziolog*innen welcher ein Klassenkonzept entworfen hat, war Karl Marx. Er entwarf seine Klassentheorie im 19.Jahrhundert. Für ihn bestand die gesamte Geschichte der Menschen aus verschiedenen Klassenkämpfen wie zum Beispiel Freier und Sklave. Nach seiner Auffassung hat die Modernisierung die Klassengegensätze nicht aufgelöst ,sondern die Industrialisierung hat die Gesellschaft in zwei gegenüberstehenden Klassen gespaltet: die proletarischen Klasse und die bourgeoise Klasse.4
Das Klassenverhältnis ist bestimmt durch das Verhältnis zu den Produktionsmitteln. So zeichnet sich die Bourgeoisie, durch den Besitz von vorhandenen Produktionsmitteln aus. Die proletarische Klasse verfügt über keine Produktionsmittel und hat für ihre Lebenssicherung nur die Möglichkeit ihre Arbeitskraft zu verkaufen.
Die Arbeiter*innen erarbeiten in den Fabriken und den Produktionsstätten einen Mehrwert, welcher von den Produktionsmittelbesitzern abgeschöpft werden und diese erwirtschaften ihr Kapital auf Grundlage der Ausbeutung der Arbeiter*innenklasse. Dadurch ist nach Marx die Bourgeoisie die herrschende Klasse und das Proletariat die beherrschte Klasse. Zwischenklassen lösen sich im Laufe der Zeit auf und es bleiben nur die zwei antagonistischen Klassen bestehen. Wichtig ist auch zu betonen, dass die Herrschaft der Bourgeoisie auf ökonomischen Verhältnissen beruht, darüber hinaus gehen aber zum Beispiel die Bereiche der Kultur und der Politik. Marx verwendet hier für den Begriff des Überbaus.5
Ein weiterer wichtiger Punkt in Karl Marx Klassentheorie stellt die Unterscheidung zwischen den Begriffen Klasse an sich und Klasse für sich dar. Klasse an sich bedeutet die objektive Zuordnung zu einer Klasse auf Grund des Verhältnisses zu den Produktionsmitteln. Die Klasse für sich entsteht, wenn Personen mit der gleichen Klassenlage ein gemeinsames Klassenbewusstsein entwickeln. Wichtig ist zu betonen, dass die beiden Klassen antagonistisch zueinanderstehen. Es existiert ein Klassenkonflikt, da die Bourgeoisie die bestehenden Verhältnisse erhalten will, die proletarische Klasse diese aber überwinden möchte. Dieser Klassenkonflikt führt zu permanenten Klassenkämpfen zwischen den zwei großen gegenüberstehenden Klassen.6
Dieses Klassenkonzept von Karl Marx prägt noch heute soziologisches Denken über die Klassengesellschaft und war die Grundlage für die Weiterentwicklung des Klassenkonzeptes. Diese Weiterentwicklung wurde durch Erik Olin Wright vorgenommen, der sich damit beschäftigte, dass Marx Prognose von der Auflösung der Mittelklassen nicht eingetroffen ist. Er identifiziert in seinem Modell widersprüchliche Mittelklassen, die zum Beispiel die Interessen der Kapitalbesitzer vertreten aber keine Produktionsmittel besitzen.
Die Klassenverhältnisse beruhen wie bei Marx auf Ausbeutung, jedoch sieht Wright neben dem Besitz von Produktionsmitteln auch die Ressourcen der Organisationsmacht und der Qualifikation als Ausbeutungsinstrumente an. Insgesamt weist, das Klassenkonzept von Wright 12 verschiedene Klassen auf und ist ein stark differenziertes Klassenmodell.7 Pierre Bourdieu hat auch sein eigenes Klassenkonzept auf der Grundlage des marxschen Klassenkonzeptes ausgearbeitet. Hier werden insbesondere die Kapitalarten erweitert. So existiert nicht nur das ökonomische Kapital (Vermögen, Eigentum), sondern auch das kulturelle (Bildung, kulturelle Güter) und soziale Kapital (netzwerkliche Beziehungen), wie auch das symbolische Kapital. Die soziale Position einer einzelnen Person wird durch das Kapitalvolumen und der Kapitalstruktur bestimmt.8
Natürlich existieren eine Vielzahl von weiteren Klassenkonzepten in der Soziologie.
3 Becks Individualisierungsthese
Ulrich Beck veröffentlichte erstmals 1984 seinen Artikel: „Jenseits von Stand und Klasse“, in dem er eine individualisierte Arbeitsgesellschaft voraussagt. In diesem Kapitel sollen die zentralen Punkte seiner Theorie vorgestellt und erläutert werden.
Beck analysiert, dass zwar in allen westlichen Industrienationen die Staaten gleichbleibende Ungleichheitsverhältnisse aufweisen, jedoch die Ungleichheitsfragen in keinem klassenspezifischen Kontext mehr betrachtet werden. Dadurch könne die Auffassung vertreten werden, dass die aktuelle Gesellschaft in der BRD sich in keiner Klassengesellschaft mehr befinde. Auf Grundlage dessen stellt Beck folgende These auf: „In allen reichen westlichen Industrieländern- besonders deutlich in der Bundesrepublik- hat sich in der wohlfahrstaatlichen Nachkriegsentwicklung ein gesellschaftlicher Individualisierungsschub [...] und zwar unter dem Deckmantel weitgehend konstanter Ungleichheitsrelation"9 entwickelt.
Dies bedeutet nach Beck, dass die Menschen einen höheren Lebensstandard und eine erhöhte soziale Sicherung aufweisen, aber aus Klassenbindungen herausgelöst werden und eine verstärkt individuelle Arbeitsmarktbeziehung entsteht, welche Chancen aber auch Risiken beinhaltet. Die Individualisierungsschübe im Arbeitsmarktprozess sorgen für eine mögliche Loslösung von Familien- und Berufsbindungen. Das Aufbrechen von Bindungen steht jedoch in Konkurrenz zu Erfahrungen des erlebten Kollektivschicksals am Arbeitsmarkt. Kollektivschicksale drücken sich durch die für alle geltenden Risiken der Lohnarbeit aus, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit.
Nur durch die Verringerung von sozialen Risiken und der Bedingung des Wohlstandes kann diese Konkurrenzsituation zwischen den Individualisierungsschüben und dem Kollektivschicksal zugunsten der Individualisierung aufgehoben werden. Es kommt „zur Auflösung ständisch gefärbter, klassenkultureller Lebenswelten.“10
Ein Individualisierungsprozess kann nach Beck nur eintreten, wenn die materiellen Lebensbedingungen der Arbeiter*innenklasse einen Mindeststandard erreicht haben und sich dadurch Klassenbindungen auflösen. Einhergehen muss dies mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wie, Ausbau des Sozialstaates, Aufstiegschancen (in der Bildung und im Arbeitsmarkt) oder wirtschaftliche Prosperität. Nach Beck sind diese Voraussetzungen durch die wohlfahrstaatliche Nachkriegsentwicklung in der BRD gegeben.11
Dadurch haben sich die Lebensbedingungen seit dem 2. Weltkrieg drastisch verändert, jedoch ist keine wirkliche Veränderung der Ungleichheitsverhältnisse vorangeschritten. Nach Beck ist die entscheidende Entwicklung, dass sich bei gleichbleibender Ungleichheit ein materieller Wohlstand, Bildung, soziale und berufliche Mobilität und die Möglichkeit des Massenkonsums über alle Klassenlagen ausbreitet. Beck verwendet hierfür den Begriff des „FahrstuhlEffektes“. Alle Bevölkerungsschichten fahren mit dem Fahrstuhl eine Etage höher und erhalten zum Beispiel ein höheres Einkommen. Dieser Anstieg sorgt auch dafür, dass Klassenbindungen und Klassenidentitäten eine schwächere Rolle in der Gesellschaft spielen, gleichzeitig aber entsteht ein Prozess der Individualisierung von Lebensstillen und Lebenslagen.12
Ulrich Beck sieht aber nicht nur eine Individualisierung, sondern auch gleichzeitig eine Kollektivierung der Erfahrungen am Arbeitsmarkt. Individualisierung sei ein widersprüchlicher Prozess, da die Personen am Arbeitsmarkt individuell über die Nutzung ihrer Arbeitskraft konkurrieren, dies ist jedoch eine Erfahrung, die alle Personen in gleicher Weise am Arbeitsmarkt teilen. Das Paradoxe ist aber, dass die gemeinsame Erfahrung in der Arbeitsgesellschaft keine kollektivierenden Auswirkungen hat, da diese Erfahrungen individuell verarbeitet werden.13
Ulrich Beck bezeichnet dies als „historisch spezifischer, widersprüchlicher Prozess der Vergesellschaftung“14
Die Dynamik des Arbeitsmarktes erfasst in der Nachkriegsgesellschaft immer mehr Menschen, da immer mehr Personen vom Lohn abhängig sind und die Gruppe von Menschen, welche nicht von der Lohnarbeit abhängig sind, geringer wird. Beck bilanziert, dass aber auch Gemeinsamkeiten für die Gesellschaft anwachsen. Es entstehen in der modernisierten Gesellschaft Risiken, die über alle Einkommenshöhen und Bildungsabschlüssen hinweggehen.15 Die entstehenden und bleibenden Risiken für die Lohnarbeit können erstmal keine Gemeinsamkeiten produzieren. Diese Risiken müssen gesellschaftlich und politisch gelöst werden, dafür aber erst einmal kollektiv anerkannt werden. Diese Anerkennung als gesellschaftliches Problem steht in Konkurrenz zu individuellen Lösungsansätzen. Es „geraten gewerkschaftliche und politische Wahrnehmungs- und Bearbeitungsformen in Konkurrenz zu individualisierenden [...] Betreuungen und Kompensationen“16
3.1 Antriebe der Individualisierung
Beck verweist darauf, dass die bürgerliche Individualisierung im 18. und 19. Jahrhundert insbesondere auf dem Besitz von Kapitalgütern beruhen, sich aber in der BRD eine Arbeitsmarkt-Individualisierung ausbreitet, welche sich in Ausbildung, Anbietung und Arbeitskompetenzen ausdrückt.
Beck verdeutlicht diesen Individualisierungsprozess an den drei auf den Arbeitsmarkt projizierten Komponenten der Bildung, Mobilität, Konkurrenz. Durch die Verlängerung der schulischen Bildung werden traditionelle Denkweisen und Verhaltensmuster aufgelöst und durch allgemeingültige Wissensinhalte und Lernbedingungen verdrängt. Im Bildungsprozess befindet sich auch immer ein Stück Selbstfindungs- und Reflexionsprozess. Als letzten Punkt hält Beck fest, dass Bildung immer auch mit Selektion verbunden ist und individuelle Aufstiegsmöglichkeiten beinhaltet. Die Mobilität (Berufs-, Orts und Arbeitsplatzmobilität), die durch den Arbeitsmarkt ins Laufen gebracht wird, ist ein weiterer Antrieb der Individualisierung der Lebensstille. Mit dem Eintritt in den Arbeitsmarkt, verselbständigen (auf Grund der möglichen beruflichen Mobilität) sich die Lebensläufe der Personen und verlieren an Bindungskraft gegenüber der Familie, Nachbarschaft und Freundschaft. Im Arbeitsmarkt besteht ein Konkurrenzverhältnis zwischen den Personen, da diese jederzeit ausgetauscht werden können. Deswegen stehen diese unter dem Druck die eigene Besonderheit und Leistung hervorzuheben. Diese Konkurrenzsituation führt dazu, dass dort wo noch Gemeinsamkeiten bestehen, diese durch „das Säurebad der Konkurrenz aufgelöst"17 werden. Die drei Aspekte lassen sich nach Beck nicht unabhängig voneinander betrachten, sondern ergänzen und verstärken sich und sind so wichtige Antriebskräfte der Individualisierungsschübe.18
3.2 Pathologien der individualisierten Arbeitsgesellschaft
Beck charakterisiert auch eine Reihe von Strukturen und Gefahren, welche in der individualisierten Arbeitnehmergesellschaft zu Tragen kommen könnten.
Nach Beck führe die individualisierte Gesellschaft dazu, dass „die Menschen immer nachdrücklicher in das Labyrinth der Selbstverunsicherung, Selbstbefragung und Selbstvergewisserung hineingeraten"19 Die Menschen sehen sich permanent mit Fragen zur Selbstreflektion und Selbstverwirklichung konfrontiert, was nach Beck dazu führe, dass die Menschen sich verstärkt aus bekannten Bindungen herauslösen und den herkömmlichen Kontext verlassen.
Die (kritische) Selbstbefragung öffnet auch neue Märkte für Experten, Religionsbewegungen und Industrien.20
Wie schon erwähnt, wurden im Zuge der Individualisierung, die sozialen Ungleichheiten nicht nivelliert, sondern nur umdefiniert. Dadurch werden die sozialen Risiken auf das Individuum abgewälzt, mit der Konsequenz das gesellschaftliche Probleme in persönliche Probleme (Schuldgefühle, Ängste) umgewandelt werden. Dadurch werden gesellschaftliche Krisen als individuelle Krisen wahrgenommen und ihre gesellschaftliche Bedeutung ausgeblendet.21 Dies bedeutet mit anderen Worten, dass gesellschaftliche und politische Probleme privatisiert und auf die individuelle Basis verlagert und nicht als gesamtgesellschaftliches Problem wahrgenommen werden.
Die Menschen sind auch weiterhin zur Bewältigung von politischen Problemen zu Koalitionsbildung mit anderen Menschen und Gruppen gezwungen, da sich aber die Klassenbindungen abschwächen, werden Koalitionen verstärkt themenspezifisch und mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen aus unterschiedlichen Lagern gebildet. Im Zuge der Individualisierung erfahren Konfliktthemen eine neue Form der Pluralisierung und es entstehen neue Koalitionen, Ideologien und Konflikte. Als letzten Punkt benennt Beck, dass dauerhafte Konfliktlinien verstärkt an askriptiven Merkmalen bestehen bleiben. Darunter versteht Beck Merkmale wie Hautfarbe, Geschlecht, Alter, körperliche Behinderung oder ethnische Herkunft. Diese bestehenden sozialen Ungleichheiten erhalten in einer individualisierten Gesellschaft, durch die direkte Wahrnehmbarkeit und den möglichen damit verbundenen Identifikationsprozess, eine erhöhte Bedeutung. Insgesamt wird auch das Leben jedes einzelnen von externen Entwicklungen wie Wirtschaftsaufschwünge oder Wirtschaftskrisen verstärkt bestimmt.2223 Beck stellt sich auch die Frage, ob es der Gesellschaft gelingt, dass die Individuen in einer aufgelösten Klassengesellschaft es schaffen ihre sozialen und politischen Herausforderungen gemeinsam zu lösen, oder ob „im Zuge von Individualisierungsprozessen die letzten Bastionen sozialen und politischen Handelns“ [23]23 wegfallen.
4 Überprüfung der Individualisierungstheorie
In folgendem Kapitel möchte ich die vorgestellten Thesen und Prognosen von Ulrich Beck auf die heutige Gesellschaft im 21. Jahrhundert anwenden. Insbesondere möchte ich mich auf Becks These, dass durch die Wohlstandssteigerung in der Arbeiter*innenklasse sich Klassenerfahrungen und -identitäten auflösen und dadurch eine verstärkte individualisierte Arbeitsgesellschaft entsteht, welche durch soziale Mobilität im Arbeitsprozess ausgedrückt wird.24 Hier soll nun dargestellt werden, inwieweit diese Theorie zutrifft und sich Klassenstrukturen aufgelöst haben. Zeitlich möchte ich mich auf die Entwicklung ab den 2000er Jahren konzentrieren.
Ein erster Punkt der genauer beleuchtet werden soll, ist die Mitgliederentwicklung in Gewerkschaften in Deutschland. Gewerkschaften lassen sich als Interessenvereinigung von abhängig beschäftigten Arbeitnehmer*innen definieren, die das Ziel innehaben die wirtschaftliche und soziale Lage sowie die Lebensbedingung der Arbeitnehmer*innen zu verbessern.25
Damit lässt sich die Organisierung der Arbeitnehmer*innen, als ein Kennzeichen für vorhandene Klassenstrukturen und Klassenorganisation interpretieren. Der Anteil der Arbeitnehmer*innen, welche in einer Gewerkschaft organisiert sind hat sich in den letzten Jahren stark verringert. 1980 waren in der Bundesrepublik noch 32,5% aller Arbeitnehmer*innen in einer Gewerkschaft vertreten, 2004 lag dieser Wert im wiedervereinigten Deutschland nur noch bei 21,2%.26 Dieser Wert pendelt sich in den Jahren danach ein, 2014 waren sogar nur noch 17,5% in einer Gewerkschaft organisiert. Interessant ist hier auch, dass insbesondere die jüngeren Arbeitnehmer*innen seltener eine Mitgliedschaft innehaben.27
Wichtig ist hier zu beachten, dass zwar ungefähr nur jeder fünfte Mitglied in einer Gewerkschaft ist, aber Gewerkschaften trotzdem in der Arbeitnehmerschaft hohe Sympathiewerte aufweisen. In einer Allbus-Umfrage28 im Jahre 2016 sind fast 70% der Auffassung, dass die Arbeitnehmer*innen starke Gewerkschaften benötigen.29 Die Autoren Becker/Hadjar beschäftigen sich in einem Sammelband auch mit Becks Theorie der Auflösung der Klassenverhältnisse und ziehen für ihre Analyse Allbusdaten von 1980 bis 2006 heran. Sie zeigen als ein Ergebnis auf, dass die subjektive Klassenlage in stabiler Beziehung zu der objektiven Einstufung (von Sozialwissenschaftler*innen) ihrer sozialen Herkunft ist. Ein weiteres Ergebnis ist auch, dass die Menschen immer noch „einen Gegensatz zwischen Besitzenden und Arbeitenden wahrnehmen."30
Die Autoren erlangen das Ergebnis, dass von 1980 bis 2006 über alle Kohorten stabile Klasseneinflüsse auf die Sichtweise der Bevölkerung herrschen. Personen aus der oberen Klasse und der Mittelklasse sind geringer überzeugt, dass Klassenunterschiede bestehen. Interessant ist auch, dass sich mit Blick auf die soziale Herkunft die Klassenunterschiede verhärten und sich dies insbesondere bei den jüngeren Kohorten aufzeigt.31
Weitere herausgearbeitet Erkenntnisse sind, dass trotz der Bildungsexpansion starke Ungleichheiten im Bildungsaufstieg herrschen, welche mit der Klassenlage der Eltern erklärt werden können. Damit bleiben über alle Kohorten Herkunftseffekte signifikant für den Bildungsaufstieg. Auch bezogen auf die soziale Mobilität herrschen weiterhin klassenspezifische Ungleichheitsverhältnisse. Zwar hat sich die klassenspezifische Ungleichheit in der Nachkriegsgesellschaft abgebaut, vollkommen aufgelöst wurde sie jedoch nicht. Dies hängt auch damit zusammen, dass sich die herkunftsspezifische Ungleichheit im Bildungsaufstieg auch in herkunftsspezifische Ungleichheit in der Chance der sozialen Mobilität niederschlägt.32
4.1 Die Rückkehr der sozialen Risiken
Betrachten wir Becks These, dass Individualisierungsschübe mit kollektiven Schicksalen im Arbeitsmarktprozess in Konkurrenz stehen und nur durch den Abbau sozialer Risiken und relativem Wohlstand in der Arbeiter*innenklasse sich Klassenspezifische Identitäten auflösen und die Individualisierungsschübe überwinden das Konkurrenzverhältnis. Nach Beck ist relativer Wohlstand und soziale Sicherheit in der Arbeitnehmer*innen-Gesellschaft gewährleistet.33
Robert Castel verfasst in einem Sammelband 2009 einen hoch beachteten Beitrag mit dem Titel: „Die Wiederkehr der sozialen Unsicherheit“, in dem die Mehrheit der europäischen Gesellschaften in den 1960er und 70er Jahren durch soziale Absicherungen von sozialen und gesellschaftlichen Risiken befreit waren. Durch den Sozialstaat wurde ein soziales Absicherungsnetz geformt. Castel stellt klar, dass sich ein Wandel in der Gesellschaft vollzieht und soziale Risiken in der Gesellschaft wiederzurückkehren. Hierfür zeigt er auf, dass atypische Beschäftigungsformen zugenommen haben und stabile Vollzeitarbeit, Arbeitsrecht und soziale Absicherungen erodieren. Dadurch vollziehen sich Prekarisierungsprozesse durch alle Teile der Gesellschaft.34
Unter dem Begriff der Prekarität wird eine Transformation des Arbeitsmarktes charakterisiert, die starke Veränderung der Lohnarbeit (prekäre Lohnarbeit) in Erscheinung treten lässt. Prekäre Lohnarbeit liegt vor, wenn sich die Menschen in Beschäftigungsverhältnissen befinden, welche die üblichen Sicherheitsgarantieren und Rechtsansprüche nicht gewährleisten, also wenn die Beschäftigung und das Einkommen nicht langfristig gesichert sind und Arbeitnehmerrechte nur eigeschränkt gültig sind. Prekäre Beschäftige hoffen in den meisten Fällen, über Umwege in ein stabiles Beschäftigungsverhältnis zu gelangen, anderseits befürchten sie, „sozial abzusteigen und sich dauerhaft mit prekären Beschäftigungsgelegenheiten abfinden zu müssen.“35
Diese oben genannten Theorien der Veränderung der wohlstandgesicherten Lohnarbeit und der sozialen Absicherung hin zu prekären Beschäftigungsverhältnissen, lässt sich auch mit empirischem Erkenntnissen aufzeigen. Die atypischen Erwerbsverhältnisse machen 1997 nur 17,5% aller abhängig Beschäftigten aus, 2007 waren es 25,5% und dieser Wert beinhaltet auch nicht die Vollzeitbeschäftigten und Selbständigen, die eine fallende Lohnentwicklung aufweisen. Im Jahr 2007 verdienen um die 6,5 Millionen Menschen in Deutschland weniger als zwei Drittel des Median-Lohns und auch die Aufstiegschancen im Niedriglohnsektor gehen zurück, obwohl dreiviertel der Beschäftigten im Niedriglohnsektor eine abgeschlossene Berufsausbildung beziehungsweise einen akademischen Abschluss vorweisen können.36 Diese Einkommensgruppen besitzen nach dem OECD-Standard eine Niedriglohnbeschäftigung. Zwischen 1997 und 2007 ist der Anteil der Beschäftigten im Niedriglohnsektor um fast 50% gestiegen. 2007 liegt die Niedriglohnqoute bei 21,5% und ist damit absoluter Spitzenwert im europäischen Vergleich. Von den 6,5 Millionen Menschen, welche 2007 im Niedriglohnsektor tätig sind, sind 67,5% Frauen. Insgesamt sind auch in Deutschland immer mehr Menschen auf sozialstaatliche Hilfeleistungen angewiesen, obwohl sie ein eigenes Einkommen generieren. Eine weitere Entwicklung ist die Zunahme der Leiharbeit, hier ist die Zahl von 1999 bis 2007 um 186 % angewachsen.37
Dies hängt auch mit der Einführung des Hartz 4 Systems als Grundsicherung für Nichtbeschäftigte zusammen und der damit einhergehenden Veränderungen der sozialen Absicherung. Die Einführung des Hartz-Systems führe dazu, dass die prekäre Arbeitslage zunehme, da die Angst des Abstieges am Arbeitsmarkt bis in die Mittelschicht hineinführe. Auch hat Hartz 4 dafür gesorgt, dass Arbeitslose schlechter entlohnte Jobs und schlechte Arbeitsbedingungen verstärkt akzeptieren .38
Diese Zahlen und die Analyse von Robert Castel zeigen auf, dass der vorhandene Wohlstand und die soziale Absicherung in der Arbeitnehmergesellschaft erodiert und immer mehr prekäre Beschäftigungsverhältnisse entstehen und dadurch die sozialen Risiken zurückkehren.
Auf Grund dieser Entwicklung stellt sich die berechtigte Frage, inwieweit die von Beck formulierten Grundvoraussetzungen für ein Individualisierungsprozess aktuell noch gegeben sind, denn der herrschende Wohlstand in der Nachkriegsgesellschaft ist in großen Teilen aktuell nicht mehr vorhanden. Auch der von Ulrich Beck beschriebene Fahrstuhleffekt lässt sich in Frage stellen, da die aktuellen Zahlen zu den Arbeitsverhältnissen und dem Einkommen eher den Anschein erwecken, als würde Teile der Gesellschaft mit dem Fahrstuhl eine Etage nach unten fahren. Eine spannende Frage ist auch, ob sich durch die auftretenden Risiken und dem fallenden Wohlstand Klassenbindungen und Identitäten verstärken?
5 Resümee
Betrachten wir Becks Theorie, dass sich in im Zuge der Wohlstandssteigerung und der Verringerung der sozialen Risiken in den Arbeitnehmerverhältnisse, die Klassenstrukturen auflösen und sich eine individualisierte Arbeitsgesellschaft entwickelt, mit den im letzten Kapitel aufgezählten Aspekten, dann stellt sich ein ambivalentes Bild heraus. Auf der einen Seite ist die gewerkschaftliche Organisation in den letzten dreißig Jahren erheblich zurückgegangen, jedoch befürworten ein großer Teil der Arbeitnehmer*innen eine starke Gewerkschaft. Weitere oben zitierten Ergebnisse zeigen auf, dass weiterhin in der Bevölkerung die Überzeugung herrscht, dass klassenspezifische Unterschiede existieren und diese Überzeugungen insbesondere in den unteren Bevölkerungsschichten verstärkt ausgeprägt sind. Der stärkste Punkt, welcher der Individualisierungsthese widerspricht, ist, dass insbesondere ab den 2000er Jahren die sozialen Risiken am Arbeitsmarkt wieder zugenommen haben und dass sich verstärkt prekäre Arbeit in der Gesellschaft etabliert hat. Insbesondere durch diesen Punkt lässt sich ernsthaft debattieren, wie weit Ulrichs Becks These noch zutreffend ist, da durch die verstärkte Prekarisierung und dem Abbau sozialstaatlicher Sicherungssysteme, das Konkurrenzverhältnis zwischen Individualisierung und Kollektiverfahrungen theoretisch nicht aufgehoben ist. Interessant wäre es, sich jetzt mit der Frage zu beschäftigen, inwieweit diese Verstärkung der sozialen Risiken in den 2000er Jahren auch zu einer Verstärkung der Klassenidentitäten führt oder ob sich trotzdem Individualisierungsschübe in der Arbeitsgesellschaft vollziehen.
Insbesondere mit der Überlegung, dass auch in der heutigen Zeit ein verstärktes Konkurrenzverhältnis zwischen den Personen am Arbeitsmarkt besteht und auch durch die Verstärkung der Prekarität eine verstärkte Angst vor dem sozialen und gesellschaftlichen Abstieg herrscht.39
Auf Grund des Umfangs und der Vielzahl von spannenden Punkten, welche Ulrich Beck in seiner Theorie aufweist, wurde sich hier nur auf den Aspekt der Auflösung der Klassengesellschaft konzentriert. Aber auch die Frage inwieweit die von Beck, prognostizierten Risiken und Gefahren einer individualisierten Gesellschaft, in der heutigen Gesellschaft wiederfinden, ist eine Überprüfung wert. Werden aktuelle Probleme auf gesellschaftlicher Basis oder mit individualistischen Lösungsansätzen behandelt. Eine spannende Untersuchung wäre hier, wie aktuelle Gesellschaften zum Beispiel mit der Thematik des Burnouts im Arbeitsleben umgehen.
Beck diagnostiziert auch, dass in einer individualisierten Gesellschaft dauerhafte Konfliktlinien verstärkt an askriptiven Merkmalen wie Geschlecht, Ethnie oder Hautfarbe bestehen bleiben. Diese These gewinnt durch die Etablierung der rechtspopulistischen AfD im deutschen Parteiensystem an Aussagekraft, da die AfD in ihrer Programmatik eine restriktive Migrationsund Zuwanderungspolitik fordert und auch entschieden konservative Positionen in der Geschlechterpolitik vertritt.40
Doch eine inhaltlich vertiefende Analyse mit den angeschnittenen Aspekten würden eine weitere eigenständige Hausarbeit beinhalten.
6 Literaturverzeichnis
- Adamy, Wilhelm: Hartz 4- Achillesferse der Arbeits- und Sozialhilfepolitik, in: Bispinck, Reinhard et. al. (Hrsg.): Sozialpolitik und Sozialstaat. Festschrift für Gerhard Becker, Wiesbaden 2012. S. 257-291
- Beck, Ulrich: „Jenseits von Stand und Klasse. Auf dem Weg in die individualisierte Arbeitnehmergesellschaft“, in: Merkur, 38 Jg., 1984. S. 485-497.
- Ulrich Beck : Jenseits von Stand und Klasse, in: Beck, Ulrich/ Beck-Gernsheim: Riskante Freiheiten, Frankfurt am Main, 1994. S. 43-60.
- Beck, Ulrich: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt am Main, 1986.
- Becker, Rolf/ Hadjar, Andreas: Das Ende von Stand und Klasse? 25 Jahre theoretische Überlegungen und empirische Betrachtungen aus der Perspektive von Lebensläufen unterschiedlicher Kohorten, in: Berger, Peter A./ Hitzler Ronald (Hrsg.): Individualisierungen. Ein Vierteljahrhundert jenseits von Stand und Klasse, Wiesbaden, 2010. S. 51-72.
- Berndt, Keller: Einführung in die Arbeitspolitik. Arbeitsbeziehungen und Arbeitsmarkt in sozialwissenschaftlicher Perspektive, 7. Überarbeitete Auflage, München, 2008
- Burzan, Nicole: Soziale Ungleichheit. Eine Einführung in die zentralen Theorien, 4. Auflage, Wiesbaden 2011.
- Castel, Robert: Die Wiederkehr der sozialen Unsicherheit, in: Castel, Robert/ Dörre, Klaus: Prekarität, Abstieg, Ausgrenzung. Die soziale Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts, Frankfurt/Main, 2009. S.21-34.
- Dörre, Klaus: Prekarität im Finanzmarktkapitalismus, in: : Castel, Robert/ Dörre, Klaus: Prekarität, Abstieg, Ausgrenzung. Die soziale Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts, Frankfurt/Main, 2009. S. 35-65.
- Friedrich, Engels/Marx, Karl: Manifest der kommunistischen Partei, in: Solga, Heike/Powell, Justin/Berger, Peter A. (Hrsg.): Soziale Ungleichheit. Klassische Texte zur Sozialstrukturanalyse, Frankfurt am Main, 2009. S.75-84.
- Junge, Matthias : Individualisierung, Frankfurt/Main, 2002.
- Kraemer, Klaus: Prekarisierung. Jenseits von Stand und Klasse, in: Castel, Robert/ Dörre, Klaus: Prekarität, Abstieg, Ausgrenzung. Die soziale Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts, Frankfurt/Main, 2009. S. 241-255.
- Scherschel, Karin/ Booth, Melanie: Aktivierung in die Prekarität. Folgen der Arbeitsmarktpolitik in Deutschland, in: Scherschel, Karin/Steckeisen, Peter/Krenn, Manfred: Neue Prekarität. Die Folgen aktivierender Arbeitsmarktpolitik-europäische Länder im Vergleich, Frankfurt am Main 2012. S. 17-46.
Internetquellen
- Biebeler, Hendrik/ Lesch, Hagen: „Mitgliederstruktur der Gewerkschaften in Deutschland", in: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/156922/1/iw-trends-v33- i4-a4.pdf; zuletzt überprüft am 10.04.2021.
- Biebeler, Hendrik/ Lesch, Hagen: „Organisationsdefizite der deutschen Gewerkschaft", in:https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2015/heft/10/beitrag/organisationsdefi zite-der-deutschen-gewerkschaften.html; zuletzt überprüft am 10.04.2021.
- Decker, Frank: „Die Programmatik der AfD", in: https://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in- deutschland/afd/273132/programmatik; zuletzt überprüft am 13.04.2021.
- Schneider, Helena: „Ja bitte, aber ohne mich!", in: https://www.iwkoeln.de/studien/iw- kurzberichte/beitrag/helena-schneider-ja-bitte-aber-ohne-mich-411019.html; zuletzt überprüft am 10.04.2021
Fußnoten
- 1 Vgl. Rühle, Alex: „Die Risiken sind dramatisch ungleich verteilt“, in: https://www.sueddeutsche.de/kultur/corona-klassengesellschaft-deutschland-uk-1.5230041; zuletzt überprüft am 14.04.2021.
- 2 Vgl. Beck, Ulrich: „Jenseits von Stand und Klasse. Auf dem Weg in die individualisierte Arbeitnehmergesellschaft“, in: Merkur, 38 Jg., 1984. S. 485-497. Hier S. 486.
- 3 Vgl. Beck, Ulrich, Ulrich Beck : Jenseits von Stand und Klasse, in: Beck, Ulrich/ Beck-Gernsheim: Riskante Freiheiten, Frankfurt am Main, 1994. S. 43-60. Hier S.44.
- 4 Vgl. Friedrich, Engels/Marx, Karl: Manifest der kommunistischen Partei, in: Solga, Heike/Powell, Justin/Berger, Peter A. (Hrsg.): Soziale Ungleichheit. Klassische Texte zur Sozialstrukturanalyse, Frankfurt am Main, 2009. S.7584. hier S. 75.
- 5 Vgl. Burzan, Nicole: Soziale Ungleichheit. Eine Einführung in die zentralen Theorien, 4. Auflage, Wiesbaden 2011. S. 16-17.
- 6 Vgl. Burzan, Nicole: Soziale Ungleichheit, S. 17.
- 7 Vgl. Burzan, Nicole: Soziale Ungleichheit, S. 79 f.
- 8 Vgl. Burzan, Nicole: Soziale Ungleichheit, S. 125 f.
- 9 Vgl. Beck, Ulrich: „Jenseits von Stand und Klasse. Auf dem Weg in die individualisierte Arbeitnehmergesellschaft", S. 486.
- 10 Vgl. Beck, Ulrich: Jenseits von Stand und Klasse, S. 44.
- 11 Vgl. Beck, Ulrich: „Jenseits von Stand und Klasse. Auf dem Weg in die individualisierte Arbeitnehmergesellschaft“, S. 489.
- 12 Vgl. Beck, Ulrich: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt am Main, 1986. S. 122.
- 13 Vgl. Junge, Matthias: Individualisierung, Frankfurt/Main, 2002. S. 54 f.
- 14 Vgl. Beck, Ulrich: Jenseits von Stand und Klasse, S.45.
- 15 Ulrich Beck geht hier in seinem sehr bekannten und oft rezipierten Werk u Risikogesellschaft genauer und detaillierter darauf ein. Insbesondere analysiert er, dass insbesondere ökologische Krisen in Zukunft alle Bevölkerungsschichten betreffen.
- 16 Vgl. Beck, Ulrich: „Jenseits von Stand und Klasse. Auf dem Weg in die individualisierte Arbeitnehmergesellschaft“ S. 493.
- 17 Vgl. Beck, Ulrich : Jenseits von Stand und Klasse, S. 48.
- 18 Vgl. Beck, Ulrich: Jenseits von Stand und Klasse, S. 47 f.
- 19 Vgl. Beck, Ulrich: „Jenseits von Stand und Klasse. Auf dem Weg in die individualisierte Arbeitnehmergesellschaft" S. 494.
- 20 Vgl. Ebd. 8
- 21 Vgl. Beck, Ulrich: „Jenseits von Stand und Klasse. Auf dem Weg in die individualisierte Arbeitnehmergesellschaft“ , S. 497.
- 22 Vgl. Beck, Ulrich: „Jenseits von Stand und Klasse. Auf dem Weg in die individualisierte Arbeitnehmergesellschaft“, S. 497.
- 23 Vgl. Ebd.
- 23 Vgl. Ebd.
- 24 Vgl. Beck, Ulrich: „Jenseits von Stand und Klasse. Auf dem Weg in die individualisierte Arbeitnehmergesellschaft “, S. 486.
- 25 Vgl. Berndt, Keller: Einführung in die Arbeitspolitik. Arbeitsbeziehungen und Arbeitsmarkt in sozialwissenschaftlicher Perspektive, 7. Überarbeitete Auflage, München, 2008. S. 37.
- 26 Vgl. Biebeler, Hendrik/ Lesch, Hagen: „Mitgliederstruktur der Gewerkschaften in Deutschland“, in: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/156922/1/iw-trends-v33-i4-a4.pdf; zuletzt überprüft am 10.04.2021.
- 27 Vgl. Biebeler, Hendrik/ Lesch, Hagen: „Organisationsdefizite der deutschen Gewerkschaft“, in: https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2015/heft/10/beitrag/organisationsdefizite-der-deutschen- gewerkschaften.html; zuletzt überprüft am 10.04.2021.
- 28 Allbus steht für die Allgemeine Bevölkerungsumfrage in Deutschland und durch das Allbus-Programm werden seit 1980 Bevölkerungsumfragen durchgeführt.
- 29 Vgl. Schneider, Helena: „Ja bitte, aber ohne mich!", in: https://www.iwkoeln.de/studien/iw- kurzberichte/beitrag/helena-schneider-ja-bitte-aber-ohne-mich-411019.html; zuletzt überprüft am 10.04.2021.
- 30 Vgl. Becker, Rolf/ Hadjar, Andreas: Das Ende von Stand und Klasse? 25 Jahre theoretische Überlegungen und empirische Betrachtungen aus der Perspektive von Lebensläufen unterschiedlicher Kohorten, in: Berger, Peter A./ Hitzler Ronald (Hrsg.): Individualisierungen. Ein Vierteljahrhundert jenseits von Stand und Klasse, Wiesbaden, 2010. S. 51-72. Hier S. 64.
- 31 Vgl. Becker/Hadjar: Das Ende von Stand und Klasse ? S. 65.
- 32 Vgl. Becker/ Hadjar: Das Ende von Stand und Klasse? S. 60 ff.
- 33 Vgl. Ulrich, Beck: „Jenseits von Stand und Klasse . Auf dem Weg in die individualisierte Arbeitnehmergesellschaft“: S. 487.
- 34 Vgl. Castel, Robert: Die Wiederkehr der sozialen Unsicherheit, in: Castel, Robert/ Dörre, Klaus: Prekarität, Abstieg, Ausgrenzung. Die soziale Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts, Frankfurt/Main, 2009. S.21-34.
- 35 Vgl. Kraemer, Klaus: Prekarisierung. Jenseits von Stand und Klasse, in: Castel, Robert/ Dörre, Klaus: Prekarität, Abstieg, Ausgrenzung. Die soziale Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts, Frankfurt/Main, 2009. S. 241-255. Hier. S.42.
- 36 Vgl. Dörre, Klaus: Prekarität im Finanzmarktkapitalismus, in: : Castel, Robert/ Dörre, Klaus: Prekarität, Abstieg, Ausgrenzung. Die soziale Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts, Frankfurt/Main, 2009. S. 35-65.hier S.46.
- 37 Vgl. Scherschel, Karin/ Booth, Melanie: Aktivierung in die Prekarität. Folgen der Arbeitsmarktpolitik in Deutschland, in: Scherschel, Karin/Steckeisen, Peter/Krenn, Manfred: Neue Prekarität. Die Folgen aktivierender Arbeitsmarktpolitik-europäische Länder im Vergleich, Frankfurt am Main 2012. S. 17-46. Hier S. 35.f.
- 38 Vgl. Adamy, Wilhelm: Hartz 4- Achillesferse der Arbeits- und Sozialhilfepolitik, in: Bispinck, Reinhard et. al. (Hrsg.): Sozialpolitik und Sozialstaat. Festschrift für Gerhard Becker, Wiesbaden 2012. S. 257-291. Hier S. 274 f.
- 39 Vgl. Dörre, Klaus: Prekarität im Finanzmarktkapitalismus, S. 47 f.
- 40 Vgl. Decker, Frank: „Die Programmatik der AfD", in: https://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in- deutschland/afd/273132/programmatik; zuletzt überprüft am 13.04.2021.
Häufig gestellte Fragen
- Was ist das Hauptthema des Textes?
- Der Text analysiert die These von Ulrich Beck zur Individualisierung der Arbeitsgesellschaft in Deutschland, insbesondere im Kontext der sich ändernden Klassenstrukturen und sozialen Risiken. Es wird untersucht, ob Becks Theorie, dass Wohlstand und soziale Sicherheit zu einer Auflösung von Klassenidentitäten führen, noch auf die heutige Gesellschaft zutrifft.
- Welche Klassenbegriffe werden im Text behandelt?
- Der Text behandelt verschiedene Klassenbegriffe, darunter die von Karl Marx (Bourgeoisie und Proletariat), Erik Olin Wright (widersprüchliche Klassenlagen) und Pierre Bourdieu (Kapitalarten wie ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital).
- Was ist Becks Individualisierungsthese?
- Becks These besagt, dass trotz gleichbleibender Ungleichheitsverhältnisse in westlichen Industrienationen eine Individualisierungsschub stattgefunden hat. Dies bedeutet, dass Menschen aus Klassenbindungen herausgelöst werden und eine verstärkt individuelle Arbeitsmarktbeziehung entsteht, welche Chancen aber auch Risiken beinhaltet.
- Welche Antriebe der Individualisierung werden von Beck genannt?
- Beck identifiziert Bildung, Mobilität und Konkurrenz als Hauptantriebe der Individualisierung im Arbeitsmarktprozess. Diese Faktoren führen zur Auflösung traditioneller Denkweisen und Verhaltensmuster sowie zur Verselbstständigung von Lebensläufen.
- Welche Pathologien einer individualisierten Arbeitsgesellschaft werden von Beck beschrieben?
- Beck warnt vor Selbstverunsicherung, der Abwälzung sozialer Risiken auf das Individuum und der Privatisierung gesellschaftlicher Probleme. Er betont auch, dass dauerhafte Konfliktlinien an askriptiven Merkmalen wie Hautfarbe oder Geschlecht bestehen bleiben können.
- Inwieweit hat sich die gewerkschaftliche Organisation verändert?
- Der Text zeigt, dass die gewerkschaftliche Organisation in Deutschland in den letzten Jahrzehnten erheblich zurückgegangen ist. Gleichzeitig befürworten viele Arbeitnehmer*innen aber weiterhin starke Gewerkschaften.
- Hat sich die subjektive Wahrnehmung von Klassenunterschieden verändert?
- Trotz der Individualisierungstendenzen nehmen viele Menschen weiterhin Klassenunterschiede wahr, insbesondere in den unteren Bevölkerungsschichten. Klasseneinflüsse auf die Sichtweise der Bevölkerung sind laut Allbusdaten von 1980 bis 2006 weitestgehend stabil geblieben.
- Wie haben sich soziale Risiken im Arbeitsmarkt entwickelt?
- Der Text argumentiert, dass soziale Risiken im Arbeitsmarkt seit den 2000er Jahren wieder zugenommen haben. Dies wird durch die Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse, fallende Löhne und den Abbau sozialstaatlicher Sicherungssysteme belegt.
- Was sind die Auswirkungen von Hartz IV auf den Arbeitsmarkt?
- Die Einführung von Hartz IV hat laut dem Text zu einer Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse geführt, da die Angst vor dem sozialen Abstieg verstärkt wird und Arbeitslose schlechter entlohnte Jobs akzeptieren müssen.
- Welche Schlussfolgerungen zieht der Text hinsichtlich Becks Individualisierungsthese?
- Der Text kommt zu dem Schluss, dass Becks Individualisierungsthese angesichts der Zunahme sozialer Risiken und der Etablierung prekärer Arbeit in Frage gestellt werden muss. Es stellt sich die Frage, ob die Voraussetzungen für die Individualisierung, wie sie Beck beschreibt, noch gegeben sind, und ob sich Klassenbindungen und -identitäten möglicherweise wieder verstärken.
- Welche weiteren Forschungsfragen werden angeregt?
- Der Text regt an, zu untersuchen, inwieweit die Verstärkung sozialer Risiken zu einer Verstärkung von Klassenidentitäten führt, und wie aktuelle gesellschaftliche Probleme (z.B. Burnout) behandelt werden. Auch die Frage, ob Konfliktlinien an askriptiven Merkmalen bestehen bleiben, wird als relevant angesehen.
- Quote paper
- Johannes Mangold (Author), 2020, Ulrich Becks Individualisierungstheorie im 21. Jahrhundert. Jenseits von Stand und Klasse?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1190663