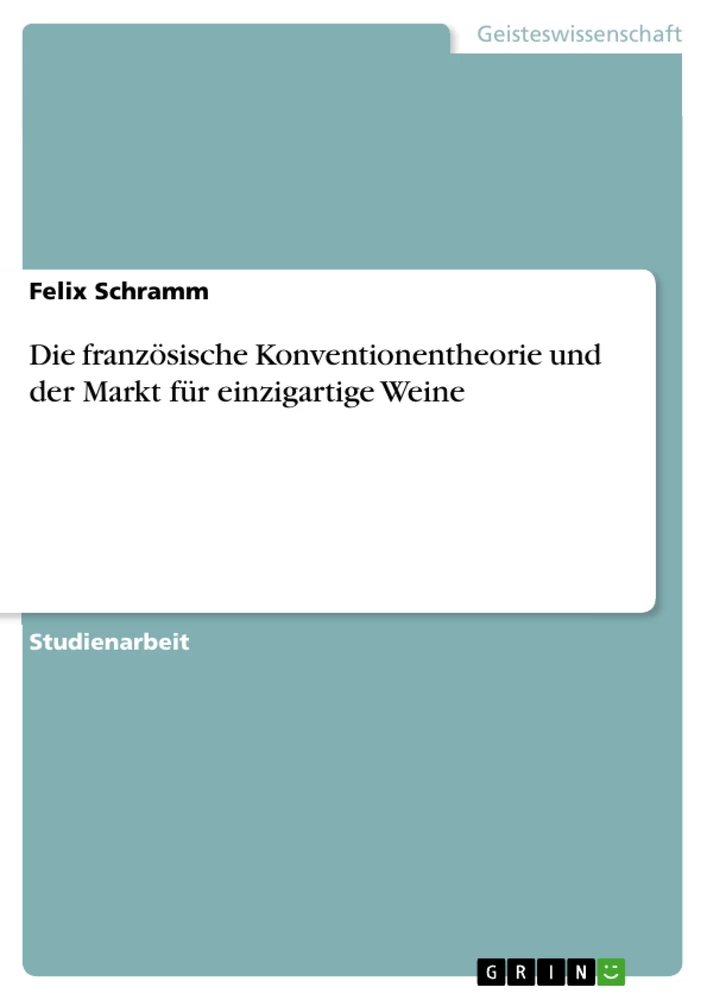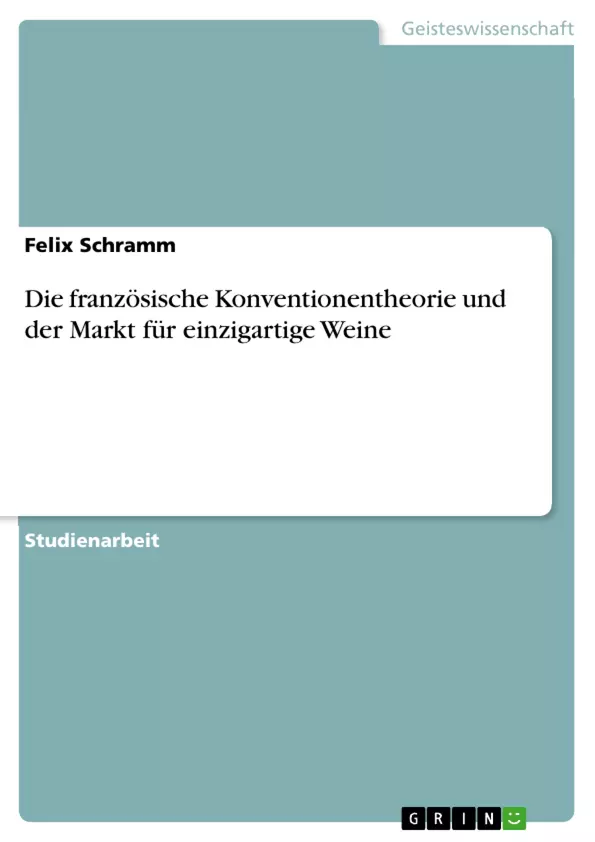Diese Hausarbeit hat nicht das konventionelle Ziel, eine Fragestellung durch die ganze Arbeit hinweg zu diskutieren, um dann gegen Ende eine eigene Beurteilung der Sachlage zu geben. Vielmehr geht es darum, einen tieferen Einblick in die Soziologie der Konventionen zu ermöglichen, die in Frankreich ein Konjunkturhoch verzeichnet, aber in Deutschland recht spärlich rezipiert wird. Um diesem Problem auf studentischer Ebene entgegenzuwirken, wurde diese Hausarbeit verfasst.
Diese Arbeit hat das Ziel, einen Überblick über die Grundzüge dieses Theoriezweiges im ersten Hauptkapitel allgemeinsoziologisch und im zweiten Kapitel wirtschaftssoziologisch darzulegen, um im dritten Kapitel der Frage nachzugehen, welche Rolle Urteils- und Bewertungsinstitutionen beim Markt für besondere Weine einnehmen können. Hier bildet die einschlägige Monographie von Lucien Karpik "Mehr Wert" die Literaturgrundlage, in der er den Markt für singuläre Güter, also einzigartigen Produkten und Dienstleistungen, im Kontext der Neuen Französischen Sozialwissenschaften analysiert und seine Besonderheiten im Bezug zu allgemeinen und kommerziellen Gütern erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Soziologie der kritischen Kompetenzen
- Von Äquivalenzen und Koordinationsregimen
- "Welten" als Rechtfertigungsordnungen
- Konventionentheorie in der Wirtschaftsanalyse
- Definitorische Annäherung
- Qualitätskonventionen
- Der Markt für besondere Weine
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, die Konventionstheorie in ihren grundlegenden Aspekten vorzustellen und ihre Anwendung im Kontext des Marktes für besondere Weine zu analysieren. Die Arbeit untersucht, wie Urteils- und Bewertungsinstrumente in diesem Markt funktionieren und welche Rolle Konventionen dabei spielen.
- Soziologie der kritischen Kompetenzen nach Boltanski und Thévenot
- Konventionentheorie und deren Anwendung in der Wirtschaftsanalyse
- Qualitätskonventionen im Markt für besondere Weine
- Der Einfluss von Urteils- und Bewertungsinstrumente auf den Markt
- Analyse von "Mehr Wert" von Lucien Karpik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Relevanz des Themas der Qualitätswahrnehmung im Markt für einzigartige Produkte dar und führt in die Konventionstheorie als Analyseansatz ein.
- Die Soziologie der kritischen Kompetenzen: Dieses Kapitel erklärt die grundlegenden Konzepte der kritischen Kompetenzen nach Boltanski und Thévenot und beschreibt, wie Akteure Konflikte anhand von Rechtfertigungsordnungen und Koordinationsregimen austragen.
- Konventionentheorie in der Wirtschaftsanalyse: Dieses Kapitel beleuchtet die Konventionstheorie im Kontext der Wirtschaftswissenschaften und erläutert den Begriff der Qualitätskonventionen.
- Der Markt für besondere Weine: Dieses Kapitel untersucht den Markt für einzigartige Weine im Kontext der Konventionstheorie und analysiert die Rolle von Urteils- und Bewertungsinstrumenten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Konventionstheorie, der Soziologie der kritischen Kompetenzen, Qualitätskonventionen, dem Markt für besondere Weine, "Mehr Wert" von Lucien Karpik und dem Einfluss von Urteils- und Bewertungsinstrumenten auf die Wahrnehmung von Qualität.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die „Soziologie der Konventionen“?
Es handelt sich um einen in Frankreich populären Theoriezweig, der untersucht, wie Akteure ihr Handeln durch geteilte Regeln und Rechtfertigungsordnungen (Konventionen) koordinieren.
Wer sind die Hauptvertreter dieser Theorie?
Die Arbeit bezieht sich maßgeblich auf Luc Boltanski und Laurent Thévenot („Über die Rechtfertigung“) sowie auf Lucien Karpik.
Was versteht man unter „singulären Gütern“?
Singuläre Güter sind einzigartige Produkte oder Dienstleistungen, deren Qualität nicht standardisiert ist, wie zum Beispiel besondere Weine.
Welche Rolle spielen Urteils- und Bewertungsinstitutionen?
In Märkten für singuläre Güter helfen diese Institutionen (z.B. Weinführer oder Kritiker) den Konsumenten, die Qualität einzuschätzen und Orientierung zu finden.
Was sind Qualitätskonventionen im Weinmarkt?
Dies sind geteilte Vorstellungen darüber, was einen „guten“ Wein ausmacht, die als Grundlage für Preisbildung und Marktkoordination dienen.
Welches Buch bildet die Literaturgrundlage für das Wein-Beispiel?
Die Arbeit stützt sich auf die Monographie „Mehr Wert“ von Lucien Karpik, in der er den Markt für singuläre Güter analysiert.
- Quote paper
- Felix Schramm (Author), 2018, Die französische Konventionentheorie und der Markt für einzigartige Weine, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1190720