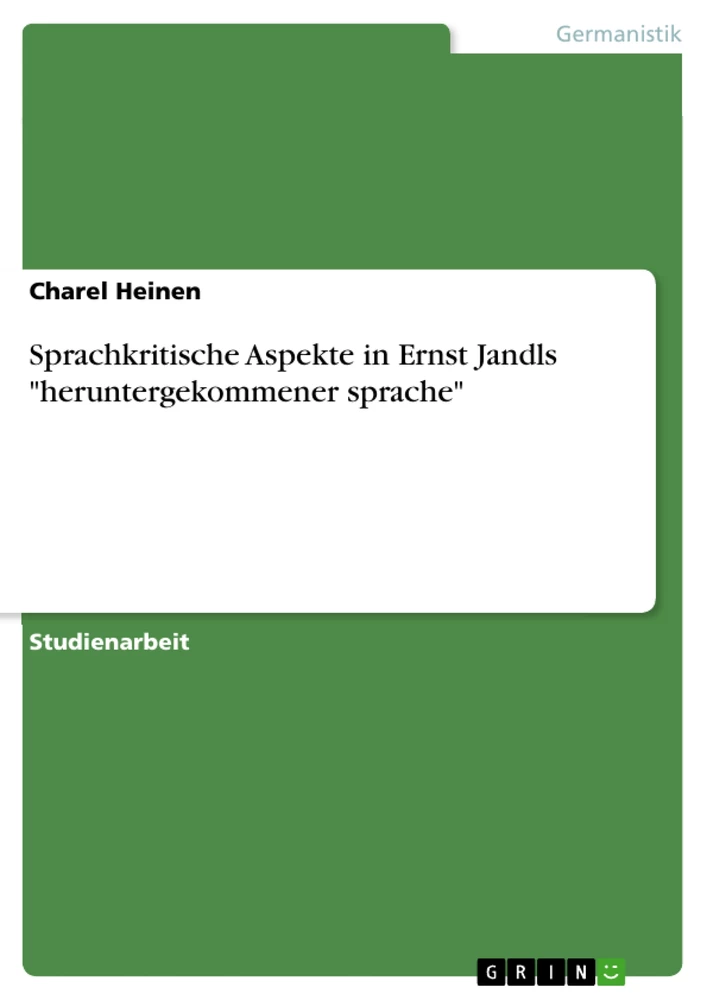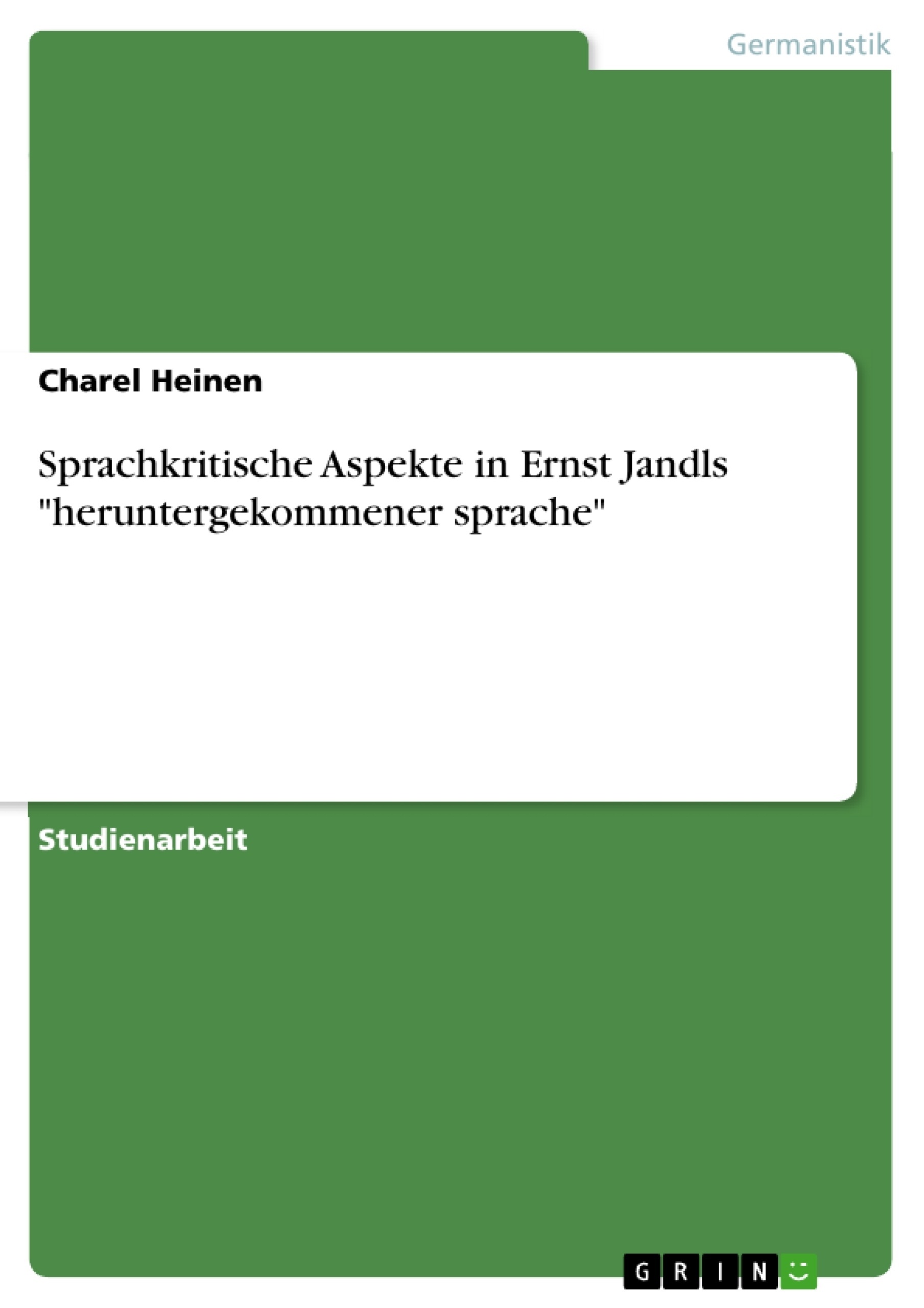Diese Arbeit bietet eine Übersicht verschiedener sprachwissenschaftlicher Perspektiven zu Ernst Jandls Gedichten in "heruntergekommener sprache". Als Gegenstand dient hier vor allem der Band "die bearbeitung der mütze".
Für einen experimentellen Dichter wie Ernst Jandl ist das Spiel mit der Sprache eine zentrale, wenn nicht sogar die zentrale Herangehensweise für das dichterische Schaffen. Durch ebendiese Herangehensweise entwickelten sich während der Schaffenszeit Jandls verschiedene Konzepte, die man teilweise schon als eigene Untergattungen verstehen kann. Die ständige Suche nach neuen poetischen Ausdrucksformen und Techniken zieht sich durch Jandls Gesamtwerk.
Während den 60er Jahren feierte er mit seinen Lautgedichten aus dem Band "laut und luise" immense Erfolge bei einem breiteren Publikum. Etwas, das nur die wenigsten vergleichbaren Autoren der literarischen Avantgarde von sich behaupten konnten.
Spätere Bände wie "der künstliche baum" oder "sprechblasen" knüpfen mit den visuellen Gedichten an Konzepte der konkreten Poesie an. Doch auch in dieser Schublade wollte Jandl es sich nicht bequem machen, weshalb er sich - mit einem gewissen Augenzwinkern - von dieser Bewegung distanzierte.
In der vorliegenden Arbeit soll nun die Beschaffenheit Jandls "heruntergekommener sprache" sprachwissenschaftlich untersucht werden. Die Arbeit soll in ihrem überschaubaren Umfang jedoch keine vollständige sprachliche Analyse des Gegenstands bieten, sondern eine Übersicht verschiedener linguistischer Perspektiven liefern, aus denen Jandls Gedichte in "heruntergekommener sprache" zu verstehen sind und zu einer sprachkritischen Reflexion anregen.
Als Gegenstand der Untersuchung dienen die Gedichte aus dem Band "die bearbeitung der mütze", mit besonderem Fokus auf den darin enthaltenen Zyklus "tagenglas".
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die sprachlichen Eigenschaften einer heruntergekommenen sprache
- Typographie
- Syntax
- Syntaktischer Primitivismus
- Variabilität
- Wortbildung
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der sprachlichen Beschaffenheit von Ernst Jandls „heruntergekommener sprache“, die er in seinen Gedichten, insbesondere im Zyklus „tagenglas“ aus dem Band „die bearbeitung der mütze“, verwendet. Die Arbeit zielt darauf ab, eine Übersicht verschiedener linguistischer Perspektiven zu liefern, aus denen Jandls Gedichte in heruntergekommener sprache zu verstehen sind und zu einer sprachkritischen Reflexion anzuregen.
- Analyse der sprachlichen Besonderheiten von Jandls „heruntergekommener sprache“
- Bedeutung der Typographie für die Darstellung von „Heruntergekommenheit“
- Die Rolle der Syntax in der Konstruktion von Bedeutung und Ambiguität
- Untersuchung des Einflusses von Jandls Sprachspiel auf die Themen und Inhalte der Gedichte
- Kritische Reflexion über die sprachliche und inhaltliche Bedeutung der „heruntergekommenen sprache“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der „heruntergekommenen sprache“ in Ernst Jandls Werk ein und erläutert die zentrale Rolle von Sprachspielen in seinem dichterischen Schaffen. Sie beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Konzepts, seine Verbindung zu Jandls Lebensrealität und die besondere Ausdruckskraft der Gedichte, die diese Sprache verwenden.
Die sprachlichen Eigenschaften einer heruntergekommenen sprache
Dieses Kapitel analysiert die sprachlichen Merkmale der „heruntergekommenen sprache“ im Detail. Es behandelt die Typographie, die Syntax, die Variabilität und die Wortbildung in Jandls Gedichten. Der Fokus liegt dabei auf den besonderen Aspekten, die diese Sprache von der „normalen“ Sprache abheben und die „Heruntergekommenheit“ auf sprachlicher Ebene visualisieren.
Schlussfolgerung
Die Schlussfolgerung des Textes fasst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen und diskutiert die Bedeutung der „heruntergekommenen sprache“ für Jandls Werk und die literarische Tradition. Sie beleuchtet die sprachkritische Dimension des Konzepts und dessen Potential, neue Ausdrucksformen zu ermöglichen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die sprachwissenschaftliche Analyse von Ernst Jandls „heruntergekommener sprache“ im Kontext seiner Gedichte. Die Schlüsselwörter umfassen Themen wie sprachkritische Reflexion, experimentelle Poetik, Typographie, Syntax, Sprachspiel, literarische Avantgarde, konzeptionelle Poesie und poetische Ausdrucksformen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Ernst Jandl unter „heruntergekommener sprache“?
Es handelt sich um ein poetisches Konzept, bei dem Sprache durch bewusste Verstöße gegen Grammatik und Syntax in ihrer Form reduziert oder „beschädigt“ dargestellt wird, um neue Ausdrucksformen zu finden.
Welcher Gedichtband steht im Zentrum der Untersuchung?
Der Band „die bearbeitung der mütze“, insbesondere der darin enthaltene Zyklus „tagenglas“.
Welche Rolle spielt die Typographie in Jandls Werk?
Die Typographie dient dazu, die „Heruntergekommenheit“ der Sprache visuell erfahrbar zu machen und unterstützt die experimentelle Form der Gedichte.
Was ist syntaktischer Primitivismus?
Ein Stilmittel, bei dem einfache, oft fehlerhafte oder verkürzte Satzstrukturen genutzt werden, um eine bestimmte ästhetische Wirkung oder eine Sprachkritik zu erzielen.
Wie grenzt sich Jandl von der Konkreten Poesie ab?
Obwohl er visuelle Gedichte verfasste, distanzierte er sich oft mit einem Augenzwinkern von starren Bewegungen, um seine künstlerische Freiheit zu bewahren.
- Citar trabajo
- Charel Heinen (Autor), 2021, Sprachkritische Aspekte in Ernst Jandls "heruntergekommener sprache", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1190914