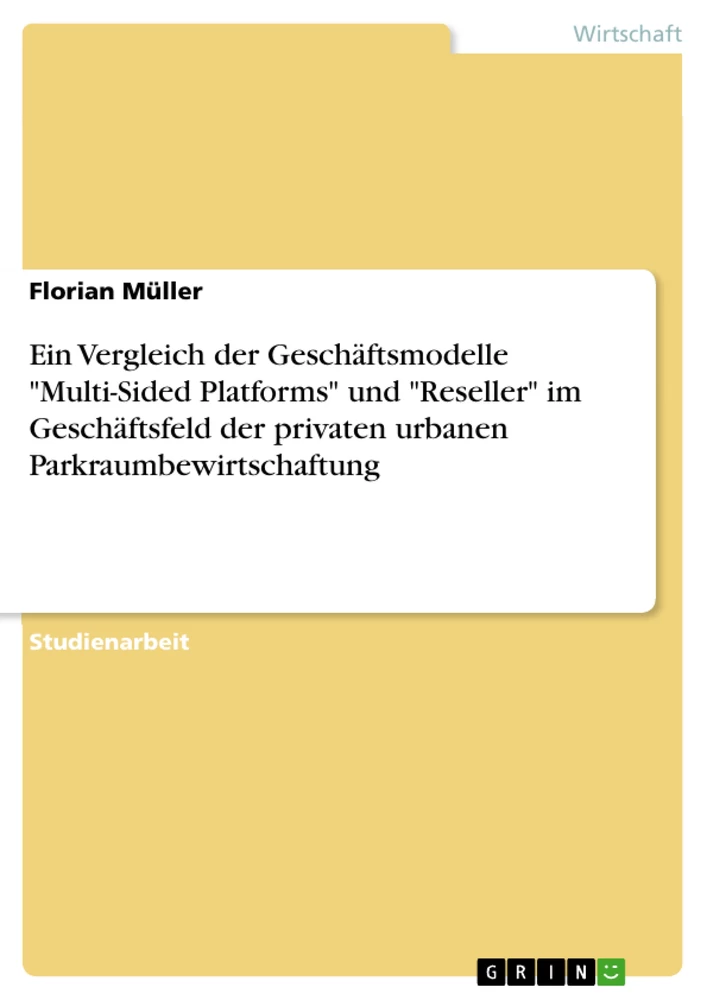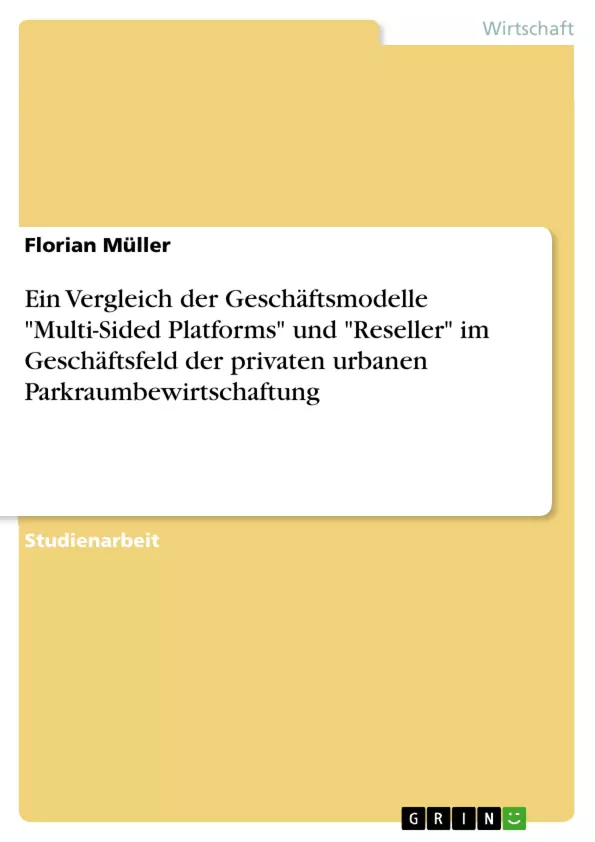Ist das Reseller- oder MSP-Geschäftsmodell für einen nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg im Geschäftsfeld der privaten urbanen Parkraumbewirtschaftung besser geeignet?
Deutschland setzte sich im Juni 2021 erneut neue Klima- und Nachhaltigkeitsziele für die nahe Zukunft, um die Existenzsicherung und eine hohe Lebensqualität der Bürger weiterhin gewährleisten zu können. Dahingehend müssen unter anderem große Anpassungen in der Mobilität des Landes getroffen werden.
Besonders der Verkehrssektor wirkt sich in der Mobilität negativ auf die Lebensqualität der Bürger aus. Vor allem die urbanen Regionen wie innerstädtische Ballungsräume in Großstädten unterliegen einer hohen Lärm- und Umweltbelastung durch ein zunehmendes motorisiertes Verkehrsaufkommen. Zudem übersteigt die Nachfrage nach Parkflächen das Angebot der urbanen Ballungsräume. Aus diesem Nachfrageüberschuss resultiert ein Parkplatzmangel, der zu einer Belästigung der urbanen Anwohner durch Falsch- und Dauerparker führt. Daraus entsteht ein Verbrauch öffentlicher Flächen als Parkraum, die alternativ als potenzielle Grünanlagen oder sonstigem qualitativen Lebensraum einen wichtigen Beitrag zu den neuen Klimaschutz- und Nachhaltigkeitszielen von Deutschland liefern würden.
Jedoch wäre es nicht nachhaltig, die individuelle Mobilität und den Gütertransport zu vermindern. Vielmehr müssen Nachhaltigkeitskonzepte in der Mobilität gefördert und ausgebaut werden.
Denn viele Kommunen haben Probleme ihren Parkraum rentabel zu bewirtschaften. Sie scheitern an der Kostendeckung und erhalten kaum Zuschüsse vom Land. Für einen investierbaren Ertrag fehlt es den Städten oft an Kapital und Know-How, um den Parkraum über die nötige Technologie für die maximaleffiziente Parknutzung zu modernisieren und instantzuhalten. Deshalb wird der öffentliche Parkraum zunehmend privatisiert, indem öffentliche Flächen an private Parkraumbewirtschaftungsunternehmen verpachtet werden, die das Kapital und Know-How haben, den verpachteten Parkraum nachhaltig und maximaleffizient zu bewirtschaften.
Aufgrund dessen beschäftigt sich diese Forschungsarbeit mit einem kritischen Vergleich der Umsetzung der Geschäftsmodelle Reseller und MSP in der privaten urbanen Parkraumbewirtschaftung.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung, Zielsetzung und Forschungsfrage
- 1.2 Vorgehensweise
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Das Geschäftsfeld der privaten urbanen Parkraumbewirtschaftung
- 2.2 Private urbane Parkraumbewirtschaftung als Reseller-Geschäftsmodell
- 2.3 Private urbane Parkraumbewirtschaftung als MSP-Geschäftsmodell
- 3 Vergleich der Geschäftsmodelle
- 3.1 Organisations- und Kostenstruktur
- 3.2 Netzwerkeffekte
- 3.3 Skaleneffekte
- 3.4 Customer Experience
- 4 Schlussfolgerung
- 4.1 Kritische Bewertung der Nachhaltigkeit
- 4.2 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Forschungsarbeit untersucht und vergleicht die Geschäftsmodelle "Reseller" und "Multi-Sided Platform (MSP)" im Kontext der privaten urbanen Parkraumbewirtschaftung in Deutschland. Das Ziel ist es, die Eignung beider Modelle für einen nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg zu evaluieren und die Forschungsfrage zu beantworten, welches Modell besser geeignet ist.
- Nachhaltige Parkraumbewirtschaftung in urbanen Gebieten
- Vergleich der Geschäftsmodelle Reseller und MSP
- Analyse wirtschaftlicher Aspekte beider Modelle (Kosten, Netzwerkeffekte, Skaleneffekte, Kundenerfahrung)
- Bewertung der Nachhaltigkeit der jeweiligen Geschäftsmodelle
- Identifizierung von Chancen und Risiken beider Ansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel beschreibt die Problemstellung, die durch den zunehmenden Parkplatzmangel in urbanen Gebieten und die damit verbundenen ökologischen und sozialen Herausforderungen entsteht. Es wird die zunehmende Privatisierung des Parkraums als Lösungsansatz vorgestellt, wobei der Fokus auf den digitalen Wandel und die damit verbundenen Geschäftsmodelle (Reseller und MSP) gelegt wird. Die Forschungsfrage wird formuliert: Welches Geschäftsmodell ist für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg besser geeignet? Die Vorgehensweise der Arbeit wird skizziert.
2 Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt das theoretische Fundament für den Vergleich der Geschäftsmodelle. Zunächst wird das Geschäftsfeld der privaten urbanen Parkraumbewirtschaftung definiert. Anschließend werden die Implementierung der Reseller- und MSP-Geschäftsmodelle im Detail erläutert, wobei ihre jeweiligen Eigenschaften und Unterschiede im Kontext des Parkraummanagements hervorgehoben werden. Der Abschnitt dient als Grundlage für die spätere Gegenüberstellung.
3 Vergleich der Geschäftsmodelle: Kapitel 3 bietet einen detaillierten Vergleich der Reseller- und MSP-Geschäftsmodelle anhand ausgewählter wirtschaftlicher Kriterien. Die Organisations- und Kostenstrukturen, Netzwerkeffekte, Skaleneffekte und die Customer Experience werden analysiert und gegenübergestellt, um Vor- und Nachteile beider Modelle im Kontext der privaten urbanen Parkraumbewirtschaftung aufzuzeigen und Chancen sowie Risiken zu identifizieren. Dieser Vergleich bildet die Basis für die Schlussfolgerungen.
Schlüsselwörter
Private urbane Parkraumbewirtschaftung, Reseller-Geschäftsmodell, Multi-Sided Platform (MSP), Nachhaltigkeit, wirtschaftlicher Erfolg, Kostenstruktur, Netzwerkeffekte, Skaleneffekte, Customer Experience, Digitalisierung, Mobilität, Klimapolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Forschungsarbeit: Geschäftsmodelle der privaten urbanen Parkraumbewirtschaftung
Was ist der Gegenstand dieser Forschungsarbeit?
Diese Forschungsarbeit untersucht und vergleicht zwei Geschäftsmodelle – „Reseller“ und „Multi-Sided Platform (MSP)“ – im Bereich der privaten urbanen Parkraumbewirtschaftung in Deutschland. Der Fokus liegt auf der Evaluierung ihrer Eignung für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg.
Welche Forschungsfrage wird behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welches Geschäftsmodell (Reseller oder MSP) ist für einen nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg in der privaten urbanen Parkraumbewirtschaftung besser geeignet?
Welche Geschäftsmodelle werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht detailliert das „Reseller“-Geschäftsmodell und das „Multi-Sided Platform (MSP)“-Geschäftsmodell im Kontext der privaten urbanen Parkraumbewirtschaftung.
Welche Kriterien werden für den Vergleich der Geschäftsmodelle verwendet?
Der Vergleich basiert auf verschiedenen wirtschaftlichen Kriterien, darunter Organisations- und Kostenstruktur, Netzwerkeffekte, Skaleneffekte und Customer Experience (Kundenerfahrung).
Welche Aspekte der Nachhaltigkeit werden betrachtet?
Die Arbeit bewertet die Nachhaltigkeit beider Geschäftsmodelle unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte. Es wird untersucht, welches Modell besser zu einer nachhaltigen Parkraumbewirtschaftung beiträgt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen, ein Kapitel zum Vergleich der Geschäftsmodelle und eine Schlussfolgerung mit kritischer Bewertung der Nachhaltigkeit und einem Fazit.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung beschreibt die Problemstellung (Parkplatzmangel in Städten), die Zielsetzung, die Forschungsfrage und die Vorgehensweise der Arbeit. Sie führt in das Thema der Privatisierung des Parkraums und den digitalen Wandel ein.
Was wird in den theoretischen Grundlagen behandelt?
Dieses Kapitel definiert das Geschäftsfeld der privaten urbanen Parkraumbewirtschaftung und erläutert detailliert die Implementierung der Reseller- und MSP-Geschäftsmodelle, wobei deren Eigenschaften und Unterschiede hervorgehoben werden.
Was wird im Kapitel zum Vergleich der Geschäftsmodelle behandelt?
Kapitel 3 bietet einen detaillierten Vergleich der beiden Modelle anhand der zuvor genannten Kriterien (Kostenstruktur, Netzwerkeffekte etc.). Vor- und Nachteile, Chancen und Risiken werden analysiert und gegenübergestellt.
Was beinhaltet die Schlussfolgerung?
Die Schlussfolgerung umfasst eine kritische Bewertung der Nachhaltigkeit beider Modelle und ein Fazit, das die Forschungsfrage beantwortet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Forschungsarbeit?
Relevante Schlüsselwörter sind: Private urbane Parkraumbewirtschaftung, Reseller-Geschäftsmodell, Multi-Sided Platform (MSP), Nachhaltigkeit, wirtschaftlicher Erfolg, Kostenstruktur, Netzwerkeffekte, Skaleneffekte, Customer Experience, Digitalisierung, Mobilität, Klimapolitik.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Florian Müller (Author), 2022, Ein Vergleich der Geschäftsmodelle "Multi-Sided Platforms" und "Reseller" im Geschäftsfeld der privaten urbanen Parkraumbewirtschaftung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1190926