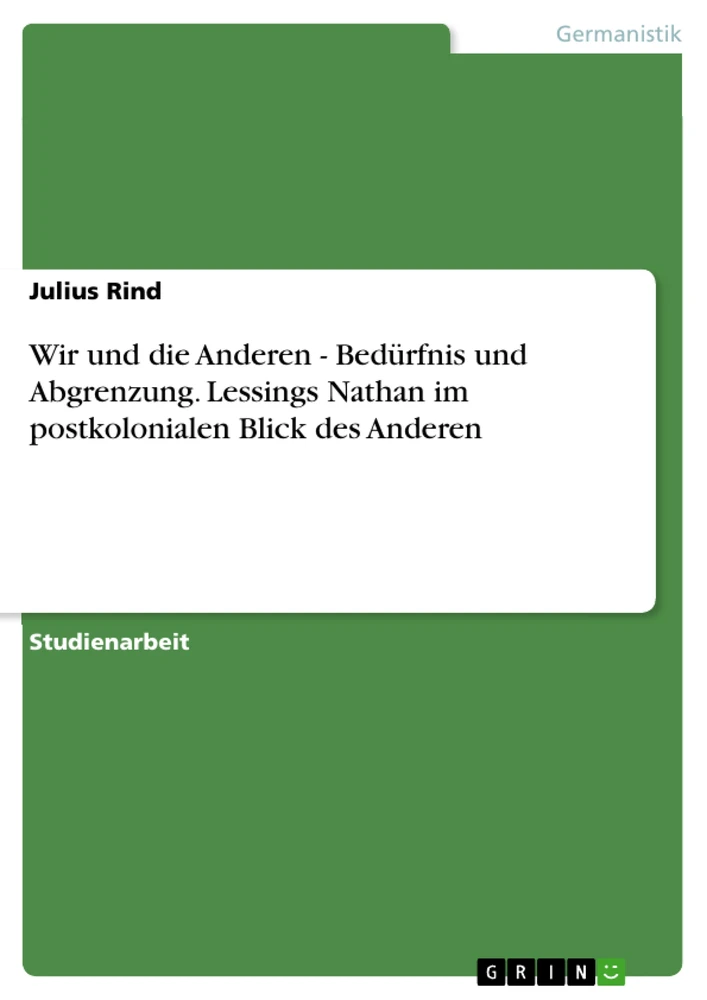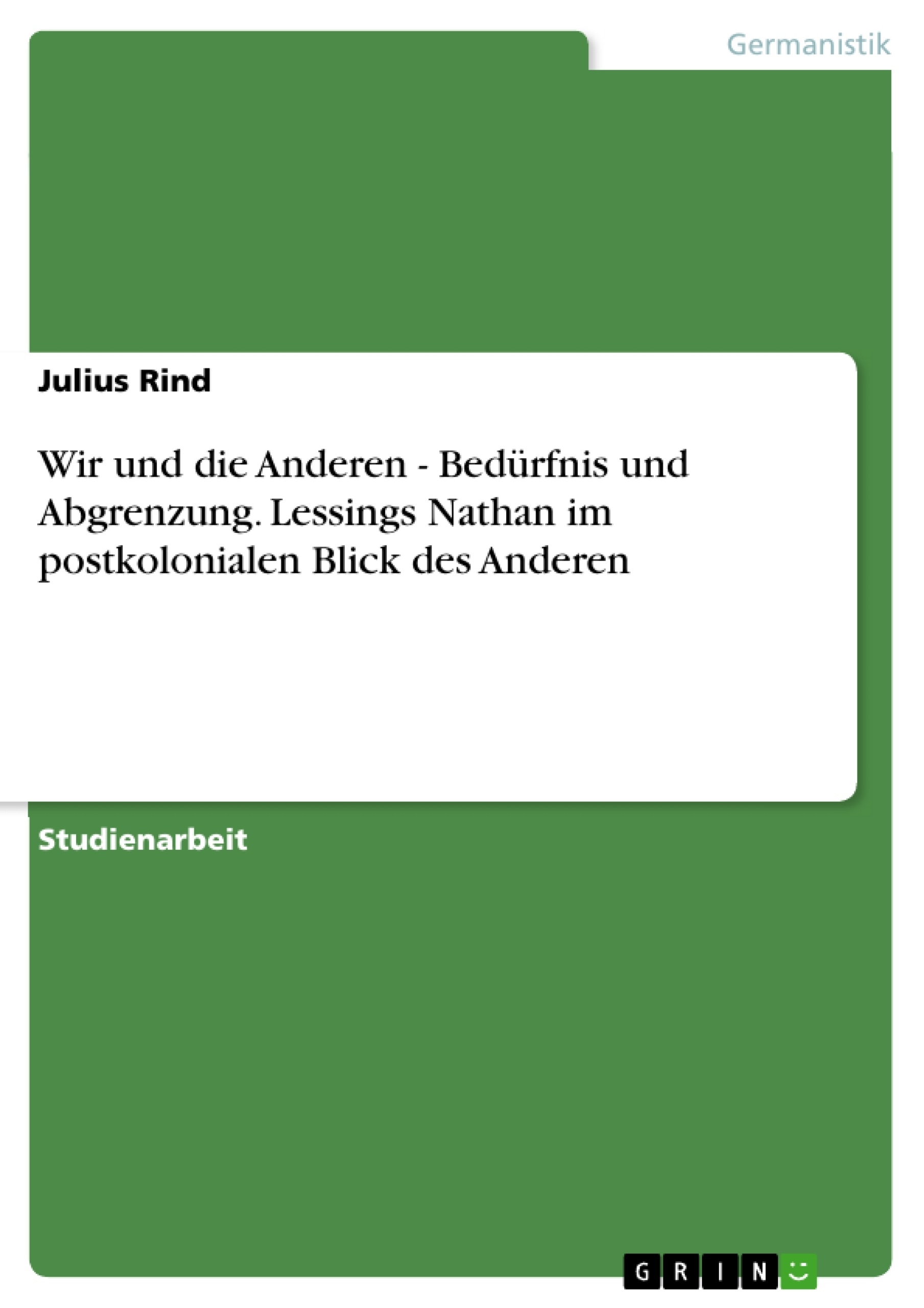Ausgehend von der These, dass zunehmend pluralistische Gesellschaften weniger durch gemeinsame Werte, als vielmehr durch geregelte Konflikte im Blick des Anderen zusammengehalten werden, ist das Ziel dieser Arbeit, den Blick auf den Menschen insofern zu schärfen, als gezeigt wird, dass ihm das Andere individuell und gesellschaftlich natürlich ist. Dafür werden die Spurenelemente des Anderen in Lessings Nathan am Beispiel des Tempelherrn nachgezeichnet und mit Mendelssohns Überlegungen zur Trennung von Staat und Kirche verknüpft, um das Anregungspotenzial des Nathans im Umgang mit Minoritäten und citizenship zu reflektieren. Es wird der Versuch unternommen, zu zeigen, dass Lessing den „Blick für die Präsenz des je Anderen“ insofern vollzieht, als er „aktives Sich Einlassen auf Andersglaubende und Andersdenkende“ einer utopischen Gleichheit der Menschen vorzieht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Über das Wir, die Gleichheit und die Anderen
- Lessings und Mendelssohns Jerusalem – der richtige falsche Ort ...
- Der Blick des Anderen im Nathan
- Der Tempelherr: Riss im Sein
- Der Tempelherr: Cross-cutter
- Der Blick des Anderen im Nathan
- Die Familie - ein enges Wir schließt den Konflikt
- Ausblick und Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und die Abgrenzung vom Anderen in Lessings "Nathan der Weise" aus einer postkolonialen Perspektive. Sie analysiert, wie die Figur des Tempelherrn den Blick auf das Andere repräsentiert und wie Lessings Werk die Notwendigkeit von Akzeptanz und Anerkennung von kultureller Vielfalt betont.
- Die Problematik des Toleranzbegriffs im Kontext von Mehrheiten und Minderheiten
- Die Rolle des Anderen für die individuelle und gesellschaftliche Identität
- Lessings "Nathan der Weise" als Beispiel für ein aktives Einlassen auf Andersdenkende
- Mendelssohns Gedanken zur Trennung von Staat und Kirche im Kontext der Toleranzdebatte
- Das Potenzial von Lessings Werk für die Reflexion über Minoritäten und Citizenship in pluralistischen Gesellschaften
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung beleuchtet die historische und aktuelle Debatte um Toleranz und Integration, insbesondere im Kontext von Migration. Sie stellt die These auf, dass das Andere für die individuelle und gesellschaftliche Identität unerlässlich ist.
- Über das Wir, die Gleichheit und die Anderen: Dieses Kapitel kritisiert die einseitige Anwendung des Toleranzbegriffs und analysiert die Problematik von "Toleranz" im Kontext von Machtverhältnissen zwischen Mehrheiten und Minderheiten. Es argumentiert, dass die Emotionsdynamik und Triebhaftigkeit von Individuen und Gruppen in der Frage der Anerkennung und Integration berücksichtigt werden müssen.
- Lessings und Mendelssohns Jerusalem – der richtige falsche Ort ...: Dieses Kapitel untersucht die Figur des Tempelherrn in "Nathan der Weise" als Repräsentanten des Blicks auf das Andere. Es analysiert die Rolle des Tempelherrn als "Riss im Sein" und "Cross-cutter", der den Konflikt zwischen "Wir" und "die Anderen" aufzeigt.
- Die Familie - ein enges Wir schließt den Konflikt: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle der Familie in "Nathan der Weise" und analysiert, wie die Darstellung der Familie den Konflikt zwischen "Wir" und "die Anderen" beeinflusst. Es zeigt, wie die Familie als ein "eng" definiertes "Wir" den Konflikt innerhalb der Geschichte auflösen kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Toleranz, Integration, postkoloniale Perspektive, Minoritäten, Citizenship, "Nathan der Weise", Lessings Werk, Tempelherr, Anderssein, Gleichheit, Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Abgrenzung, Machtverhältnisse, Emotionsdynamik, kulturelle Vielfalt, Akzeptanz, Anerkennung, Trennung von Staat und Kirche, Mendelssohns Gedanken, Pluralismus.
Häufig gestellte Fragen
Wie betrachtet der postkoloniale Blick Lessings "Nathan der Weise"?
Die Analyse fokussiert auf die Abgrenzung vom "Anderen" und zeigt, dass Lessing ein aktives Einlassen auf Andersdenkende einer utopischen Gleichheit vorzieht.
Welche Rolle spielt die Figur des Tempelherrn?
Der Tempelherr wird als "Riss im Sein" und "Cross-cutter" analysiert, der den inneren und äußeren Konflikt zwischen verschiedenen Identitäten und Religionen verkörpert.
Was kritisiert die Arbeit am herkömmlichen Toleranzbegriff?
Toleranz wird oft einseitig von Mehrheiten gegenüber Minderheiten ausgeübt, was Machtverhältnisse zementieren kann, anstatt echte Anerkennung und Citizenship zu fördern.
Welche Verbindung besteht zu Moses Mendelssohn?
Mendelssohns Überlegungen zur Trennung von Staat und Kirche werden herangezogen, um das Potenzial für den Umgang mit Minoritäten in pluralistischen Gesellschaften zu reflektieren.
Warum ist das "Andere" für die Identität wichtig?
Die Arbeit argumentiert, dass dem Menschen das Andere natürlich ist und Identität erst durch die geregelte Auseinandersetzung im Blick des Anderen entsteht.
- Quote paper
- Julius Rind (Author), 2022, Wir und die Anderen - Bedürfnis und Abgrenzung. Lessings Nathan im postkolonialen Blick des Anderen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1190977