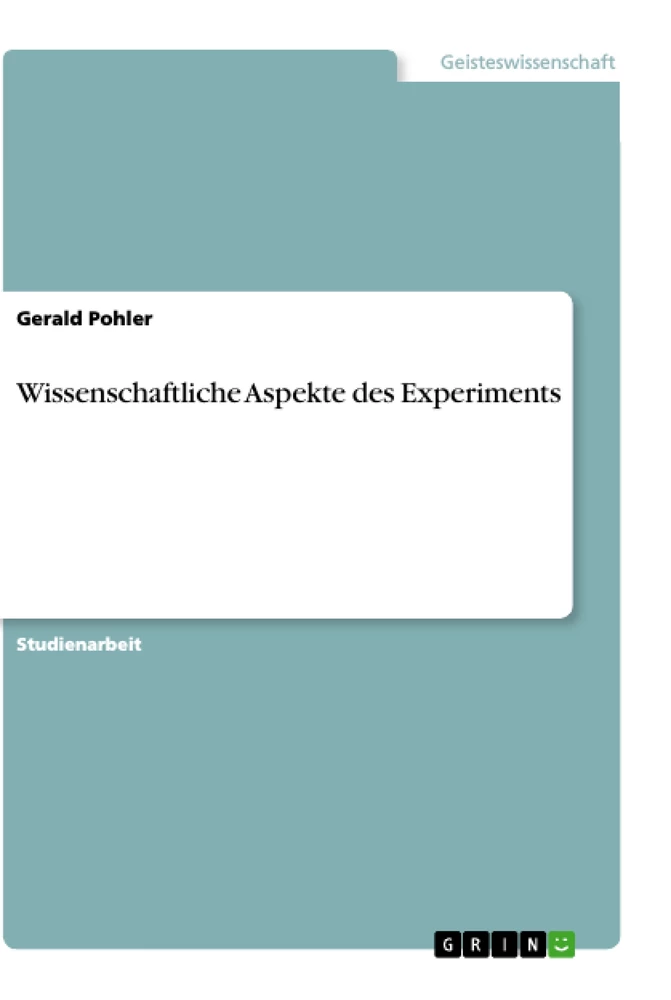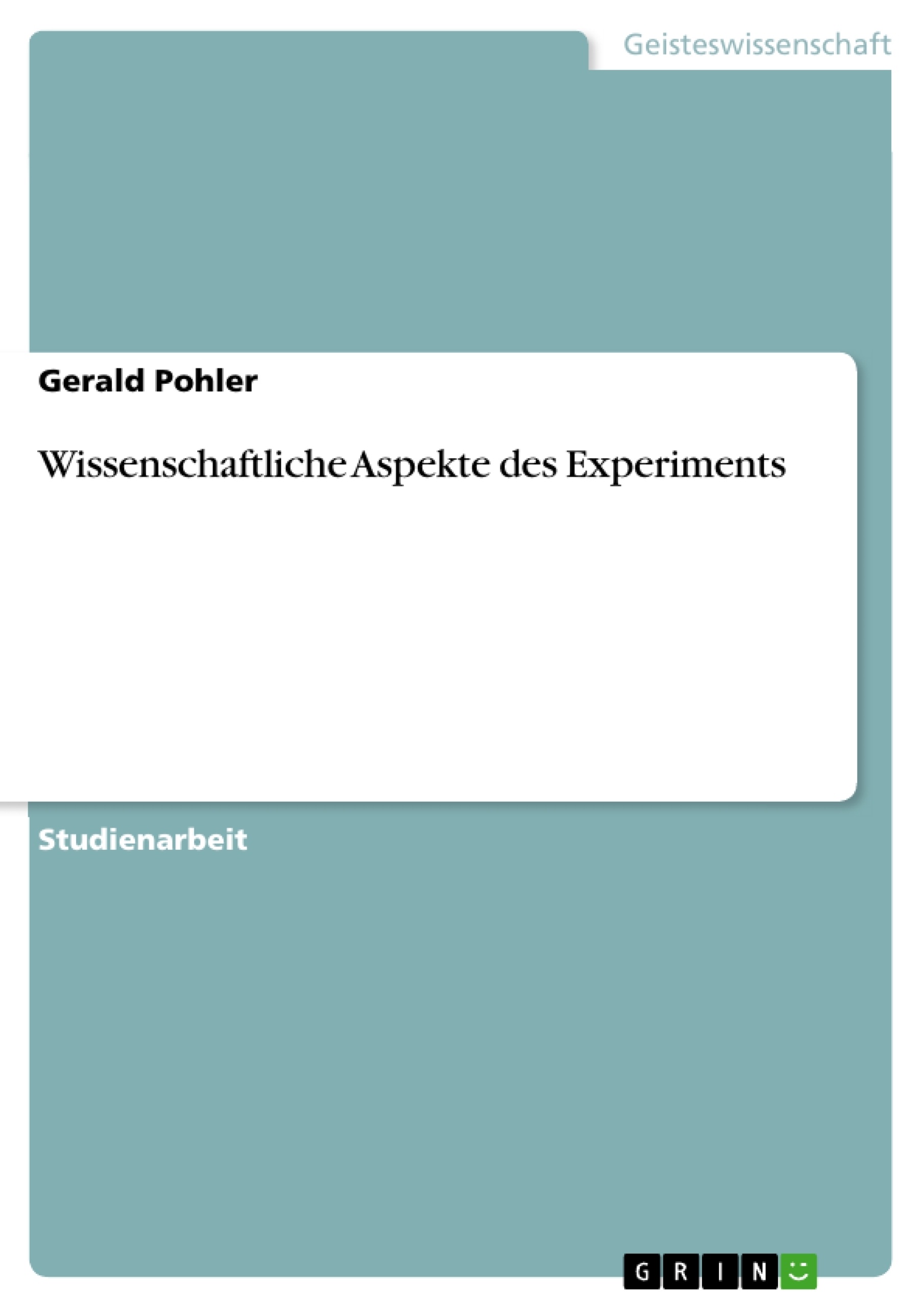In dieser Arbeit werden wissenschaftstheoretische Aspekte des "Experiments" aufgezeigt. Ein wissenschaftliches Experiment steht nicht allein da. Ein Experiment ist meistens theoriegeleitet. Untersucht werden Versuchsobjekte oder Versuchspersonen. Es bedarf einer Planung, einer Durchführung und einer Auswertung, sowie einer Interpretation. Man spricht hier auch von einem Forschungsdesign. Oftmals werden auch Geräte für die Durchführung benötigt.
Im günstigsten Fall entsteht daraus eine Publikation in einem „Peer-Review Journal“, die oft zitiert wird und andere Menschen beeinflusst. Bei Experimenten mit Lebewesen müssen auch Versuchsleitereffekte bzw. Placebowirkungen beachtet werden. Ein anderer oftmals anzutreffender Begriff ist der der Interventionsstudie. Randomisierte Kontrollstudien im Idealfall Doppel- Blind- Studien sind hier in Verwendung. Ein wissenschaftliches Experiment sollte idealerweise replizierbar und variierbar sein.
Inhaltsverzeichnis
EINLEITUNG
DAS EXPERIMENT BEI ROBERT BOYLE (1627-1691)
BEOBACHTUNG
SELEKTIVE WAHRNEHMUNG
THEORIE UND EXPERIMENT
PLANUNG UND DURCHFÜHRUNG VON EXPERIMENTEN
AUSWERTUNG, INTERPRETATION UND PUBLIKATION
FAZIT
LITERATUR
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Überarbeitete Seminararbeit aus dem Bereich History and Philosophy of Science,
180154 EK Eingangskolloquium Methoden und Probleme (2021W)
Die überzeugendsten Belege für den wissenschaftlichen Realismus werden von der experimentellen Forschung geliefert .1
Einleitung
Ein Experiment soll einen kausalen Zusammenhang zwischen mindestens zwei Variablen untersuchen. Kausal bedeutet hier den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung (Wenndann...). Es unterscheidet sich dadurch von zufälligen oder auch regelmäßigen (korrelativen) Zusammenhängen. Eine Ausnahme, bilden hier die in der Philosophie beliebten
Gedankenexperimente2.
Poincare` (1906) schreibt:
„Das Experiment ist die einzige Quelle der Wahrheit; diese Allein kann uns etwas Neues Lehren, dieses allein kann uns Gewissheit geben. Das sind zwei Punkte, die durch nichts bestritten werden können“ (Poincare 1906, zit. n. Pfister 2020, Seite 89).
Eine Definition des Experiments, unter vielen herausgenommen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
„ Im engeren und technisch umschriebenen Sinne bezeichnet E. denjenigen Sonderfall der Beobachtung unter hergestellten, planmäßig variierten und wiederholbaren Bedingungen durch denen eine Hypothese über den Zusammenhang zwischen den Bedingungen (unabhängige Variable) und den Leistungsdaten (abhängige Variable) geprüft werden kann. Die Daten sind dabei quantitativer Natur; das E. verläuft nach einem Plan (experimental design), der bereits die statistische Entscheidung und das Niveau der Entscheidung erhält “ (zit. n. Drever & Fröhlich 1975, 113).
Ein wissenschaftliches Experiment3 steht nicht allein da. Ein Experiment ist meistens theoriegeleitet. Untersucht werden Versuchsobjekte oder Versuchspersonen. Es bedarf einer Planung, einer Durchführung und einer Auswertung, sowie einer Interpretation. Man spricht hier auch von einem Forschungsdesign. Oftmals werden auch Geräte für die Durchführung benötigt (vgl. Tetens 1987, Spiel & Strohmeier2007, Heidelberger 2009, Okasha 2016 , Römp 2018).
Im günstigsten Fall entsteht daraus eine Publikation in einem „Peer-Review Journal“, die oft zitiert wird und andere Menschen beeinflusst. Bei Experimenten mit Lebewesen müssen auch Versuchsleitereffekte bzw. Placebowirkungen beachtet werden.
Ein anderer oftmals anzutreffender Begriff ist der der Interventionsstudie. Randomisierte Kontrollstudien im Idealfall Doppel- Blind - Studien sind hier in Verwendung (Eysenck 2001
Fischer & Formann 2007).
Ein wissenschaftliches Experiment sollte idealerweise replizierbar und variierbar sein.
Wann oder mit wem beginnt das „wissenschaftliche Experiment“?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Autor möchte sich da nicht festlegen. Als historisch interessante Zeit kann hier jedenfalls auf das frühe 16. Jahrhundert verwiesen werden. Insbesondere auf Robert Boyle, dem wir und nicht nur allen Physikern4, bekannte Gesetz5 von Boyle-Mariotte verdanken, sondern der auch, schon wahrhaft wissenschaftliche Experimente (Prischel 2017, Schapin & Schaffer 1985) durchführte.
Segre` schreibt über ihn: „Als aktives Mitglied der Royal Society schrieb Boyle über die verschiedensten Gegenstände, von der Chemie bis zur Medizin; im Gedächtnis der Nachwelt indes lebt er vor allem wegen des Gasgesetzes “ (zit. n. Segre` 1986 S 307).
Mit seiner Praxis des Experimentierens beginnend, sollen in weiterer Folge wesentliche Aspekte des Experiments aufgezeigt und diskutiert werden.
Das Experiment bei Robert Boyle (1627-1691)
Boyle wird als „Schlüsselprotagonist“ in der Wissenschaftsgeschichte bezeichnet. Er wandte sich vom Naturverständnis des Aristoteles ab, hin zu einer experimentellen und mathematischen Ausrichtung zur sogenannten neuen Naturphilosophie.6
„Boyle wird heute als einer der herausragenden Naturwissenschaftler des 17. Jahrhunderts angesehen, auf einer Stufe mit Isaac Newton, René Descartes oder Gottfried Wilhelm Leibniz, wenn er heute auch nicht mehr die gleiche Prominenz erreicht“ (zit. n. Prischel 2017, Seite 6)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Seine Experimente mit der Vakuumpumpe zeigten, dass er die Experimente sorgfältig geplant hatte, sie variierte und die Ergebnisse festhielt. Er lud „Zeugen“ ein, die seine Experimente beobachteten. Sowohl seine Versuche mit dem Torecellanischen Barometer als auch seine
Tierversuche waren durch so ein Vorgehen gekennzeichnet .
Prischel schreibt:
„ An diesen beiden Experimentalserien verdeutlichte Boyle seine Methode der Fragestellung, der Planung, der Durchführung, der Wiederholung, der Variation und der Interpretation von Experimenten “ (Prischel, 2017, Seite 13).
Wenngleich seine Korpuskulartheorie heute ausgedient hat, hat er das gemessen was wir heute als Luftdruck bezeichnen. Shapin und Schaffner (1985) zeigen auch die Auseinandersetzung mit Hobbes7 auf, der ein Vakuum theoretisch für unmöglich hielt. Boyle argumentierte mit seinen Experimenten deren „matteres of Fact“ neue Erkenntnisse erbrachten, letztlich auch unabhängig von Theorien.
“Facts were certain; other items of knowledge much less so. Boyle was therefore one of the most important actors in the seventeenth-century English movement towards a probabilistic and fallibilistic conception of man's natural knowledge “ (zit n. Shapin & Schaffner,1985, S. 2).
Die Natur wurde damals mechanisch -vergleichsweise einem Uhrwerk – verstanden. Shapin und Schaffner gebührt der Verdienst, auch den Kontext von Wissenschaft und Gesellschaft in diesem Zeitraum aufgezeigt zu haben. Sie beschreiben die drei von Boyle praktizierten „technologies“:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.) Eine „material technology “, damit ist die Konstruktion der Vakuumpumpe und ihre Anwendung gemeint.
2.) Eine publizistische („ literary technology “), das festhalten und veröffentlichen seiner Experimente.
3.) Eine „ social technology “, seinen Umgang mit Geldgebern, Mitarbeitern, Kollegen und Kritikern.
Es bleibt hier festzustellen, dass dieses Vorgehen als wissenschaftlich anzuerkennen ist.
Ein anderer berühmter Wissenschaftler ist William Harvey, der Arzt, der im 17. Jahrhundert den großen Blutkreislauf entdeckte. Im selben Jahrhundert kam es zu experimentellen Bestätigungen der Kreislauflehre durch mehrere anderen Forscher wie Jahn (1998) aufzeigt.
Weitere technische Geräte wurden in Folge entwickelt und für Forschungsvorhaben verwendet und vice versa. Man denke an das Mikroskop, oder das Fernrohr und in späteren Jahrhunderten Rechenmaschinen bis hin zur Fotografie, EKG, EEG, Computer und Zyklotron.
Eine philosophische Frage zur Verwendung von Forschungsgeräten ist, nach wie vor, die, inwieweit von diesen Geräten die Realität abgebildet wird? Dieser Frage möchte sich der Autor später widmen.
Beobachtung
Beobachtung könne wir als fokussierte Wahrnehmung verstehen.
Eine Beobachtung hilft uns etwas wahrzunehmen, sei es optisch, akustisch, olfaktorisch oder taktil. Die Physiologie der Wahrnehmung ist wissenschaftlich gut untersucht und beschrieben. Elektromagnetische Wellen, Luftschwankungen, Geruchsmoleküle und Berührungen werden mit entsprechenden Sinneszellen aufgenommen und weiterverarbeitet (Kandel et al.1996,
Schmidt & Schaible 2006).
So gesehen entspricht unsere Beobachtung nicht der Realität, sondern einem Ausschnitt der Realität, der von unseren Sinneszellen empfangen und in weiterer Folge von unserem Gehirn verarbeitet wird – es entsteht also ein subjektives Erlebnis, dem wir Realität zusprechen.
Nachdem wir Menschen alle über eine sehr ähnliche Wahrnehmungsphysiologie verfügen, können wir im wesentlichem ähnliche Erfahrungen machen und uns über diese verständigen.
Wir haben, sozusagen, evolutionsbiologisch geformte ähnliche Wahrnehmung und Denkstrukturen: wir wissen alle was mit der Farbe Rot gemeint ist.
Lorenz spricht in diesem Zusammenhang vom „Weltbildapparat“ der von der Evolution je nach Spezies unterschiedlich ausgeformt ist:8
„ Die Organisation der Sinnesorgane und des Zentralnervensystems setzt die Lebewesen in dem Stand, Kunde von bestimmten, für sie relevanten Gegebenheiten der Außenwelt zu erlangen und in lebenserhaltender Weise auf sie zu antworten “ (Lorenz, 1993, S.17).
Wissenschafts- und- erkenntnistheoretisch wird das in der Evolutionären Erkenntnistheorie so beschrieben9:
„ Unser Erkenntnisapparat ist ein Ergebnis der biologischen Evolution. Die subjektiven Erkenntnisstrukturen passen auf die Welt, weil sie sich im Laufe der Evolution in Anpassung an diese Welt herausgebildet haben. Und sie stimmen mit den realen Strukturen (teilweise) überein, weil nur eine solche Übereinstimmung das Überleben ermöglichte. Sie sind individuell angeboren und insofern ontogenetisch a priori, aber stammesgeschichtlich erworben, also phylogenetisch a posteriori.“ (Vollmer 1995, S.120).
Eine weitere philosophische Richtung der wissenschaftliche Realismus (Bartels 2009, Hacking
1996, Chakravaty 2011) sieht das folgendermaßen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
“Scientific realism is a positive epistemic attitude towards the content of our best theories and models, recommending belief in both observable and unobservable aspects of the world described by the sciences” (zit.n. Chakravaty 2011, Seite 1).
Der wissenschaftliche Realismus in seinen unterschiedlichen Ausprägungen anerkennt ebenso wie die Evolutionäre Erkenntnistheorie, dass es eine uns umgebende reale Welt gibt, wir diese aber nur eingeschränkt erkennen können.
Philosophische Richtungen, die keine reale Welt anerkennen sind nach Meinung des Autors für diesen Artikel vernachlässigbar.
Selektive Wahrnehmung
Der Begriff der selektiven Wahrnehmung meint, dass der Fokus unserer Wahrnehmung auf wenige Wahrnehmungsobjekte begrenzt ist, und von unserer Ausbildung, Erfahrung und unseren Bedürfnissen geleitet ist.
Unsere Wahrnehmung ist daher nicht nur biologisch begrenzt, sondern auch immer selektiv.
Im Psychologielexikon von Spektrum.de lesen wir:
„ selektive Wahrnehmung , die Selektion von Reizen bereits auf der Ebene der
Wahrnehmungsorgane. Welche Informationen bedeutsam werden, hängt von Reizintensität,
Reizkontext, Reizeindeutigkeit und Zustand einer Person ab (Wahrnehmungsselektion, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung)“
Für die Wissenschaftstheorie bedeutet das, das wissenschaftliches Arbeiten immer auch selektiv ist. Welche Forschungsfrage, mit welcher Methodik, Auswertung und Interpretation publiziert wird, ist also von sozialen und persönlichen Einflüssen abhängig
Friedrich Nietzsche hat geschrieben:
„Es gibt keine Fakten, nur Interpretationen.11“
Fleck hat 1935 die soziologischen Einflüsse bei der Entstehung von wissenschaftlichen Fakten am Begriff der Syphilis aufgezeigt (Schäfer & Schnelle 2019). Er konnte die Bedeutung von Denkkollektiv und Denkstil herausarbeiten, die von gesellschaftlichen Einflüssen geprägt werden.
Thomas Kuhn (1967), prägte den Begriff des Paradigmas. Eine Geisteshaltung, die über einzelne Theorien hinausgeht, und die bei „wissenschaftlichen Revolutionen“ durch ein neues
Paradigma ersetzt wird. So zum Beispiel, das Ptolemäische Weltbild durch das Kopernikanische. Für die Psychologie wird beispielsweise der Behaviorismus durch die kognitive Wende ersetzt.
Theorie und Experiment
Für Stuart Mill (1872) stellte das Experiment eine provozierte Beobachtung dar. Er war der Meinung, dass das Experiment nicht mehr als ein Hilfsmittel darstellt. Es führt zu Bedingungen die unnatürlich sind, aber das verändert die Beobachtungssituation nicht signifikant (vgl. Römp 2018, Seite127).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11 There are no facts, only interpretations. Notebooks (Summer 1886 – Fall 1887) Variant translation: Against that positivism which stops before phenomena, saying "there are only facts," I should say: no, it is precisely facts that do not exist, only interpretations… As translated in The Portable Nietzsche (1954) by Walter Kaufmann, p.
Quelle: https://beruhmte-zitate.de/zitate/1997953-friedrich-nietzsche-es-gibt-keine-fakten-nur-interpretationen/
In seinen vier Methoden der Forschung (1843) zeigt er eine Reihe von Methoden des induktiven Schließens auf.: die Methode der Übereinstimmung, die der Differenzierung, und die der begleitenden Veränderung. Was damals als Experiment verstanden wurde, war für ihn nicht aussagekräftiger als die Naturbeobachtung gefolgt von induktiven Schlussfolgerungen.10
Pierre Duhem (1906) schrieb, dass das Experiment in der Physik aus zwei Teilen besteht, Beobachtung und Interpretation. Er war der Meinung, dass eine einzelne Hypothese nie alleine, sondern, immer nur als Teil einer Theorie überprüft werden kann.
Quine (1951) griff diese Erkenntnisse auf. Man spricht man von der Duhem-Quine These: Ein einzelnes Experiment kann keine Entscheidung gegen eine Theorie darstellen, da in einem Experiment Fehler möglich sind und auch weil es alternative Theorien gibt. Auch ein
Entscheidungsexperiment für die Annahme einer von zwei alternativen Theorien (experimentum crucis) sei daher nicht möglich.
Nach Popper lässt sich eine Theorie nie beweisen, nur widerlegen. Er schreibt:
„ Wir können unsere Theorien nicht rechtfertigen, aber wir können sie rational kritisieren und diejenigen vorläufig annehmen, die unserer Kritik am besten standzuhalten scheinen und die größte Erklärungskraft haben. “ (zit. nach Popper,1992, Seite 316).
Der kritische Rationalismus betont, dass die menschliche Wahrnehmung und Erkenntnis beschränkt ist, so dass eine Fehlbarkeit (Fallibilismus) bedacht werden muss.
Paul Feyerabend (1993) hat der nicht unwidersprochenen Meinung Ausdruck verliehen, dass Theoriebildung ohne wissenschaftliche Methoden, denen mit wissenschaftlichen Methoden gleichzustellen sei.
Ian Hacking spricht Theorien jegliche Realität ab:
„ Sogar die Angehörigen einer Forschungsgruppe, die an verschiedenen Stücken ein und desselben Großversuches arbeiten, können verschiedene und unvereinbare Erklärungen der Elektronen vertreten “ (zit. n. Hacking 1996, Seite 434).
Er spricht von Entitäten, die durch eine Wechselwirkung zwischen Phänomenen und experimenteller Manipulation auftreten.
Im Allgemeinen dient heute ein Experiment dazu eine Hypothese zu prüfen, die ihrerseits zu einer Theorie gehört. Früher allerdings, Römp (2018) spricht vom 17. Jahrhundert, war das Experiment auch zur Theoriebildung von Interesse.
Freilich entstehen Theorien auch durch Denkprozesse, ohne dass Experimente diese zeitnah bestätigen.
Ein Beispiel dafür ist Einsteins allgemeine Relativitätstheorie aus dem Jahre 1915, deren experimentelle Bestätigung erstmals 1919 durch Eddington erfolgte11. Auch die „viele Weltentheorie“ des Physikers Hugh Everett, ist eine mathematisch stringente Theorie12 auf Basis der Quantenmechanik.
Denken wir auch an die Geschichte der Tiefenpsychologie, wie die unterschiedlichen Theorien von Freud, Adler, und Jung, die in der Psychotherapie der Gegenwart noch immer bedeutsam sind15 entstanden.
Insgesamt gibt es in Österreich dreiundzwanzig anerkannte psychotherapeutische Methoden13.
Nur wenige sind experimentell ausreichend abgesichert. Alle diese Methoden sind aus therapeutischer Arbeit mit Menschen entstanden. Soziale Einflüsse waren hier von großer Bedeutung ebenso, wie Denkstile und Denkkollektive.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Latour & Woolgar (1986) konnten in ihrer Untersuchung der Laborpraxis aufzeigen, wie aus experimentellen Ergebnissen, durch Kommunikation von Wissenschaftler und
Wissenschaftlerinnen, wissenschaftliche Fakten entstehen.
Interessant an dieser Studie war ihr ethnographischer beziehungsweise anthropologischer Forschungsansatz, nämlich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bei ihren Aktivitäten zu beobachten, wie Ethnologen einen indigenen Stamm: Fakten werden nicht einfach gefunden, sie werden durch verschiedene Abläufe des Forschungsprozesses hindurch letztlich konstruiert.
Laborexperimente sind besonders von dem Forschungsdesign her beschränkt, und die
Ergebnisse müssen den Kontext berücksichtigen. So können biologische Studien an Versuchstieren nicht so einfach auf Menschen übertragen werden.14
Collins (1992, 1999) zeigte bei seiner Untersuchung zur Forschung von Gravitationswellen, das Problem des „Experimentellen Regress“ auf. Er durchleuchtet dabei die Beziehung zwischen Theorie und Praxis von wissenschaftlicher Forschung. und untersucht die Abhängigkeit der Messergebnisse von Messinstrumenten. Ebenso die grundlegenden Theorien von Messinstrument und Messergebnissen, sowie die Deutungen der experimentellen Befunde.
Dafür ist die Meinung anderer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen von großer
Bedeutung. Ist das Ergebnis einer Untersuchung vom Messgerät abhängig und die
Messgenauigkeit (Reliabilität) unklar, gibt es kein unabhängiges Außenkriterium für die
Gültigkeit (Validität) der Messung, dann liegt die Bedeutung des Messergebnisses an der Interpretation und Beurteilung durch andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen.
Manchmal allerdings muss man auch an der Sinnhaftigkeit und dem Erkenntnisgewinn sowie der Qualifikation der Experimentatoren zweifeln: Ein Beispiel dafür ist es Elefanten LSD zu verabreichen.15
Planung und Durchführung von Experimenten
Idealtypisch geht man in der Regel geht man von einem theoretischen Hintergrund aus, und versucht dann eine Forschungsfrage (Hypothese) zu formulieren. In weiterer Folge sucht man nach geeigneten Versuchsobjekten und einem geeigneten methodischen Vorgehen und legt die
Kriterien zur Prüfung der Hypothesen fest (vgl. Eysenck 2001 Fischer & Formann 2007, Brian & Anderson 2021). Oftmals sind hier auch die Situation und der Status der Forscher und
Forscherinnen sowie Karriereplanung wesentliche Einflüsse (Fochler 2016, Müller & Rijcke 2017).
Zudem benötigt man ausreichend Finanzen, muss also einen Geldgeber finden und vielleicht auch bei Forschungsanträgen Experten, die das Projekt positiv begutachten16. Sonst geht es zurück an den Start. Abhängig vom Forschungsvorhaben, muss man einen Antrag bei einer Ethikkomission einreichen und deren positive Beurteilung einholen.
Je nach Wissenschaft (Lebenswissenschaften, Medizin, Naturwissenschaften usw.)17, gibt es hier natürliche besonderer Regeln zu beachten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Unterschiedliche Geräte werden gebraucht, um ein Experiment durchzuführen. Diese werden in der Wissenschaftstheorie (Heidelberger 2009, Römp 2018) in „repräsentierende Instrumente“ (diese sind eine Erweiterung unserer Sinne) und „produktive Instrumente“, die solche Phänomene zeigen, die in der Natur nicht vorkommen (zum Beispiel eine Pumpe die ein Vakuum erzeugt, oder ein Teilchenbeschleuniger), sowie „konstruierenden“ bzw. „simulierenden Instrumenten“ (etwa Forschung mit Modellen im Windkanal) unterteilt.
Bei Experimenten gilt es Versuchsleitereffekte (Collins & Pinch 1999), sowie bei Experimenten mit Lebewesen auch Placebo Effekte (Koshi & Short 2007; Aslaksen 2021) zu berücksichtigen. Hilfreich können hier Doppelblindstudiendesigns sein.
Auswertung, Interpretation und Publikation
Die Auswertung von Experimenten erfolgt in der Regel durch festgelegte - meist statistische- Auswertungsverfahren18. Probleme bereiten jedoch die Interpretation von Forschungsdaten. Experimentelle Limitationen und mögliche Fehlerquellen müssen beachtet werden und ein
Konsens mit den Co-Autoren oder leitenden Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen einer Abteilung müssen gefunden werden (Latour & Wolgar 1986, Collins1992, Collins & Pinch 1999). müssen beachtet werden.
Eine Publikation der Ergebnisse muss sich nach Vorschriften des Publikationsmediums richten. Hier kann auch die Publikationssprache von Bedeutung sein (Kancewicz-Hoffman & Pölönen, 2020).
Ein „peer-review“ Verfahren ist „guter Standard“. Oftmals muss die vorgesehen
Veröffentlichung nach den Vorgaben des Review-Verfahrens nochmals überarbeitet werden.
Aber auch hier gibt es große Unterschiede in der Bewertung (Hornbach & Halffmann 2019).
Fazit
Die vorliegende schriftliche Arbeit ist durch die Auswahl der Literatur limitiert.
Aus Sicht des Autors sind Planung, Durchführung, Auswertung, Interpretation und Publikation wissenschaftliche Experimente in historische, kulturelle, soziale und letztlich damit auch in psychologische und erkenntnistheoretische Prozesse eingebunden.
Literatur
Albert, Hans: Traktat über kritische Vernunft. 5. verbesserte und erweiterte Auflage, stiller Nachdruck 2010, utb, Mohr Siebeck, 2010.
Aslaksen, P.M. Cutoff criteria for the placebo response: a cluster and machine learning analysis of placebo analgesia. Sci Rep 11, 19205 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-98874-0
Bartels Andreas & Manfred Stöckler (Hrsg): Wissenschaftstheorie. Ein Studienbuch, 2. Auflage Mentis, Paderborn 2009.
Bartels Andreas: Wissenschaftlicher Realismus, in: Stöckler (Hrsg): Wissenschaftstheorie. Ein Studienbuch, 2. Auflage Mentis, Paderborn 2009, Seite 199-203.
Bertram Georg. W. (Hrsg.): Philosophischen Gedankenexperimente. Ein Lese- und Studienbuch, 4. Auflage, Reclam Taschenbuch, Ditzingen 2020.
Boese, Alexander: Elefanten auf LSD und andere verrückte Experimente. rororo, Rohwolt Taschenbuchverlag, 3. Auflage Hamburg 2010.
Bradie, Michael; Harms, William: “Evolutionary Epistemology”: In: Zalta, Edward N. (Ed.): The Standford Encylopedia of Philosphy. Spring 2020 Edition. Abgerufen am 23.12 2021 unter https://plato.standford.edu/archives/spr2020/entries/epistemology-evolutionar
Chakravartty, Anjan, "Scientific Realism", The Stanford Encyclopedia of
Philosophy (Summer 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.). Abgerufen am 23.12 unter https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/scientific-realism
Collins, Harry, M.: Changing Order. Replication and Induction in Scientific Practice. With a new Afterword. The University of Chicago Press. Chicago and London 1992
Collins, Harry M. & Trevor, Pinch: Der Golem der Forschung. Wie unsere Wissenschaft Natur erfindet. Berlin Verlag 1999.
Drever, James & Werner, D, Fröhlich: DTV Wörterbuch zur Psychologie. Deutscher Taschenbuchverlag. 9. Auflage, München, 1975.
Duham, Pierre: Die physikalische Theorie und das Experiment (1906) in: In: Pfister, Jonas (Hrsg): Texte zur Wissenschaftstheorie . 2. Auflage, Stuttgart: Reclam Verlag, 2020, 104-122.
Duncan, Stewart, "Thomas Hobbes", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2021 Edition) Edward N. Zalta (ed. 2021). Abgerufen am 23.12.2021 unter https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/hobbes
Ellenberger Henri F.: Die Entdeckung des Unbewußten. Geschichte und Entwicklung der dynamischen Psychiatrie von den Anfängen bis zu Janet, Freud, Adler und Jung. Diogenes, Zürich, 2005.
Eysenck Michael: Psychology. A Students Handbook. Psychological Press. Taylor &Francis New York, 2001.
Fischer Gerhard & Anton Formann: Methodenlehre. In: Psychologie als Wissenschaft (Hrsg: Fakultät für Psychologe Ursula Kastner-Roller & Pia Deimann). 2 aktualisierte Auflage, Facultas, Wien, 2007.
Fochler, M.: Beyond and between academia and business: How Austrian biotechnology researchers describe high-tech startup companies as spaces of knowledge production." Social Studies of Science 46(2): 259-281, 2016.
Franklin, Allan and Slobodan Perovic, "Experiment in Physics", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.) Abgerufen am 2.01.2022 unter https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/physics-experiment.
Fischer Gerhard & Anton Formann: Methodenlehre. In: Psychologie als Wissenschaft (Hrsg: Fakultät für Psychologe Ursula Kastner-Roller & Pia Deimann). 2 aktualisierte Auflage, Facultas, Wien, 2007.
Feyerabend Paul: Against Method, 3. Auflage Verso, London, New York 1993.
Gontier, Natahlie: Evolutionary Epistology. In: Fieser, James und Bradly Dowden (Hrsg) Encyclopedia of Philosophy 2020. Abgerufen 23.12.2021 unter: https://iep.utm.edu/evo-epiis
Hacking, Ian: Einführung in die Philosophie der Naturwissenschaften. Reclam, Stuttgart 1996
Hart-Davis, Adam: Schrödingers Katze. Und andere 49 Experimente die die Physik revolutionierten. Kniessbeck, München 2019.
Heidelberger, Michael: Das Experiment in den Wissenschaften. In: Bartels Andreas & Manfred Stöckler (Hrsg): Wissenschaftstheorie. Ein Studienbuch, 2. Auflage Mentis, Paderborn 2009, Seite 155-177.
Hepburn, Brian & Hanne Andersen, "Scientific Method", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), Abgerufen 28.12.2021 unter https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/scientific-method
Horbach, S.P.J.M., Halffman, W. The ability of different peer review procedures to flag problematic publications. Scientometrics Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten118 , 339–373 (2019). https://doi.org/10.1007/s11192-018-2969-2
Huber, Ludwing: Das rationale Tier. Eine kognitionsbiologische Spurensuche. Suhrkamp, Berlin, 2022.
Jahn, Ilse: Naturphilosophie und Empirie der Frühaufklärung (17. Jh.) In Jahn, I. (Hrsg):
Geschichte der Biologie. Theorien, Methoden, Institutionen, Kurzbiographien. 3.Auflage. Nikoi, Hamburg, 196-273, 2004
Kandel, Eric R, James H Schwarz, Thomas (Hrsg): Neurowissenschaften. Eine Einführung.
Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg Berlin Oxford 1996.
Kancewicz-Hoffman, N., & Pölönen, J. (2020). Does excellence have to be in English? Language diversity and internationalisation in SSH research evaluation. Overview of Peer Review Practices, 32.
Knorr-Cetina, Karin: Epistemic Cultures: How Science Make Knowledge. Harvard University Press. Cambridge,1999.
Kuhn, Thomas, S: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, 2. Auflage . Suhrkamp, Frankfurt am Main 1967.
Koshi, Edvin, B & Christine, A Short Placebo Theory and its Implications for Research and Clinical Practice: A Review of recent Literature. World Institute of Pain, 1530-7085/07/$15.00 Pain Practice, Volume 7, Issue 1, 2007 4–20.
Latour, Bruno: Science in Action. How to Follow Scientists and Engineers Through Society.
Harvard University Press. Cambridge 1987.
Latour, Bruno & Steve Wolgar: Laboratory Life. The Construction of Scientific Facts. With an new postscript and Index by the authors. First paperback printing Princeton University Press, New Jersey 1986.
Latour, Bruno: Pandora`s Hope. Essays on the Reality of Science. Harvard University Press. Cambridge 1999.
Lexikon der Psychologie: selektive Wahrnehmung, Spektrum. Abgerufen am 27.12.2021 https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/selektive-wahrnehmung/14030
Lorenz, Konrad: Die Rückseite des Spiegels. Versuch einer Naturgeschichte der menschlichen Erkenntnis: 12. Auflage, München: dtv, 1993.
Mac Intosh, J.J & Peter Anstey: Robert Boyle, in: Zalta, Edward N. (Ed.): The Standford Encylopedia of Philosphy. 2018 Edition. Abgerufen am 23.12 2021 unter https://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=boyle
Macleod, Christopher, "John Stuart Mill", in: Zalta, Edward N. (Ed.): The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2020 Edition), abgerufen am 30.12.201 unter https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/mill
Mill, John Stuart: System der deduktiven und induktiven Logik.In John Stuart Mills Gesammelte Werle, übersetzt von Prof. Dr. H. Gompertz, Zweiter Band . Fues`s Verlag Leipzig 1872.
Mill, John Stuart: Von den vier Methoden der experimentellen Forschung (1843), in
Pfister, Jonas (Hrsg): Texte zur Wissenschaftstheorie . 2. Auflage, Stuttgart: Reclam Verlag 2020, 73-84.
Müller, Ruth & de Rijcke, Sarah: Thinking with indicators. Exploring the epistemic impacts of academic performance indicators in the life sciences. Research Evaluation 26(3) 2017, 157-168 Nelson, Nicole, C: Model Behavior. Animal Experiments, Complexity, and the Genetics of P
Psychiatric Disorders. The University of Chicago Press. Chicago and London 2018
Okasha, Samir: Philosophy of Science. A Very Short Introduction. Second Edition. Oxford University Press, 2016
Paulus, Jochen: Der Studien TÜV, in: Sternstunden der Psychologie. Die größten Experimente und ihre Folgen. Gehirn & Geist Dossier. Spektrum der Wissenschaft. Höchberg, 2020.
Poincare` Henrie: Henrie Poincare`, Wissenschaft und Hypothese (1902). In: Pfister, Jonas (Hrsg): Texte zur Wissenschaftstheorie . 2. Auflage, Stuttgart: Reclam Verlag, 2020, 88-102.
Popper, Karl: Objektive Erkenntnis. Ein evolutionärer Entwurf. Mit einem Nachwort von Helmut Schmidt. Klassiker des modernen Denkens Hrsg. Von Joachim Fest & Wolf Jobst Siedler. Lizenzausgabe, Bertelsmann, Güterloh,1992.
Puster, Rolf, W (Hrsg): Klassische Argumentationen der Philosophie, Mentis, Münster, 2013.
Prischl, Andreas: Das heuristische Experimentalprogramm Robert Boyles der frühen 1660er-Jahre. Masterarbeit, Studium Geschichte. Universität Wien 2017.
Quine, Willard Van Orman: Zwei Dogmen des Empirismus (1955) in Pfister, Jonas (Hrsg):
Texte zur Wissenschaftstheorie . 2. Auflage, Stuttgart: Reclam Verlag, 2020, 252-259.
Römp, Georg: Philosophie der Wissenschaft UTB, Böhlau, Wien, Köln, Weimar, 2018. Schmid, Robert, F & Hans Georg Schaible (Hrsg): Neuro -und Sinnesphysiologie. 5. Auflage Springer, Heidelberg, 2005.
Shapin, S. & Schaffer, S. Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the
Experimental Live . With a New Introduction by the Authors Princeton: Princeton University Press. 1985.
Schäfer, Lothar & Thomas Schnelle: Ludwig Fleck Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre von Denkstil und Denkkollektiv. Mit einer Einleitung herausgegeben von Lothar Schäfer und Thomas Schnelle. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 312, 12.Auflage, 2019.
Segre`, Emilio: Von den fallenden Körpern zu den elektromagnetischen Wellen. Die klassischen Physiker und ihre Entdeckungen. Piper, München, Zürich, 1986.
Spiel, Christiane & Strohmeier Dagmar: Evaluation und Forschungsmethoden. In: Psychologie als Wissenschaft (Hrsg: Fakultät für Psychologe Ursula Kastner-Roller & Pia Deimann). 2 aktualisierte Auflage, Facultas, Wien, 2007.
Tetens, Holm: Experimentelle Erfahrung. Eine Begriffs -und Theoriebildung der Physik.
Paradeigmata Felix Meiner Verlag, 1987.
Vaidman, Lev, "Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics", The Stanford
Encyclopedia of Philosophy (Fall 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.). Abgerufen am 27.12.2021 unter https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/qm-manyworlds/
Vollmer, Gerhard: Evolutionäre Erkenntnistheorie. 6. Auflage, Stuttgart: Verlag S. Hirzel, 1994.
Weber, Marcel, "Experiment in Biology", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.). Abgerufen am 02.02 2022 unter https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/biology-experiment
Wink, Michael: Intelligenz im Tierreich: Intelligenz: Theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen. ( Holm-Haduilla, Rainer. M, Funke, Joachim & Wink, Michael (Hrsg): Heidelberger Jahrbücher online Band 6 (2021). Abgerufen 24.01. 2022 unter https://www.uni-heidelberg.de/institute/fak14/ipmb/phazb/pubwink/2021/2021.27.pdf
[...]
1 Hacking 1996, Seite 431
2 Ausführliche Beispiele bei Bertram (2020) und Puster (2013).
3 Unter wissenschaftlichen Experiment verstehe ich ein Experiment dass von einem entsprechend ausgebildeten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen durchgeführt wird – eines das „Wissen schaft“- und publiziert wird im Gegensatz zu Experimenten in Schule oder Ausbildung .
4 Sowie auch allen Sporttauchern
5 Es besagt, dass das Produkt aus Druck und Volumen einer festen Gasmenge konstant bleibt https://www.leifiphysik.de/waermelehre/allgemeines-gasgesetz/grundwissen/gesetz-von-boyle-und-mariotte
6 Mac Intosh & Anstey (2018)
7 Duncan (2021)
8 Im Werkzeuggebrauch von Tieren (Huber 2021, Wink, 2021) könnte man die phylogenetischen Vorformen des Experimentes erkennen,
9 Vgl. Bradie & William (2020) und Gontier (2020),
10 Vgl. Macleod (2020)
11 Hart-Davis (2019)
12 Vaidmann (2021) https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Schroedingers_cat_film.svg 15 Ellenberger (2005)
13 https://www.psyonline.at/contents/13405/psychotherapie-methoden, abgerufen 27.12. 2021
14 Nelson (2018)
15 Boese (2010)
16 Latour (1987,1999) und Knorr-Cetina (1999) haben notwendige kulturelle Ressourcen dieses Bereiches analysiert.
17 Franklin & Slobodan (2022), Weber (2022)
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser Leseprobe?
Diese Leseprobe bietet einen umfassenden Überblick über das Thema wissenschaftliches Experimentieren. Sie beinhaltet eine Einleitung, die Definitionen und Konzepte des Experiments erläutert, sowie historische Bezüge zu Robert Boyle. Des Weiteren werden Aspekte wie Beobachtung, selektive Wahrnehmung, die Beziehung zwischen Theorie und Experiment, Planung und Durchführung von Experimenten, Auswertung, Interpretation und Publikation diskutiert. Ein Fazit und ein Literaturverzeichnis runden die Leseprobe ab.
Was sind die zentralen Themen in dieser Leseprobe?
Die zentralen Themen umfassen: die Definition und den Zweck von Experimenten, die historische Entwicklung des wissenschaftlichen Experimentierens, insbesondere die Rolle von Robert Boyle, die Bedeutung von Beobachtung und selektiver Wahrnehmung im wissenschaftlichen Prozess, die Beziehung zwischen Theorie und Experiment, die ethischen und praktischen Aspekte der Planung und Durchführung von Experimenten, die Methoden der Auswertung und Interpretation von experimentellen Daten sowie die Bedeutung der Publikation von Forschungsergebnissen.
Wer war Robert Boyle und warum ist er in dieser Leseprobe wichtig?
Robert Boyle (1627-1691) war ein bedeutender Naturwissenschaftler des 17. Jahrhunderts. Er wird als "Schlüsselprotagonist" in der Wissenschaftsgeschichte bezeichnet und wandte sich vom Naturverständnis des Aristoteles ab, hin zu einer experimentellen und mathematischen Ausrichtung. Seine Experimente mit der Vakuumpumpe und seine sorgfältige Planung, Variation und Dokumentation der Ergebnisse machen ihn zu einer wichtigen Figur für die Entwicklung des wissenschaftlichen Experimentierens. Er ist auch bekannt für das Boyle-Mariotte-Gesetz.
Was versteht man unter "selektiver Wahrnehmung" im Kontext wissenschaftlicher Forschung?
Selektive Wahrnehmung bedeutet, dass der Fokus unserer Wahrnehmung auf wenige Wahrnehmungsobjekte begrenzt ist und von unserer Ausbildung, Erfahrung und unseren Bedürfnissen geleitet ist. Im Kontext wissenschaftlicher Forschung bedeutet dies, dass wissenschaftliches Arbeiten immer auch selektiv ist und die Wahl der Forschungsfrage, Methodik, Auswertung und Interpretation von sozialen und persönlichen Einflüssen abhängt.
Was ist die Duhem-Quine-These und welche Bedeutung hat sie für die Wissenschaftstheorie?
Die Duhem-Quine-These besagt, dass ein einzelnes Experiment keine Entscheidung gegen eine Theorie darstellen kann, da in einem Experiment Fehler möglich sind und auch weil es alternative Theorien gibt. Daher sei auch ein Entscheidungsexperiment für die Annahme einer von zwei alternativen Theorien (experimentum crucis) nicht möglich. Dies hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wissenschaftliche Theorien bewertet und falsifiziert werden.
Welche Aspekte sind bei der Planung und Durchführung von Experimenten zu berücksichtigen?
Bei der Planung und Durchführung von Experimenten sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, darunter: ein theoretischer Hintergrund, die Formulierung einer Forschungsfrage (Hypothese), die Auswahl geeigneter Versuchsobjekte, die Festlegung eines methodischen Vorgehens, die Kriterien zur Prüfung der Hypothesen, die Finanzierung, die Einholung ethischer Genehmigungen, die Verwendung geeigneter Geräte sowie die Berücksichtigung von Versuchsleitereffekten und Placebo-Effekten.
Wie erfolgt die Auswertung und Interpretation von Experimenten?
Die Auswertung von Experimenten erfolgt in der Regel durch festgelegte - meist statistische- Auswertungsverfahren. Probleme bereiten jedoch die Interpretation von Forschungsdaten. Experimentelle Limitationen und mögliche Fehlerquellen müssen beachtet werden und ein Konsens mit den Co-Autoren oder leitenden Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen einer Abteilung müssen gefunden werden.
Was ist ein "Peer-Review-Verfahren" und warum ist es wichtig für die Publikation von Forschungsergebnissen?
Ein Peer-Review-Verfahren ist ein Begutachtungsprozess, bei dem wissenschaftliche Artikel von Experten auf dem jeweiligen Fachgebiet bewertet werden, bevor sie in einer Fachzeitschrift veröffentlicht werden. Dieses Verfahren dient dazu, die Qualität und Validität der Forschungsergebnisse sicherzustellen und sicherzustellen, dass die veröffentlichten Artikel den wissenschaftlichen Standards entsprechen.
Was sind die Limitationen dieser Leseprobe?
Die vorliegende schriftliche Arbeit ist durch die Auswahl der Literatur limitiert.
- Arbeit zitieren
- Gerald Pohler (Autor:in), 2022, Wissenschaftliche Aspekte des Experiments, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1191300