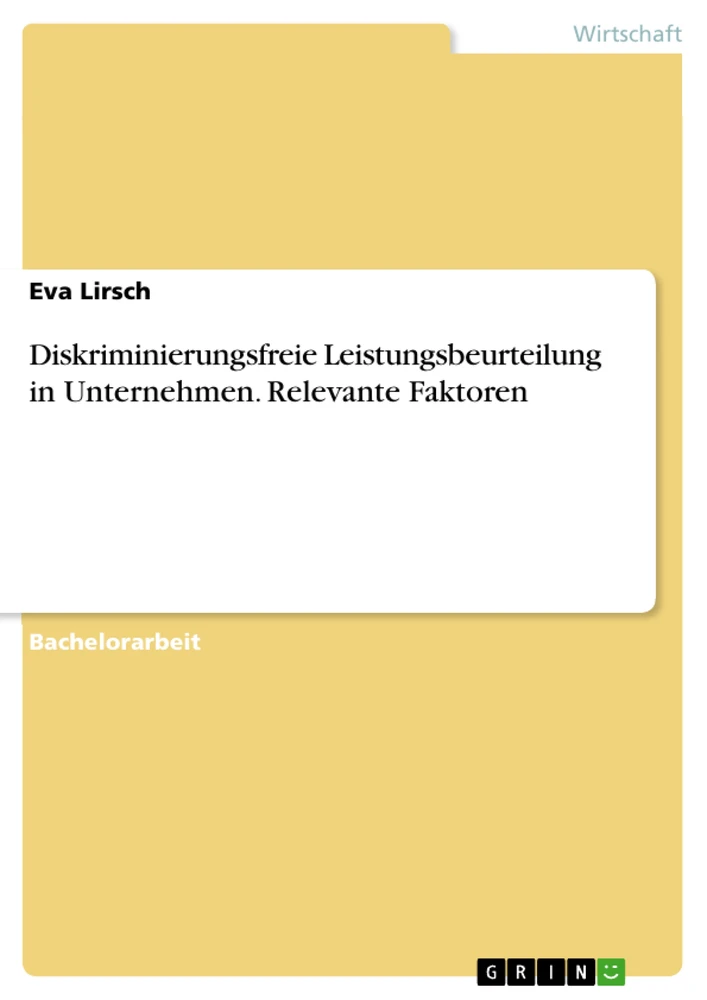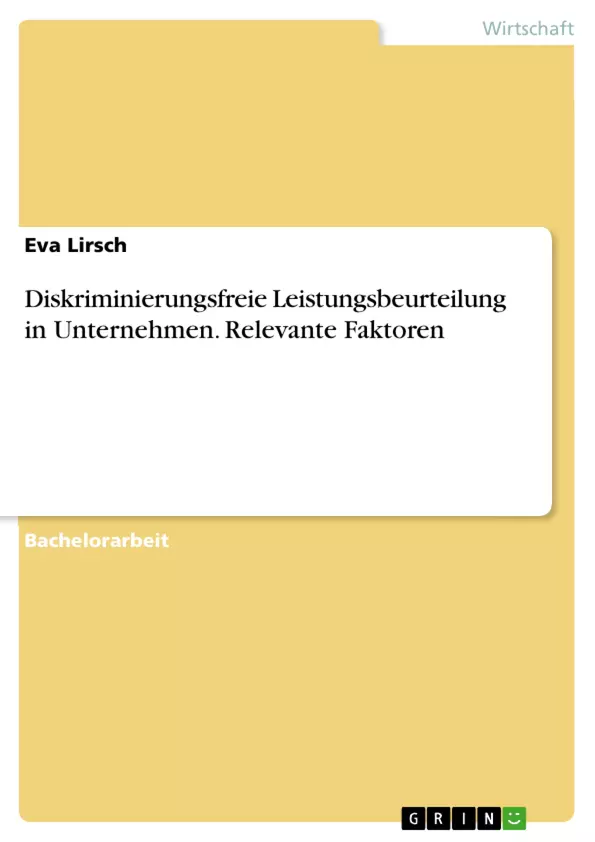Die vorliegende Arbeit befasste sich mit der Thematik der diskriminierungsfreien Leistungsbeurteilung. Das Ziel der Arbeit war es, herauszufinden, welche Faktoren für die diskriminierungsfreie Leistungsbeurteilung in der betrieblichen Praxis in Unternehmen relevant sind. Dazu wurde die Methode der qualitativen Befragung gewählt und problemzentrierte Interviews mittels teilstrukturierter Leitfäden mit Personalverantwortlichen von sieben Unternehmen im Raum Wien durchgeführt.
In Kapitel 1 erfolgt zunächst die Herleitung des Themas. Im Anschluss daran wird die Ausgangslage skizziert und die Forschungsfrage aufgeworfen, die beantwortet werden soll. Außerdem werden Zielsetzung und Gliederung der Arbeit dargestellt. Kapitel 2 widmet sich der Methodologie. Darin werden die gewählte empirische Methode, Erhebungsinstrumente, Auswertungsverfahren, Untersuchungsgegenstand und Durchführung der Untersuchung beschrieben.
Kapitel 3 befasst sich mit der Darstellung der Ergebnisse der empirischen Untersuchung. In Kapitel 4 werden diese interpretiert und Schlussfolgerungen gezogen. Im Rahmen der Conclusio im Kapitel 5 richtet sich der Fokus auf die Zusammenführung und Diskussion der Ergebnisse und Kapitel 6 fasst schließlich die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit nochmals zusammen. Dem Anhang der vorliegenden Bachelorarbeit sind das sensibilisierende Konzept, der Interviewleitfaden und das kombinierte Modell der Leistungsbeurteilung beigefügt
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Empirische Untersuchung
- 2.1. Methodenwahl
- 2.2. Beschreibung des Erhebungsinstrumentes
- 2.3. Auswertungsverfahren mittels Inhaltsanalyse nach Meuser/Nagel
- 2.4. Beschreibung des Untersuchungsgegenstandes
- 2.5. Durchführung der Untersuchung
- 3. Ergebnisdarstellung
- 3.1. Bedeutung von Leistungsbeurteilung
- 3.2. Prozessablauf und eingesetzte Verfahren
- 3.3. Ziele und Beurteilungskriterien
- 3.4. Kommunikation
- 3.5. Handlungs- und Gestaltungsspielraum
- 3.6. Trainings/Schulungen
- 3.7. Potentielle Erfolgsfaktoren für diskriminierungsfreie Leistungsbeurteilung
- 3.8.1. Kommunikation
- 3.8.2. Auswahl Beurteilungsverfahren
- 3.8.3. Beurteilungskriterien
- 3.8.4. Zielgruppe
- 3.8.5. Trainings/Schulungen
- 3.8.6. Auswahl und Anzahl der beurteilenden Personen
- 3.8.7. gender-gerechte Sprache
- 3.9. Verbesserungspotentiale in den untersuchten Unternehmen
- 3.10. Die Rolle von HR
- 4. Interpretation der Ergebnisse
- 4.1. Rahmenbedingungen für diskriminierungsfreie Leistungsbeurteilung
- 4.2. Transparente Kommunikation und Partizipation als zentrale Faktoren
- 4.3. Sensibilisierung durch Trainings
- 5. Conclusio und Diskussion
- 6. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der diskriminierungsfreien Leistungsbeurteilung in Unternehmen. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die Faktoren, die für eine faire und gerechte Beurteilung relevant sind. Das Ziel der Arbeit ist es, herauszufinden, welche Faktoren in der betrieblichen Praxis eine Rolle spielen und wie diese Faktoren die Umsetzung einer diskriminierungsfreien Leistungsbeurteilung beeinflussen.
- Faktoren für die diskriminierungsfreie Leistungsbeurteilung
- Relevanz der Faktoren in der betrieblichen Praxis
- Einfluss der Faktoren auf die Umsetzung einer diskriminierungsfreien Leistungsbeurteilung
- Verbesserungspotentiale in Unternehmen
- Rolle von HR in der Gestaltung diskriminierungsfreier Leistungsbeurteilungsprozesse
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 liefert eine Einleitung und stellt die Thematik der diskriminierungsfreien Leistungsbeurteilung vor. Kapitel 2 beschreibt die empirische Untersuchung, die in der vorliegenden Arbeit durchgeführt wurde. Dabei werden die gewählten Methoden, das Erhebungsinstrument und das Auswertungsverfahren vorgestellt. In Kapitel 3 werden die Ergebnisse der Untersuchung präsentiert. Hierbei werden die Bedeutung von Leistungsbeurteilung, der Prozessablauf, die Ziele und Beurteilungskriterien sowie die Faktoren, die für eine diskriminierungsfreie Leistungsbeurteilung relevant sind, analysiert. Kapitel 4 interpretiert die Ergebnisse der Untersuchung und beleuchtet die Rahmenbedingungen für diskriminierungsfreie Leistungsbeurteilung, die Bedeutung von transparenter Kommunikation und Partizipation sowie die Sensibilisierung durch Trainings. Abschließend erfolgt in Kapitel 5 eine Diskussion der Ergebnisse und ein Ausblick auf zukünftige Forschungsfelder.
Schlüsselwörter
Diskriminierungsfreie Leistungsbeurteilung, Faktoren, Unternehmenslandschaft, qualitative Befragung, Inhaltsanalyse, Kommunikation, Beurteilungsverfahren, Beurteilungskriterien, Zielgruppe, Trainings/Schulungen, Auswahl und Anzahl der beurteilenden Personen, gender-gerechte Sprache, Verbesserungspotentiale, HR-Rolle.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann eine Leistungsbeurteilung diskriminierungsfrei gestaltet werden?
Zentrale Faktoren sind transparente Kommunikation, objektive und messbare Beurteilungskriterien, die Schulung der Führungskräfte zur Sensibilisierung für Vorurteile sowie eine gender-gerechte Sprache.
Welche Rolle spielt die HR-Abteilung dabei?
HR fungiert als Gestalter der Prozesse. Sie wählt die Verfahren aus, bietet Trainings an und stellt sicher, dass die Kriterien für alle Mitarbeitergruppen fair angewendet werden.
Warum sind Trainings für Führungskräfte wichtig?
Trainings helfen dabei, unbewusste Vorurteile (Unconscious Bias) zu erkennen, die oft dazu führen, dass bestimmte Gruppen (z.B. Frauen oder ältere Mitarbeiter) schlechter bewertet werden als andere.
Was sind typische Fehler bei der Leistungsbeurteilung?
Häufige Fehler sind mangelnde Transparenz, zu subjektive Kriterien und das Fehlen von klaren Feedback-Prozessen, was den Spielraum für Diskriminierung vergrößert.
Welchen Nutzen hat eine faire Beurteilung für Unternehmen?
Sie steigert die Mitarbeitermotivation, verbessert die Mitarbeiterbindung und schützt das Unternehmen vor rechtlichen Konsequenzen durch das Gleichbehandlungsgesetz.
- Quote paper
- Eva Lirsch (Author), 2013, Diskriminierungsfreie Leistungsbeurteilung in Unternehmen. Relevante Faktoren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1191403