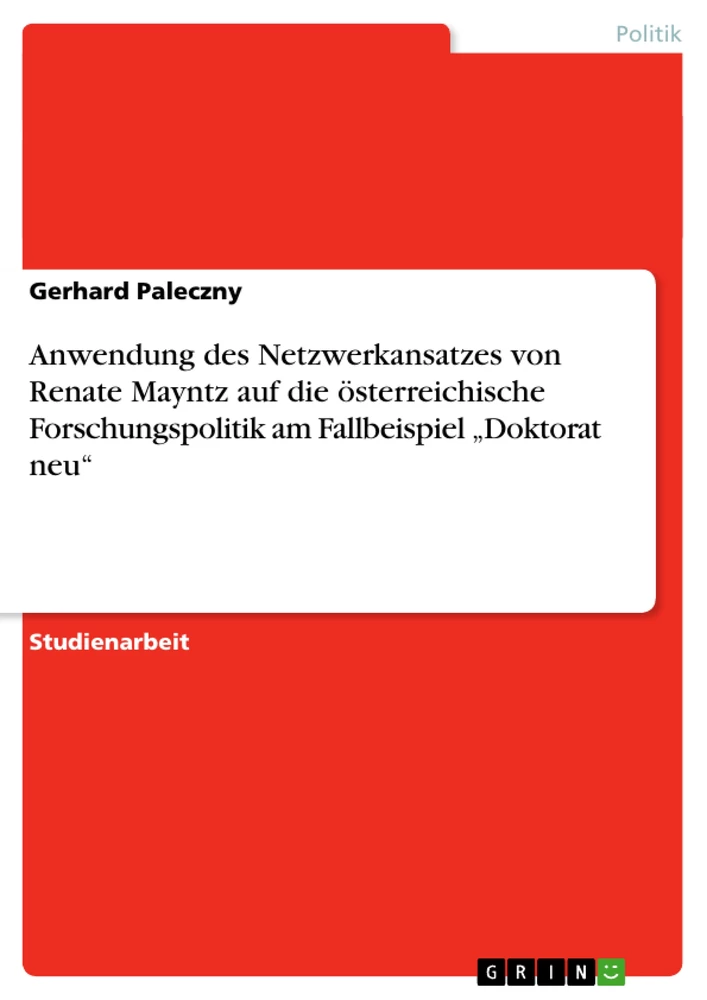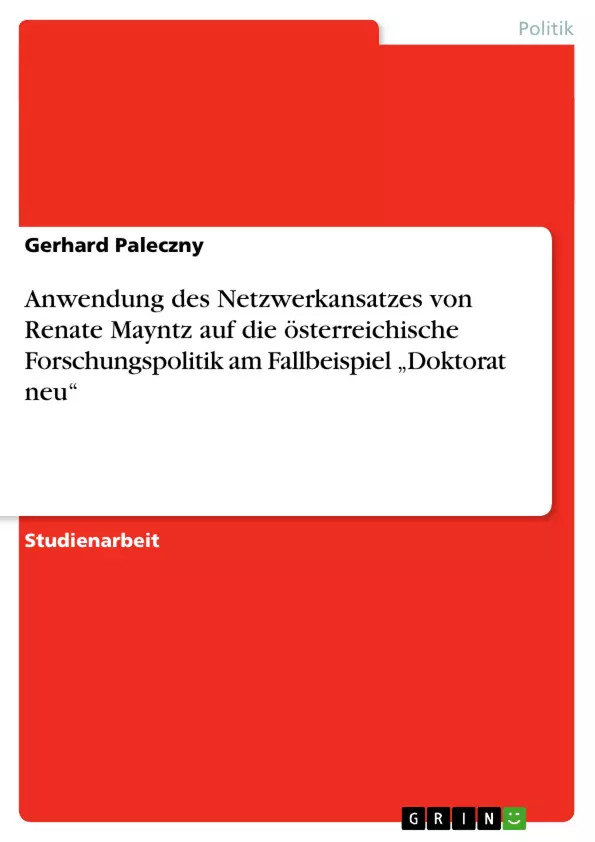In der vorliegenden Arbeit analysiere ich die österreichische Forschungspolitik anhand eines Fallbeispiels mittels des Netzwerkansatzes von Renate Mayntz. Eingangs fasse ich jenen Zugang zur Policy-Analyse kurz zusammen, behandle in der Folge den Reformprozess des Doktoratsstudiums („Doktorat neu“) an den österreichischen Universitäten und versuche diesen dann unter dem Blickpunkt der Netzwerktheorie zu betrachten. Als Basisquelle diente ein Artikel zu den Veränderungen in den forschungspolitischer Strategien Österreichs von Sylvia Kritzinger, Barbara Prainsack und Helga Pülzl, der 2006 in der Österreichischen Zeitschrift für Politikwissenschaft erschienen ist.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Policy Netzwerke nach Renate Mayntz
3. „Doktorat neu“
3.1. Die Reform der Doktoratsstudien an den österreichischen Universitäten
3.2. „Doktorat neu“ als Netzwerkansatz
4. Diskussion
5. Literatur
1. Einleitung
In der vorliegenden Arbeit analysiere ich die österreichische Forschungspolitik anhand eines Fallbeispiels mittels des Netzwerkansatzes von Renate Mayntz. Eingangs fasse ich jenen Zugang zur Policy-Analyse kurz zusammen, behandle in der Folge den Reformprozess des Doktoratsstudiums („Doktorat neu“) an den österreichischen Universitäten und versuche diesen dann unter dem Blickpunkt der Netzwerktheorie zu betrachten. Als Basisquelle diente ein Artikel zu den Veränderungen in den forschungspolitischer Strategien Österreichs von Sylvia Kritzinger, Barbara Prainsack und Helga Pülzl, der 2006 in der Österreichischen Zeitschrift für Politikwissenschaft erschienen ist.
2. Policy Netzwerke nach Renate Mayntz
Der Grundannahme von Mayntz’ Netzwerkansatz ist, dass sich die Welt nicht nach hierarchischen Mustern zusammensetzt, sondern aus Netzwerken. Gemeinsam mit anderen WissenschaftlerInnen (wie z.B. Heritier 1993) sieht die Autorin in der Netzwerktheorie „einen zentralen Ausdruck gesellschaftlicher Modernisierung“ (Mayntz 1993, 41) und spielt damit auf die Veränderungen in den politischen Entscheidungsstrukturen an. Es lässt sich eine Tendenz des Zerfalls traditioneller Institutionen, wie hierarchisch organisierten Großunternehmen oder des Nationalstaates, sowie gleichzeitig eine steigende Relevanz von transnationalen ökonomischen oder politischen Netzwerken ausmachen.
Renate Mayntz formuliert so genannte issue networks. Nicht die Organisationsstrukturen und die Stetigkeit von Beziehungen, sondern vielmehr ein gemeinsames Interesse an einem bestimmten Thema und die Verfolgung eines gemeinsamen Ziels sind für die Stabilität eines Netzwerks verantwortlich. Issue networks werden ad hoc durch ein spezifisches Policy-Problem aktiviert, „das kollektives Handeln zu seiner Lösung verlangt„ (Mayntz 1993, 46) und erliegen nach Erreichen des gesetzten Zwecks. Über das Ziel – den Output – muss nicht erst verhandelt werden, es steht im Vorhinein fest; es ist vielmehr die Eintrittsbedingung in das Netzwerk. Charakteristisch für dieses themenbezogene Arbeiten ist weiters, dass nicht alle Akteure des Netzwerkes einbezogen werden müssen, sondern unterschiedliche Mitgliederkonstellationen gebildet werden können. Die Netzwerkteilnehmer stehen nicht notwendigerweise in einem hierarchischen Verhältnis zueinander und setzen sich sowohl aus nationalen, als auch aus inter- oder supranationalen AkteurInnen zusammen.
Solche Netzwerke „funktionieren, weil der Nutzen, der aus dem Finden einer gemeinsamen Lösung erfließt, von den wesentlichen Netzwerk-AkteurInnen als größer eingestuft wird, als das sture Festhalten an der eigenen rational kalkulierten Nutzenmaximierung“ (Kritzinger, 78). D.h. Netzwerke sind von einer „Verhandlungslogik“ und problemzentrierten Sichtweise bestimmt (vgl. auch Mayntz, 42). Renate Mayntz analysiert in ihren Artikeln (Mayntz 1992 und Mayntz 1993) die Zusammenführung eines gesamtdeutschen Forschungssektors in Zeiten des Mauerfalls. Was liegt also näher, einen genaueren Blick auf die aktuelle österreichische Forschungspolitik im Hinblick auf die europäische Integration zu werfen?
3. „Doktorat neu“
3.1. Die Reform der Doktoratsstudien an den österreichischen Universitäten
Das Feld nationaler Forschungspolitik schließt all jene Bereiche ein, in denen es um die Regulierung von Wissenschaft, Forschung und Innovation geht, unabhängig davon, ob diese Bereiche in privaten oder akademischen Instituten angesiedelt sind. In Zeiten einer voranschreitenden europäischen Integration ist freilich auch dieses Politikfeld einer deutlichen Wandlung unterworfen. Es herrscht allerdings Unklarheit, wie dieser Veränderungsprozess zustande kommen soll. Am Beispiel der Neuregelung des Doktoratstudiums an den österreichischen Universitäten („Doktorat neu“) versuche ich in den folgenden Absätzen mittels des Netzwerkansatzes aufzuzeigen, wie Einflüsse der „Umwelt“ auf das österreichische Forschungssystem herangetragen werden bzw. welche Entscheidungslogiken einem Policy-Wandel unterliegen.
Bislang war das DoktorandInnenprogramm an den österreichischen Universitäten auf eine Mindeststudiendauer von vier Semestern ausgelegt, in denen Seminare und Wahlfächer im Umfang von sechs bis zwölf Semesterstunden[1] zu besuchen sind. Generell kann das österreichische Modell als „loser Rahmen“ (Kritzinger, 80; zit. nach Schratz, 1994, 207) beschrieben werden. Aus finanziellen und organisatorischen Gründen finden die individuellen Forschungsarbeiten nur selten im Rahmen von Forschungsprojekten statt; auch der wissenschaftliche Austausch in Konferenzen gestaltet sich aus selbigen Gründen äußerst schwierig. Eine systematische Finanzierung von DoktorandInnenstellen war in Österreich bisher nicht vorgesehen, was letztlich auch zu längeren Studienzeiten führte, da Studierende zu beruflichen (Neben-) Tätigkeiten gezwungen waren. (vgl. Kritzinger 80).
2003 wurde in Berlin in einer Konferenz der Bildungs- bzw. WissenschaftsministerInnen beschlossen, das Doktoratsstudium europaweit neu zu strukturieren und aufzuwerten, um die überaus unterschiedlich gestalteten DoktorandInnenausbildungen in den EU-Mitgliedsländern zu harmonisieren. Im selben Jahr wurden auch Resolutionen der Europäischen Kommission und des Europäischen Rats verabschiedet, die den Ausbau des Forscherpotentials in Europa als eine grundlegende Voraussetzung der „European Research Area“ ansehen (vgl. Kritzinger, 81). Im Anschluss an die Verhandlungen in Berlin organisierte das österreichische Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kunst (heute: aufgesplittert in Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung bzw. Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur) im Frühling 2005 in Salzburg ein internationales Seminar[2], dessen Ergebnis einerseits die Richtlinien zur Ausarbeitung konkreter Maßnahmen zur Umsetzung des „Doktorats neu“ festlegen sollte, anderseits als Grundlage für die weitere europäische Diskussion diente.
[...]
[1] Die Anzahl der vorgeschriebenen Semesterstunden ist von Fakultät zu Fakultät unterschiedlich organisiert. Siehe hierzu auch http://www.doktorat.at/.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt der Arbeit?
Die Arbeit analysiert die österreichische Forschungspolitik am Beispiel des Reformprozesses des Doktoratsstudiums ("Doktorat neu") an den österreichischen Universitäten, unter Verwendung des Netzwerkansatzes von Renate Mayntz.
Wer ist Renate Mayntz und was ist ihr Netzwerkansatz?
<Renate Mayntz ist eine Wissenschaftlerin, deren Netzwerkansatz besagt, dass die Welt aus Netzwerken besteht, nicht aus Hierarchien. Ihr Ansatz betont issue networks, die sich ad hoc um spezifische Policy-Probleme bilden und sich durch gemeinsame Interessen und Ziele auszeichnen.
Was sind issue networks laut Mayntz?
Issue networks sind Netzwerke, die durch ein spezifisches Policy-Problem aktiviert werden, das kollektives Handeln erfordert. Sie sind themenbezogen, nicht hierarchisch und können aus unterschiedlichen Akteuren (nationalen, inter- oder supranationalen) bestehen.
Was ist "Doktorat neu"?
"Doktorat neu" bezieht sich auf die Reform des Doktoratsstudiums an den österreichischen Universitäten. Ziel war es, die DoktorandInnenausbildungen in den EU-Mitgliedsländern zu harmonisieren.
Wie war das Doktoratsstudium in Österreich vor der Reform gestaltet?
Vor der Reform hatte das DoktorandInnenprogramm eine Mindeststudiendauer von vier Semestern mit wenigen vorgeschriebenen Semesterstunden. Es gab wenig systematische Finanzierung für DoktorandInnenstellen, was zu längeren Studienzeiten führte.
Was war der Anlass für die Reform des Doktoratsstudiums?
Ein Auslöser war eine Konferenz der Bildungs- bzw. WissenschaftsministerInnen in Berlin 2003, die die europaweite Neustrukturierung und Aufwertung des Doktoratsstudiums beschloss.
Welche Rolle spielte die Europäische Kommission und der Europäische Rat bei "Doktorat neu"?
Resolutionen der Europäischen Kommission und des Europäischen Rats sahen den Ausbau des Forscherpotentials in Europa als grundlegende Voraussetzung der "European Research Area".
Wer war am Reformprozess "Doktorat neu" in Österreich beteiligt?
Das österreichische Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kunst (später aufgespalten) organisierte ein internationales Seminar in Salzburg, das Richtlinien zur Ausarbeitung konkreter Maßnahmen zur Umsetzung des "Doktorats neu" festlegen sollte. An der Veranstaltung waren auch das deutsche Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung und die European University Association (EUA) beteiligt.
- Quote paper
- Gerhard Paleczny (Author), 2007, Anwendung des Netzwerkansatzes von Renate Mayntz auf die österreichische Forschungspolitik am Fallbeispiel „Doktorat neu“ , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119149