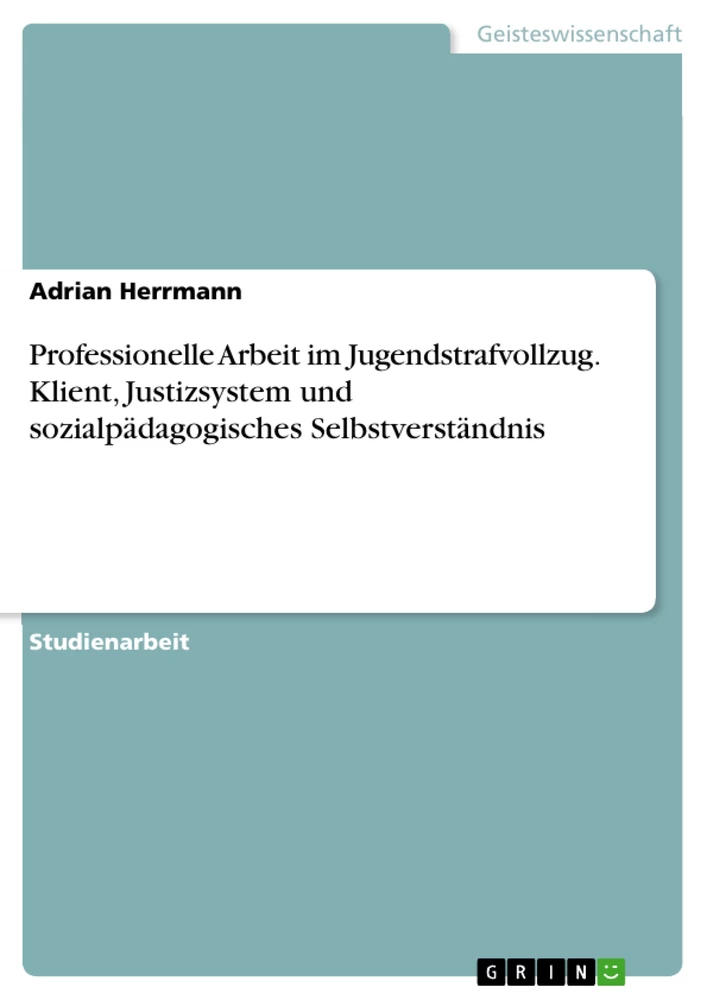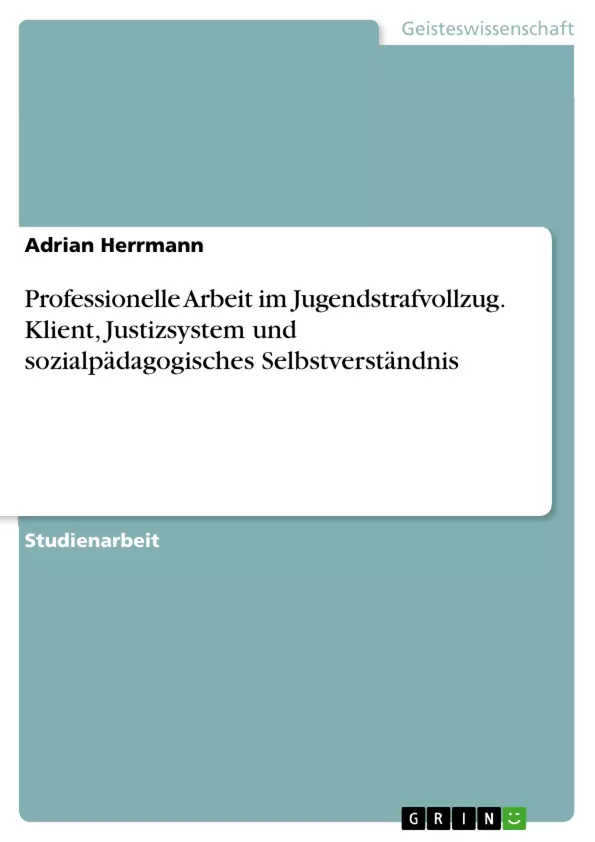Diese Arbeit beschäftigt sich mit der professionellen Arbeit im Jugendstrafvollzug und deren Klienten, dem Justizsystem und dem sozialpädagogischen Selbstverständnis.
Bei Sozialer Arbeit im Zwangskontext handelt es sich um ein ständiges Spannungsfeld. Es besteht aus einem Träger, wie der Justiz, dem Gericht oder einer anderen staatlichen Einrichtung und dem Klienten, der unter institutionellem Zwang, professionelle Hilfe aufsucht. Adressaten, die angeordnete Hilfsangebote nicht wahrnehmen oder ihnen nicht in vollem Umfang nachgehen, werden von den anordnenden Stellen häufig empfindlich sanktioniert. Die bloße Androhung von Bestrafungen hat oftmals die Funktion sowohl „motivierend“ als auch abschreckend zu wirken und stellt eine Machtdemonstration des Staates dar, die gesellschaftlich weitestgehend akzeptiert wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Elementare Begriffe
- Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession begreifen
- Was ist unter einem Zwangskontext zu verstehen
- Das Tripel Mandat in der Sozialen Arbeit
- Methodische Herangehensweise im Einklang der Menschenrechtsprofession
- Praxisbeispiel anhand des Jugendstrafvollzugs
- Definition von Jugendstrafvollzug und dessen historischer Hintergrund
- Soziale Arbeit im Jugendstrafvollzug – Betrachtung der Ausgangslage
- Herausforderungen und mögliche Hindernisse im Zwangskontext
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Soziale Arbeit im Zwangskontext und analysiert, wie sie den verschiedenen Ansprüchen und Kontroversen in diesem Spannungsfeld gerecht werden kann. Die Arbeit beleuchtet, inwiefern die Soziale Arbeit im Zwangskontext den Menschenrechten gerecht werden kann, während sie gleichzeitig den rechtlichen Vorgaben und dem Auftrag der Institution folgt.
- Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession
- Der Zwangskontext in der Sozialen Arbeit
- Das Tripel Mandat und seine Bedeutung für die Soziale Arbeit
- Methodische Herangehensweisen im Zwangskontext
- Die Soziale Arbeit im Jugendstrafvollzug
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung erläutert die ethischen und sozialphilosophischen Herausforderungen, die sich aus dem Spannungsfeld zwischen Menschenrechten und Zwangskontexten für Sozialprofessionelle ergeben. Sie stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Inwieweit kann die Soziale Arbeit im Zwangskontext den verschiedenen Ansprüchen und Kontroversen gerecht werden?
Elementare Begriffe
Dieses Kapitel definiert grundlegende Begriffe, die für die Arbeit relevant sind. Es erläutert die Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession, definiert den Zwangskontext, erklärt das Tripel Mandat und zeigt mögliche methodische Herangehensweisen im Einklang mit der Menschenrechtsprofession auf.
Praxisbeispiel anhand des Jugendstrafvollzugs
Das Kapitel bietet eine praxisnahe Betrachtung der Soziale Arbeit im Jugendstrafvollzug. Es definiert den Jugendstrafvollzug und seinen historischen Hintergrund, beleuchtet die Ausgangslage der Sozialen Arbeit in diesem Bereich und analysiert Herausforderungen und Hindernisse, die sich im Zwangskontext ergeben können.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Sozialer Arbeit im Zwangskontext?
Dies beschreibt Situationen, in denen Klienten nicht freiwillig, sondern aufgrund institutioneller oder rechtlicher Anordnung (z.B. im Gefängnis) professionelle Hilfe aufsuchen.
Was ist das „Tripel Mandat“ in der Sozialen Arbeit?
Es beschreibt die Verpflichtung der Sozialen Arbeit gegenüber drei Instanzen: dem Klienten, dem Träger/Staat und der eigenen Profession (berufliche Ethik/Menschenrechte).
Wie definiert sich Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession?
Sie sieht ihre Aufgabe darin, die Einhaltung der Menschenrechte zu fördern und Klienten vor staatlicher Willkür oder Diskriminierung zu schützen, auch im Strafvollzug.
Welche Herausforderungen bietet der Jugendstrafvollzug für Sozialpädagogen?
Herausforderungen liegen im Spannungsfeld zwischen dem Erziehungsauftrag, dem Sicherheitsbedürfnis der Justiz und der Motivation der oft sanktionierten Jugendlichen.
Kann professionelle Hilfe unter Zwang überhaupt gelingen?
Ja, wenn methodische Herangehensweisen gewählt werden, die trotz des institutionellen Rahmens die Autonomie und Würde des Klienten respektieren.
- Quote paper
- Adrian Herrmann (Author), 2021, Professionelle Arbeit im Jugendstrafvollzug. Klient, Justizsystem und sozialpädagogisches Selbstverständnis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1191508