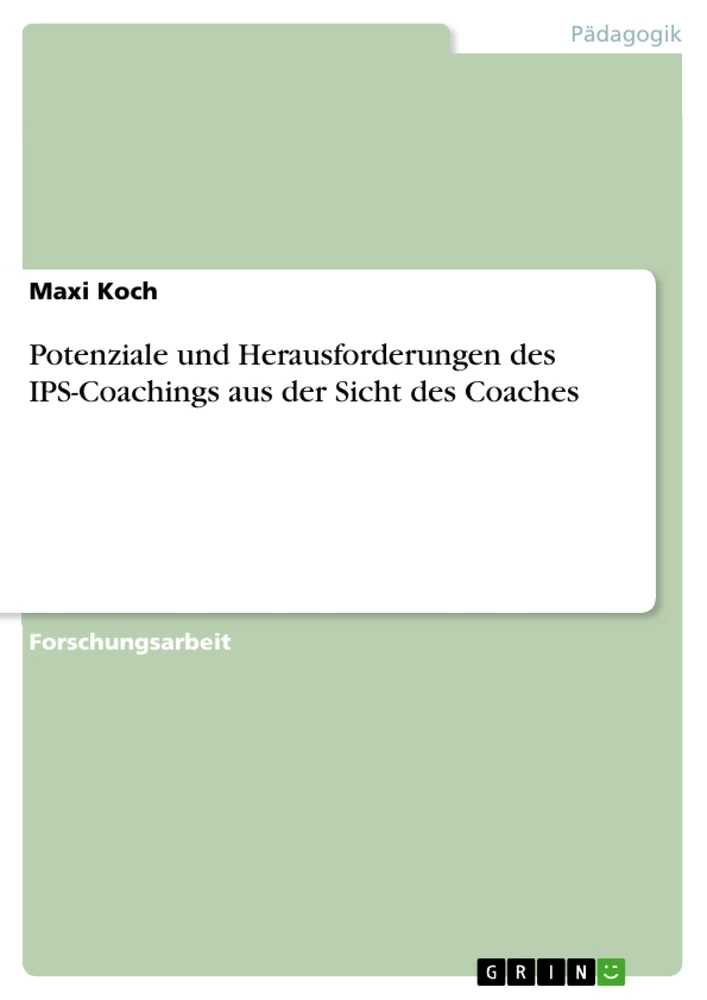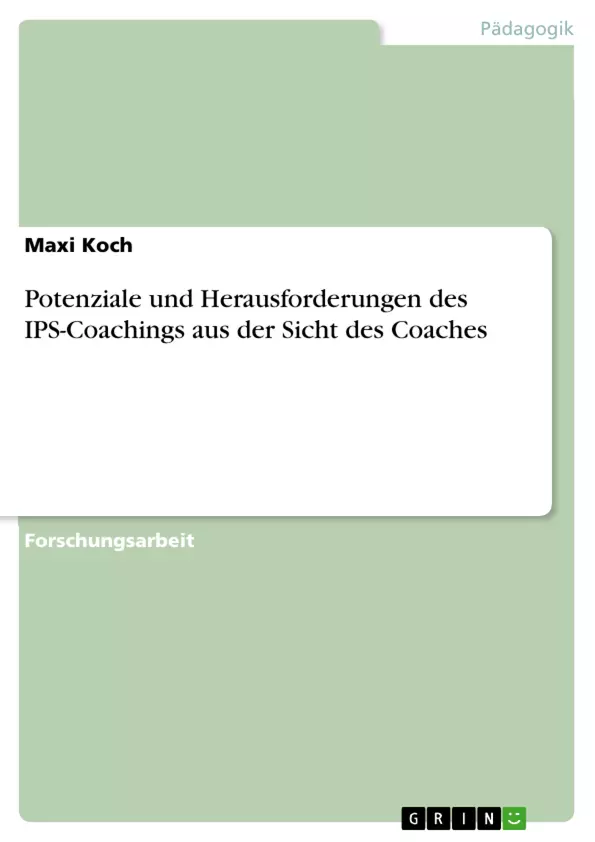Der Forschungsbericht widmet sich mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse dem Pilotprojekt Reha-Pro-IPS (Individual Placement and Support), welches sich mit der Teilhabe von Menschen beschäftigt, die nach einem Klinikaufenthalt wieder in das Berufsleben zurückfinden.
Wie der Name schon beschreibt, handelt es sich bei dem Projekt um die Teilhabe am Berufsleben mit dem Ziel, durch die Erprobung von innovativen Leistungen und organisatorischen Maßnahmen Erkenntnisse zu gewinnen, wie die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch besser erhalten beziehungsweise wiederhergestellt werden kann.
Die folgende Forschungsarbeit beschäftigt sich mit der Forschungsfrage, worin die Potenziale und Herausforderungen des IPS-Coachings aus der individuellen Sicht der Coaches liegen. Dafür werden zunächst die relevanten Begriffe näher beleuchtet.
An dieser Stelle wird der Theorierahmen, der das Projekt umrahmt, dargestellt, um ein besseres Verständnis für den Forschungsgegenstand zu gewinnen. Das Forschungsprojekt wird näher beleuchtet und die Begriffe Beratung und Coaching werden unter Bezugnahme der jeweils anderen Methode definiert.
Im darauffolgenden empirischen Teil der Arbeit werden die Erhebungs- sowie die Auswertungsmethode geschildert. Die im Anschluss dargelegte Interpretation der Ergebnisse beruft sich wieder auf die Forschungsfrage und widmet sich der darauffolgenden Beantwortung dieser, anhand des gewonnen Materials.
Zum Abschluss finden Theorie und Forschungsergebnisse im Fazit wieder zusammen und werden gemeinsam betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Teil
- Vorstellung des Projekts
- Coaching vs. Beratung
- Empirischer Teil
- Methoden
- Erhebungsmethode
- Feldzugang
- Auswertungsmethode
- Interpretation Forschungsergebnisse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Forschungsarbeit befasst sich mit den Potenzialen und Herausforderungen des IPS-Coachings aus der individuellen Sicht der Coaches im Rahmen des Pilotprojekts „RehaPro – IPS Zurück ins Berufsleben“. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie die spezifischen Herausforderungen und Chancen des IPS-Coachings von den Coaches wahrgenommen werden.
- Analyse der individuellen Erfahrungen und Perspektiven der Coaches im IPS-Coaching
- Untersuchung der Potenziale und Herausforderungen des IPS-Coachings für die berufliche Integration von Menschen mit psychischen Erkrankungen
- Bedeutung von individuellen Bedürfnissen und Ressourcen der Klient:innen im IPS-Coaching
- Analyse der Zusammenarbeit zwischen Coaches, Klient:innen und anderen Akteuren im IPS-Coaching
- Bewertung des IPS-Coachings im Vergleich zu anderen Formen der Berufsrehabilitation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Forschungsprojekt „RehaPro – IPS Zurück ins Berufsleben“ vor und erläutert den Kontext der Forschungsfrage. Sie beleuchtet die Bedeutung der beruflichen Teilhabe für Menschen mit psychischen Erkrankungen und die Herausforderungen, die sich dabei stellen. Die Einleitung skizziert die Struktur der Forschungsarbeit und die methodische Vorgehensweise.
Theoretischer Teil
Vorstellung des Projekts
Dieses Kapitel gibt einen detaillierten Überblick über das Forschungsprojekt „RehaPro – IPS Zurück ins Berufsleben“. Es erläutert die Zielsetzung des Projekts, das Konzept des IPS-Coachings und die beteiligten Partner. Der Fokus liegt auf der Bedeutung des IPS-Coachings als Instrument zur Förderung der beruflichen Teilhabe von Menschen mit psychischen Erkrankungen.
Coaching vs. Beratung
In diesem Kapitel werden die Begriffe Coaching und Beratung im Hinblick auf ihre spezifischen Merkmale und Anwendungsbereiche gegenübergestellt. Es wird die Bedeutung dieser Unterscheidung für die Analyse des IPS-Coachings beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Rolle und den Aufgaben des Coaches im IPS-Coaching.
Empirischer Teil
Methoden
Dieses Kapitel beschreibt die methodischen Grundlagen der Forschungsarbeit. Es erläutert die gewählte Erhebungsmethode und die Vorgehensweise bei der Datenerhebung. Darüber hinaus wird die verwendete Auswertungsmethode und die methodische Herangehensweise zur Interpretation der Forschungsergebnisse dargestellt.
Erhebungsmethode
Dieses Kapitel beschreibt die konkrete Vorgehensweise bei der Datenerhebung. Es beleuchtet die Art der Datenerhebung, die Stichprobe und die Instrumente zur Datenerhebung. Der Fokus liegt auf der methodischen Qualität der Datenerhebung.
Feldzugang
Dieses Kapitel erläutert den Prozess der Datenerhebung im Feld. Es beschreibt die Kontaktaufnahme mit den teilnehmenden Coaches und den Ablauf der Datengewinnung. Der Fokus liegt auf der Qualität des Feldzugangs und der ethischen Aspekte der Forschung.
Auswertungsmethode
Dieses Kapitel beschreibt die Vorgehensweise bei der Auswertung der erhobenen Daten. Es erläutert die verwendeten Analyseverfahren und die methodischen Grundlagen der Dateninterpretation. Der Fokus liegt auf der Qualität der Datenanalyse und der methodischen Stringenz.
Interpretation Forschungsergebnisse
Dieses Kapitel analysiert und interpretiert die im empirischen Teil gewonnenen Ergebnisse. Es setzt die Forschungsergebnisse in Beziehung zur Forschungsfrage und beleuchtet die Potenziale und Herausforderungen des IPS-Coachings aus der Sicht der Coaches.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter in dieser Forschungsarbeit sind: IPS-Coaching, Individual Placement and Support, Berufsrehabilitation, psychische Erkrankungen, berufliche Teilhabe, Coaching, Beratung, Potenziale, Herausforderungen, Forschung, Forschungsfrage.
Häufig gestellte Fragen
Was ist IPS-Coaching?
IPS steht für "Individual Placement and Support". Es ist ein evidenzbasierter Ansatz, der Menschen mit psychischen Erkrankungen dabei unterstützt, direkt auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
Worum geht es im Pilotprojekt Reha-Pro-IPS?
Das Projekt untersucht innovative Wege, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen nach einem Klinikaufenthalt zu erhalten oder wiederherzustellen.
Was ist der Unterschied zwischen Coaching und Beratung im IPS-Kontext?
Während Beratung oft lösungsorientierte Expertenvorgaben macht, ist Coaching ein begleitender Prozess, der die individuellen Ressourcen und die Selbsthilfe des Klienten in den Fokus rückt.
Welche Potenziale bietet das IPS-Coaching aus Sicht der Coaches?
Potenziale liegen in der hohen Individualisierung, der schnellen Vermittlung in Arbeit ("First Place, then Train") und der engen, vertrauensvollen Begleitung der Klienten.
Welche Herausforderungen nehmen die Coaches wahr?
Herausforderungen umfassen die Koordination zwischen verschiedenen Akteuren (Kliniken, Arbeitgeber), den Umgang mit psychischen Krisen der Klienten und strukturelle Barrieren im Reha-System.
Wie wurde die Forschung durchgeführt?
Die Studie nutzte eine qualitative Inhaltsanalyse und führte Interviews mit Coaches durch, um deren individuelle Perspektiven und Erfahrungen zu erfassen.
- Quote paper
- Maxi Koch (Author), 2022, Potenziale und Herausforderungen des IPS-Coachings aus der Sicht des Coaches, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1191658