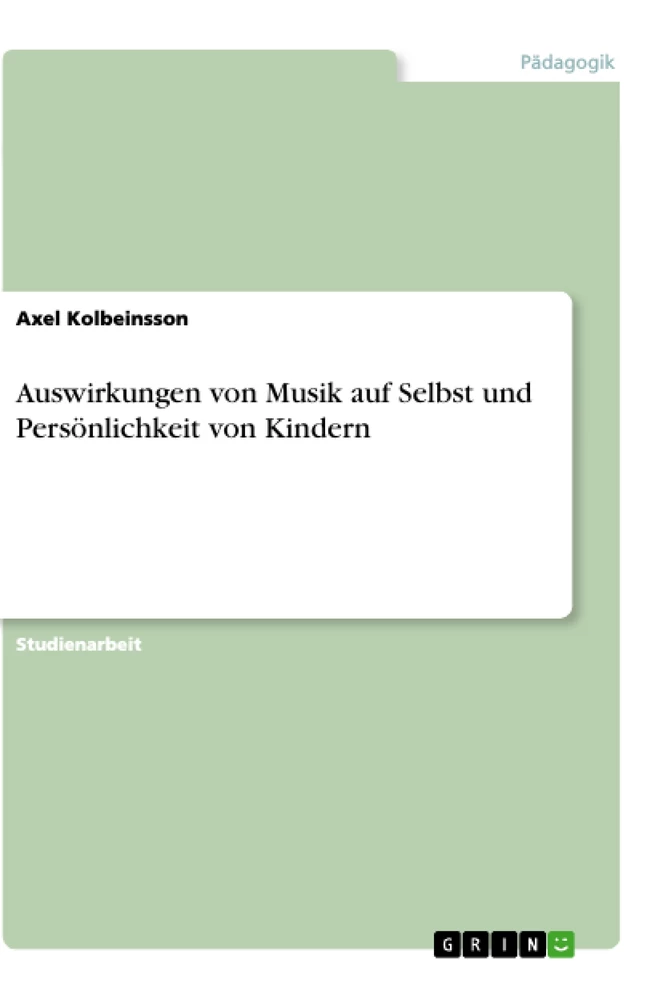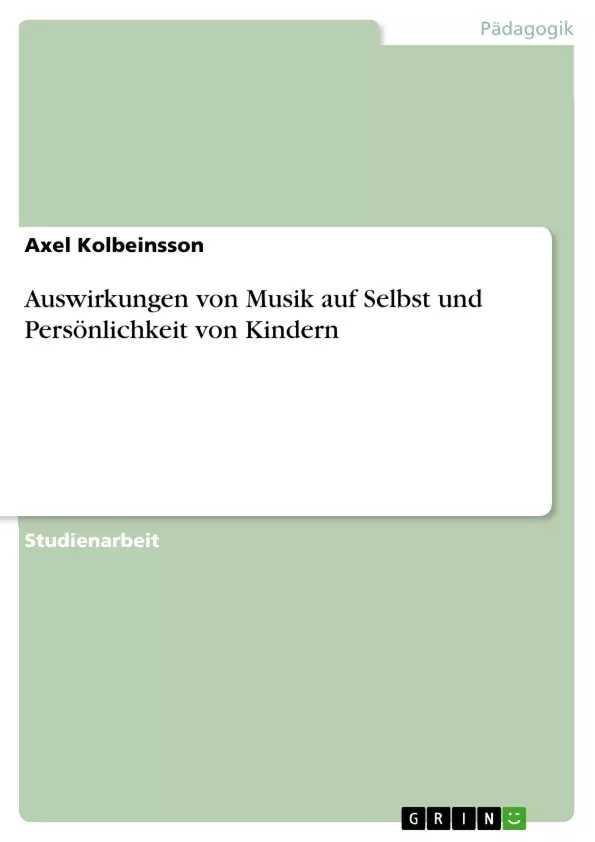Die Arbeit geht der Frage nach, welche Wirkung Musik auf unsere Persönlichkeitsentwicklung insbesondere im Kindesalter hat. Musik ist allgegenwärtig. Sei es als Werbemelodie im TV, die Töne, welche unsere Kopfhörer während der Busfahrt von sich geben oder die Kollegin im Büro, welche in Gedanken versunken eine ihr bekannte Melodie pfeift. Doch was ist Musik? Wie wird sie definiert?
Eine allgemein gültige Definition zu finden ist schwierig da Musik für jeden Menschen eine andere Bedeutung hat. Einige Begriffe werden jedoch oftmals verwendet: Musik besteht aus Tönen, welche in Kombination mit gesungenem Text und in der Form eines Liedes in einer Melodie einander folgen und oftmals von Instrumenten begleitet werden. Um diese Töne auch aufnehmen zu können bedarf es der Unterstützung der drei biologischen Säulen: der kognitiven Leistung des relativen Gehörs, der kognitiv motorischen Leistung und der anatomischen und neuropsychologischen Besonderheiten der menschlichen Stimme.
Musik ist jedoch nicht ausschließlich durch das Gehör wahrnehmbar. Unsere Augen können beispielsweise die Handbewegungen der Musiker auf ihren Instrumenten beobachten oder die Bewegungen der Lippen bzw. des Mundes und des Kehlkopfes eines Sängers erkennen. Zusammen mit den durch die Ohren wahrgenommenen Klängen bilden sich im Gehirn individuelle Reaktionen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entwicklung des Gehirns in Bezug auf akustische Reize
- Vor der Geburt
- Nach der Geburt
- Langzeitstudie zu Wirkungen von Musik und Musizieren auf die Entwicklung 6- bis 12-Jähriger
- Soziale Kompetenz
- Intelligenzentwicklung
- Konzentration
- Musikalische Begabung/ Leistung/ Kreativität
- Angst - Emotionale Labilität
- Allgemeine Schulleistung
- Fazit
- Unmusikalität und Musikalität
- Unmusikalität
- Musikalität
- Das Musikalische Selbstkonzept
- Was ist ein musikalisches Selbstkonzept?
- Die Studie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen von Musik auf die Selbst- und Persönlichkeitsentwicklung von Kindern. Sie analysiert die Entwicklung des Gehirns in Bezug auf akustische Reize, insbesondere die Reaktion von Kindern auf Musik vor und nach der Geburt.
- Der Einfluss von Musik auf die kognitive Entwicklung von Kindern
- Die Rolle von Musik bei der Förderung sozialer Kompetenzen
- Die Entwicklung musikalischer Fähigkeiten und deren Einfluss auf das Selbstbild
- Die Auswirkungen von Musik auf die emotionale Stabilität und das Lernverhalten von Kindern
- Die Verbindung zwischen musikalischer Erfahrung und der allgemeinen Schulleistung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Bedeutung von Musik im Leben von Kindern dar und führt in die Thematik der Arbeit ein. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Entwicklung des Gehirns in Bezug auf akustische Reize und erläutert, wie Kinder bereits vor der Geburt auf Musik reagieren. Das dritte Kapitel präsentiert eine Langzeitstudie, die die Auswirkungen von Musik und Musizieren auf die Entwicklung von Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren untersucht. Der Fokus liegt dabei auf sozialen Kompetenzen, Intelligenzentwicklung, Konzentration, musikalischer Begabung, emotionaler Labilität und Schulleistung. Das vierte Kapitel widmet sich dem Konzept der Unmusikalität und Musikalität, während das fünfte Kapitel das musikalische Selbstkonzept definiert und eine dazugehörige Studie untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen Musikpädagogik, kindliche Entwicklung, akustische Reize, Gehirnentwicklung, musikalisches Selbstkonzept, soziale Kompetenz, Intelligenzentwicklung, Konzentration, emotionale Stabilität und Schulleistung.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst Musik die Gehirnentwicklung von Kindern?
Musik stimuliert kognitive und motorische Leistungen sowie neuropsychologische Prozesse im Gehirn, was bereits vor der Geburt beginnt.
Können Kinder Musik bereits vor der Geburt wahrnehmen?
Ja, das Gehör entwickelt sich früh, und Ungeborene reagieren bereits auf akustische Reize und Melodien aus ihrer Umgebung.
Fördert Musizieren die soziale Kompetenz?
Langzeitstudien zeigen, dass gemeinsames Musizieren die soziale Kompetenz, die Konzentrationsfähigkeit und die Teamfähigkeit von 6- bis 12-Jährigen stärkt.
Was ist das „musikalische Selbstkonzept“?
Es beschreibt die individuelle Wahrnehmung der eigenen musikalischen Fähigkeiten und wie diese das allgemeine Selbstbild und die Persönlichkeit prägen.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Musik und Intelligenz?
Untersuchungen deuten darauf hin, dass eine intensive Beschäftigung mit Musik positive Auswirkungen auf die Intelligenzentwicklung und die allgemeine Schulleistung haben kann.
- Arbeit zitieren
- Axel Kolbeinsson (Autor:in), 2022, Auswirkungen von Musik auf Selbst und Persönlichkeit von Kindern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1191817