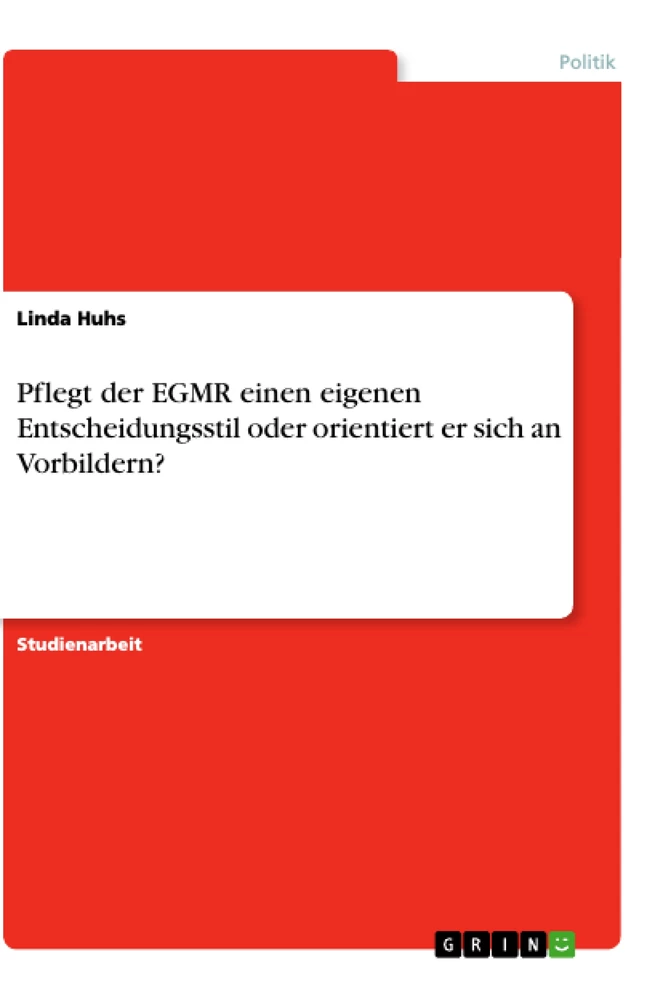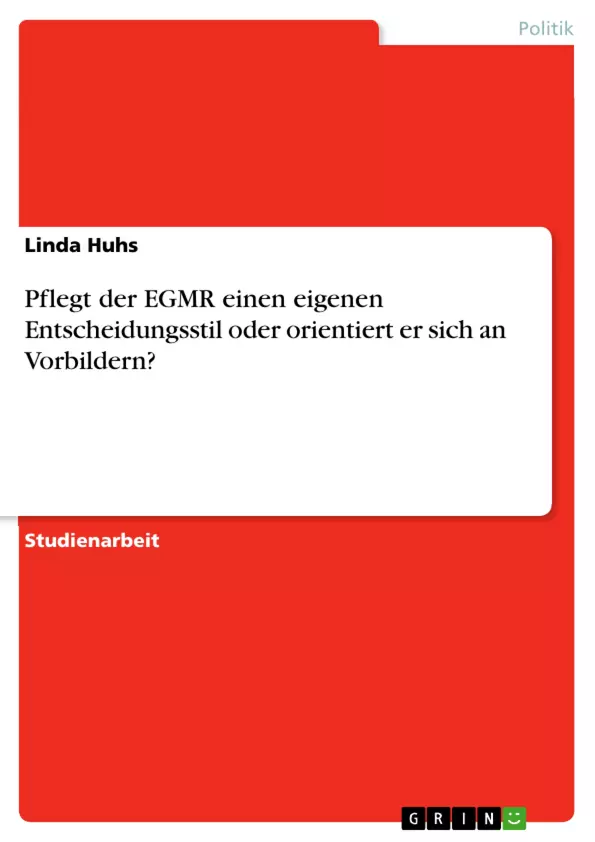Die Arbeit untersucht die Frage, ob der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) einen eigenen Entscheidungsstil pflegt oder ob er sich an Vorbildern orientiert. Dabei wird zunächst die Sprache, der Aufbau und die Struktur der Urteile untersucht. Anschließend wird ein Vergleich mit dem französischen, englischen und deutschen Stil getroffen.
Um geschützte Rechte und Freiheiten durchsetzen zu können, wurde auf europäischer Ebene ein eigenes Rechtsschutzsystem geschaffen. Jedem Einzelnen soll darin mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) ein Gericht zur Verfügung stehen, an das er sich bei Verletzungen seiner Grundrechte wenden kann.
Bei der Frage nach einem „Entscheidungsstil“ des EGMR und möglichen Vorbildern dafür, besteht die Herausforderung zunächst darin, Kriterien festzulegen, die einen Stil ausmachen und beeinflussen können. Nur so wird der Begriff „Entscheidungsstil“ überhaupt greifbar.
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Literaturverzeichnis
I. Einleitung
II. Entscheidungsstil des EGMR
1. Sprache, Aufbau und Struktur der Urteile
2. Sondervoten
3. Adressatenkreis
4. Berücksichtigung der Wirkung der Urteile
5. Leitprinzipien
a, Verhältnismäßigkeitsprinzip
b, Subsidiaritätsprinzip und „margin of appreciation“
6. Individualisierung und Generalisierung
7. Präjudizien
8. Neuere Entwicklungen
9. Kritik
III. Vergleich
1. Vergleich mit französischem Stil
2. Vergleich mit englischem Stil
3. Vergleich mit deutschem Stil
IV. Fazit
Literaturverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
I. Einleitung
Um geschützte Rechte und Freiheiten durchsetzen zu können, wurde auf europäischer Ebene ein eigenes Rechtsschutzsystem geschaffen. Jedem Einzelnen soll darin mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) ein Gericht zur Verfügung stehen, an das er sich bei Verletzungen seiner Grundrechte wenden kann.1
Bei der Frage nach einem „Entscheidungsstil“ des EGMR und möglichen Vorbildern dafür, besteht die Herausforderung zunächst darin, Kriterien festzulegen, die einen Stil ausmachen und beeinflussen können. Nur so wird der Begriff „Entscheidungsstil“ überhaupt greifbar. Zunächst soll daher eine eingehende Analyse der Urteilstechnik erfolgen, die sich neben der Sprache, dem Aufbau und Struktur der Entscheidungen auch mit dem Adressatenkreis auseinandersetzt. Daneben werden die Rechtsfolgen mit einbezogen, denn ein Gericht formuliert seine Urteile stets vor dem Hintergrund der Wirkung seiner Entscheidungen.2 Auch Leitprinzipien der Methodik werden beleuchtet, da die Begründung einer Entscheidung aus der angewandten Dogmatik erwächst. Daneben soll als Abschluss der Analyse auch auf bestehende Kritik an dem Entscheidungsstil eingegangen werden, um so Stärken und Schwächen aufzuzeigen.
Orientiert wird sich bei der Untersuchung an den innerhalb Europas ausgebildeten Urteilsstilen. Hier ist zum einen der englische Stil zu nennen, welcher sich an Präjudizien orientiert und dem Richter einen persönlichen Stil erlaubt. Ergänzt durch die Möglichkeit einer „dissenting opinion“, in der ein Richter, seine abweichende Meinung dem Urteil beifügen kann. Daneben dem französischen Stil, wo apodiktisch ein Ergebnis festgelegt wird. Und als dritten Stil, der deutsche Stil, welcher durch sehr ausführliche Urteile geprägt ist, in denen sich das Gericht nicht nur mit der Rechtsprechung, sondern auch mit der Literatur auseinandersetzt.3
Die Handlungsformen des EGMR lassen sich u.a. in Art. 45 EMRK finden. Hier wird deutlich, dass der EGMR Entscheidungen über Fragen der Zulässigkeit erlässt. Über die Begründetheit einer Beschwerde wird durch Urteil entschieden.
Nachfolgend soll auf die „Entscheidungen“ bzw. Urteile eingegangen werden, in denen im Rahmen der Begründetheit einer Beschwerde eine materielle Rechtsverletzung geprüft wird.
II. Entscheidungsstil des EGMR
1. Sprache, Aufbau und Struktur der Urteile
Die Urteile des EGMR werden auf Englisch oder Französisch verfasst. Die Veröffentlichung ist in beiden offiziellen Sprachen des Europarates vorgesehen.4 Bezüglich der notwendigen Ausführlichkeit der Begründungen der Urteile geben Art. 45 EMRK und Art. 74 VerfO EGMR keine Auskunft. Es wird schlicht aufgeführt, was in einem Urteil enthalten sein muss. Somit steht es im Ermessen des Gerichtshofs wie er die Begründung fasst.5 Dabei bestehen Besonderheiten, die durch den Charakter des EGMR als internationales Gericht und als Menschengerichtshof bedingt sind.6
Ein auffälliges Charakteristikum des Urteilsaufbaus ist die einheitliche Struktur der Begründung. So zeigt sich ein strikter dreigliedriger Aufbau der Urteile.7 Begonnen wird mit der Darstellung des Ablaufs des bisherigen Verfahrens seit Einlegung der Beschwerde bei dem EGMR und Nennung der Verfahrensbeteiligten („Procedure“), danach folgt der ausführliche tatsächliche Teil des Urteils („The facts“), der mit einer Schilderung des Sachverhalts beginnt. Hier kommt es zu einer Darstellung der relevanten innerstaatlichen Rechtslage und Praxis in deren Rahmen häufig insbesondere auch die Judikatur der nationalen Gerichte wiedergegeben wird. Daneben kommt es, falls einschlägig, zu einer relativ breiten Betrachtung internationaler Rechtstexte und Entscheidungen anderer Gerichte. Im anschließenden Part („The law“) wird auf die verschiedenen geltend gemachten Konventionsverletzungen eingegangen. Hierbei folgt das Gericht in der Gliederung dem von den einzelnen EMRK-Rechten vorgegeben Aufbau nach Anwendbarkeit und Einhaltung der Garantie oder Abwehrrechten, die ausdrücklichen Schranken unterliegen, der allgemeinen grundrechtsdogmatischen Struktur aus Schutzbereich, Eingriff und Rechtfertigung des Eingriffs.8
Insgesamt prägt das Urteil ein Argumentationsstil, der in allen Teilen stark auf die Argumentation der involvierten Parteien abgestützt wird.9 So wird ausführlich - wenn auch in jüngerer Zeit kürzer-das Vorbringen der jeweiligen Parteien geschildert. Nach dem Vorbringen des Beschwerdeführers wird das Vorbringen der Regierung wiedergegeben. Dem schließen sich die Rechtsausführungen des Gerichtshofs an. Dabei wird oft weit in der Vorjudikatur ausgeholt, wodurch Rechtsprechungslinien zum Vorschein kommen. Vor allem bei Begründungen der Urteile der Großen Kammer wird oft der Stand der Rechtsprechung zu berührten Themenkreisen allgemein und umfassend dargelegt.10 Zunehmend werden „Grundsätze“ und „Kriterien“ in Katalogen aufgelistet. Besonders deutlich wird dies in dem Fall Üner gg. Niederlande. Hier ordnet das Gericht die Kriterien stichpunktartig untereinander an.11 Eine Systematisierung von Fallgruppen wird so erleichtert und die große Einzelfallbezogenheit der Urteile bis zu einem gewissen Grad ausgeglichen. Ein Verweis auf bereits getroffene Entscheidungen und die Wiedergabe der jeweiligen Begründungsformeln, begünstigen die Kenntnis des Konventionsrechts. Die Tragweite der Urteile wird von den betroffenen Staaten und den entsprechenden Beschwerdeführenden in den aktuellen Fällen oft nicht erkannt.12 Immer wieder bedient sich der Gerichtshof Formulierungen um seine Kompetenz negativ zu umschreiben und seine Zurückhaltung zum Ausdruck zu bringen.13
Jedoch finden sich bei Fällen schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen mit umstrittenen Sachverhalten auch detaillierte Einlassungen, in denen der EGMR der Sache nach selbst eine Beweiswürdigung vornimmt. So hat der Gerichtshof bspw. im Fall Ghimp u.a. gg. Modawien weitere medizinische Gutachten angefordert.14
Ein einheitlicher, nicht variierender Urteilsaufbau bietet sich dem EGMR, aufgrund des eng zugeschnittenen inhaltlichen Jurisdiktionsbereichs und damit der Gleichartigkeit der Materie, über die er jeweils zu entscheiden hat, an.15 Die Urteile des EGMR sind Kollegialentscheidungen der Richter, welche in Zusammenwirkung mit der vom Gerichtshof geführten Kanzlei entstehen. Dadurch wird es möglich einen kohärenter sprachlichen Stil zu wahren.16 Teils ist eine gewisse nationale Prägung im Urteilsstil sichtbar, die sich aus der Prägung der Richter und der in der Kanzlei tätigen Juristen ergibt.17 Abweichungen in Länge, Aufbau und sprachlichem Stil werden durch die abschließende Sprachprüfung abgemildert. Einerseits ist die Entscheidung so für den betreffenden Staat leichter zu rezipieren, andererseits ist zu bedenken, dass die Entscheidungen des Gerichtshofs letztlich faktisch mittelbar für alle Vertragsstaaten gelten.18 Die Notwendigkeit einer Mehrheitsfindung bei Kollegialentscheidungen, verleiht der getroffenen Entscheidung besonderes Gewicht.19 Dabei ist der gemeinsame Diskurs der Richter ein Kernbestandteil in der Entscheidungsfindung.20 Die Entscheidung schafft es in ihrer Form und in ihrer Vermittlung zwischen den Ansichten der Richter eine Art diskursiver Rationalität zu entwickeln die, im sachlichen Tonfall vorgetragen, mehr überzeugen und mehr Legitimität für sich beanspruchen kann, als die persönliche Sondermeinung jedes einzelnen Richters.21
Daneben ist jedoch auch auffällig, dass der Gerichtshof in seinen Urteilen teils sehr empathisch auf die Situation der Beschwerdeführer eingeht.22 So äußerte sich das Gericht im Fall Rees gg. Vereinigte Königreich mit folgenden Worten: „The Court is conscious of the seriousness of the problems affecting these persons and the distress they suffer.“23 So wird deutlich, dass der Gerichtshof sich die Entscheidung nicht einfach macht und nicht schlicht aus vermeintlich irrationalem Mitleid für die Person entscheidet. Ernsthaft sachliche Erwägungen aller vorgebrachten oder denkbaren Argumente zeigen auf, dass die Positionen der Betroffenen ernst genommen und diese nicht einfach selbstgerecht ins „Unrecht“ gesetzt werden.24 Eine ausführliche Urteilsbegründung dient dabei nicht nur der Kohärenz, Transparenz und Kontrollierbarkeit der Entscheidungen, sondern ist Voraussetzung ihrer Rationalität und wesentliche Quelle von Legitimität.25
Ermöglicht wird dies durch ein einheitliches methodisches Vorgehen, welches notwendig ist, um Richter, die aus unterschiedlichen Rechtsordnungen stammen, zu einer Entscheidung zu führen.26 Zwar führt dies zu einem Verlust der jeweiligen individuellen Vorgehensweisen der Richter, diese hier abhanden gekommene Individualität im Entscheidungsstil wird jedoch durch die Möglichkeit der Sondervoten an anderer Stelle wieder ausgeglichen.
2. Sondervoten
Sondervoten kritisieren nicht nur die Begründung des Urteils, sondern dienen auch dazu, transparente Entscheidungsstrukturen und Entscheidungswege aufzuzeigen. Durch eine Stärkung der Richterpersönlichkeiten soll dabei das demokratische Element betont und schließlich das Recht fortentwickelt werden.27 Den Sondervoten der EGMR-Richter kommt daneben noch eine weitere Aufgabe zu, die mit der Stellung des EGMR als internationales Gericht einhergeht. Im internationalen Kontext dienen Sondervoten auch dazu, das Rechtssystem, das Gegenstand des Konventionsverfahrens ist, näher zu erläutern.28 Juristische Meinungsverschiedenheiten sind auch aufgrund der unterschiedlichen kulturellen und juristischen Herkunft der Richter am EGMR unvermeidlich. Das Ziel einen Mindeststandard im Menschenrechtsschutz auf europäischer Ebene zu kreieren bedeutet jedoch nicht, den Pluralismus von Rechtsüberzeugungen zugunsten einer generellen Angleichung zu unterdrücken.29 Sie sind Ausdruck des „Bewusstseins um die Vielfalt in der Einheit.“30 Das gestatten von Sondervoten kann als eine Art taktischer Varianz gesehen werden, die Diplomatie anstrebt, um bei den Vertragsstaaten auf Sympathie zu stoßen.31
3. Adressatenkreis
Zum unmittelbaren Adressatenkreis einer Entscheidung gehören zunächst die beteiligten Parteien und Richter.32 Zum erweiterten Kreis die Öffentlichkeit (darunter auch andere Vertragsstaaten) und die Rechtswissenschaft. Hinsichtlich des Beschwerdeführers und der Vertragsstaaten soll die gerichtliche Argumentation - wenn sie die unterliegende Partei schon nicht überzeugen kann - dennoch intersubjektiv nachvollziehbar sein. Die Rationalität soll Legitimität erzeugen, welche für die Adressaten bei der Reaktion auf die Urteile entscheidend sein kann.33 Die besondere Bedeutung der Vertragsstaaten als Adressaten gründet auf der angestrebten Akzeptanz gegenüber dem Gerichtshof. Von ihr hängt als letzte Konsequenz das Fortbestehen des EGMR ab. Zu einem der Erfolgsfaktoren des Gerichts gehört es, dass es sich stets bewusst war, an wen es sich mit seinen Entscheidungen richtet.34 Durch das Schaffen von Transparenz in Form einer ausführlichen Darstellung der angewandten Methoden wird bei den Adressaten eine Vertrauensbasis geschaffen, welche sich schlussendlich in angemessenen und erfolgreich umgesetzten Maßnahmen, als Reaktion auf das Urteile bemerkbar macht.
4. Berücksichtigung der Wirkung der Urteile
Abgesehen von den Entscheidungen über eine angemessene Entschädigung nach Art. 50 EMRK sind die Urteile des EGMR reine Feststellungsurteile ohne kassatorische Wirkung.35 Sie können weder eine als konventionswidrig erkannte innerstaatliche Maßnahme oder Entscheidung, noch ein Gesetz, auf dem das beanstandete Vorgehen beruht, aufheben.36 Ebenso wenig ist der EGMR befugt, dem betroffenen Staat spezifische Maßnahmen aufzutragen.37 Jedoch sind mittlerweile auch hiervon abweichende Tendenzen zu erkennen, welche auf die Beschwerdeflut am Gerichtshof zurück zu führen sind und zu konkreteren Anordnungen führen. Darauf wird in einem nachfolgenden Punkt noch vertieft eingegangen.
Die Verpflichtung zur Befolgung der Entscheidungen trifft gem. Art. 46 EMRK nur die an dem konkreten Rechtsstreit beteiligten Staaten und wirkt somit inter partes.38 Die Durchführung der Urteile überwacht gemäß Art. 46 II EMRK das Ministerkomitee.
Das Schrifttum sieht jedoch auch die nicht verurteilten Staaten zu einer Angleichung ihrer Gesetze oder Rechtsprechungs- und Verurteilungspraxis verpflichtet.39 Dies wird nicht aus Art. 46 EMRK, sondern aus Art. 1 EMRK hergeleitet, welcher die Mitgliedsstaaten verpflichtet, die in der EMRK gewährleisteten Rechte umfassend und in der Gestalt, die ihnen der EGMR durch seine Rechtsprechung verliehen hat, zu gewährleisten.40
Aufgrund der nur völkerrechtlichen Bindung, welche keine innerstaatliche Möglichkeit der Vollstreckung bietet, muss der Gerichtshof vorsichtig vorgehen und darf seine Befugnisse nicht überdehnen. Um einen effektiven Menschenrechtsschutz in der Praxis zu erreichen, wird versucht die Durchsetzungsschwäche des Völkerrechts durch eine Rechtsprechung zu kompensieren, die auf Akzeptanz bei den Vertragsstaaten und eine darauf folgende „freiwillige“ Bereitschaft zur Umsetzung stößt.41 Obwohl das Urteil andere Vertragsstaaten somit nicht bindet hat es eine „indirekte Wirkung“42 die quasi erga omnes43 gilt.
Dies ist deswegen erstrebenswert, da das Rechtsschutzsystem der Konvention entlastet und die Sicherung der Konventionsgarantien in den innerstaatlichen Bereich verlagert wird. Die Urteile des EGMR zeigen, dass der Gerichtshof die aufgrund des völkerrechtlichen Charakters recht „weiche“ Urteilswirkung in die Entscheidungen miteinbezieht und stets darauf bedacht ist einen betont respektvollen Stil zu wahren.44
5. Leitprinzipien
a, Verhältnismäßigkeitsprinzip
Im fünften Erwägungsgrund der Präambel der EMRK kann mit dem Verweis auf die Rechtsstaatlichkeit verstanden werden, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zur Anwendung kommen soll.45 In der Prüfungsstruktur - welche er als Verhältnismäßigkeitsprüfung „proportionality“46 beschreibt - beginnt der EGMR mit der Erarbeitung des Zwecks der Maßnahme, um festzustellen, ob es sich um ein nach EMRK-Standards „legitimes Ziel“ handelt. Dabei hat er verschiedene Ziele als grundsätzlich legitim anerkannt und entscheidet auf dieser Basis einzelfallbezogen.47 Im Anschluss daran prüft er die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne. Die betroffenen Interessen wägt er dabei umfassend gegeneinander ab. Eine „fair balance“48 wird bejaht, wenn ein Eingriff in einem angemessenen Verhältnis zu dem damit verfolgten legitimen Ziel steht und die zur Rechtfertigung angeführten Gründe „relevant und ausreichend“ sind.49 Teilweise wird inzident auch die Erforderlichkeit einer Maßnahme geprüft, indem nach milderen oder gleich geeigneten Mitteln gefragt wird.50 Regelmäßiger Anknüpfungspunkt ist das Element der Notwendigkeit „in einer demokratischen Gesellschaft“ welches in den Schrankenbestimmungen des Art. 8 - 11 EMRK enthalten ist.51 Für eine solche Unentbehrlichkeit muss gemäß EGMR ein dringendes gesellschaftliches Bedürfnis (pressing social need) vorliegen.52
Dabei ist die Abwägung der gegenläufigen Interessen in der Regel umfassend. Der EGMR bemüht sich um Differenzierung unter Berücksichtigung der Umstände im Einzelfall. In generellen Passagen (general principles) nimmt er auf frühere Entscheidungen Bezug und wendet diese dann unter Herausstellung von Gemeinsamkeiten oder Unterschieden auf den konkreten Fall an (application of the principles of the present case).53 Die Urteile sind an diesen Stellen gezielt ausdifferenziert und entsprechend umfangreich. Damit möchte der EGMR zu einem argumentativ nachvollziehbaren Ergebnis gelangen.54
b, Subsidiaritätsprinzip und „margin of appreciation“
Die von den innerstaatlichen Rechtsordnungen unabhängige Entscheidungsfreiheit des EGMR findet ihr Korrelat im Zugeständnis eines Beurteilungsspielraums, der sog. „margin of appreciation“. Auch wenn die EMRK inzwischen als „instrument constitutionnel de l'odre public européen“55 objektive verfassungsrechtliche Wirkung entfaltet, kommt der Rechtsschutzmechanismus der Konvention nur nachrangig gegenüber nationalem Grundrechtsschutz zum eingreifen.56 So betont der EGMR immer wieder, dass er keine allgemeine Theorie darüber aufzustellen habe, wie gewisse Erfordernisse der Konvention zu verstehen seien oder dass es nicht seine Aufgabe sei, den Staaten Lösungsmodelle aufzuzeigen.57 Für die Funktionalität ist dies wichtig, da es dem EGMR - aufgrund der unterschiedlichen Rechtssysteme über die er zu urteilen hat - anders nicht möglich wäre, seiner Rechtsprechung eine einheitliche Linie zu geben.58
In der Urteilspraxis haben sich dazu Fallgruppen entwickelt. Je nachdem kommt den Staaten dabei ein weiter oder enger Beurteilungsspielraum zu. Dort, wo sich die staatlichen Einrichtungen in einer besseren Position als der internationale Richter befinden, um eine Bewertung durchzuführen, wird ihnen ein entsprechender Spielraum belassen.59 Immer dann, wenn im betreffenden Regelungsbereich ein gemeinsamer Standard der Konventionsstaaten fehlt, ist dies der Fall.60 In den Bereichen, die starken gesellschaftlichen Einflüssen unterliegen, kommt den Staaten ein weiter Spielraum zu. Geht es dagegen um allgemeine Interessen, wird er eng gefasst und der Gerichtshof nimmt die entscheidenden Wertungen selber vor.61 Eine rechtsvergleichende Analyse der nationalen Rechtsordnungen, ob ein gemeinsamer Standard vorhanden ist, führt der EGMR nur im beschränkten Maße durch.62 Er verweist eher auf andere internationale Konventionen oder bereits von ihm entschiedene Fälle.63
6. Individualisierung und Generalisierung
Die grundsätzliche Einzelfallbezogenheit der Urteile hängt mit dem Selbstverständnis des EGMR zusammen. Häufig enthalten die Urteile Formulierungen, welche die Grenzen der Kompetenzen des Gerichtshofs aufzeigen und seine Zurückhaltung zum Ausdruck bringen.64 Diese Auseinandersetzung mit der Reichweite seiner Rechtsprechungsbefugnisse verdeutlicht, dass der EGMR sich mit seiner speziellen, auch politisch geprägten Rolle als internationales Menschenrechtsgericht auseinandersetzt und versucht ihr in jedem einzelnen Fall gerecht zu werden.65
Bei der Individualbeschwerde vor dem EGMR geht es um die Betrachtung einer möglichen konkreten subjektiven Rechtsverletzung. Es ist dabei nicht primäre Aufgabe des Gerichts, die objektive Überprüfung der Rechtslage, im Hinblick auf eine mögliche Unvereinbarkeit mit der Konvention festzustellen.66 Dies wird im Rechtsstreit Pham Hoang gg. Frankreich durch folgenden Zitat deutlich: „ The Court is not called upon to consider in the abstract whether Articles (...) conform to the Convention. Its task is to determine whether they were applied in the instant case in a manner compatible with the presumption of innocence and, more generally, with the concept of a fair trial.“67 Im Urteilsspruch ist daher stets auf die Feststellung einer Rechtsverletzung im konkreten Einzelfall abzustellen.
Jedoch kann der EGMR auch darüber hinausgehen und generalisierungsfähige Aussagen treffen, die auch auf gleichartige Sachverhalte anwendbar sind.68 Im Fall der Staatenbeschwerde Irland gg. Vereintes Königreich äußerte sich der EGMR daher wie folgt: „ The Court's judgmets in fact serve not only to decide those cases brought before the Court but, more generally, to elucidate, safeguard and develop the rules instituted by the Convention, thereby contributing to the observance by the states of the engagements undertaken by them as Contracting Parties.“69 Allgemeine Aussagen, die über den Einzelfall hinaus gültig sind, können als Leitlinien für sämtliche Staaten die faktische Wirkung der Urteile und damit das System der EMRK insgesamt stärken.70
Insbesondere wenn eine Konventionsverletzung zu prüfen ist, die sich aus einem Gesetz oder einem vergleichbaren abstrakt-generellen Rechtsakt ergibt, liegen die Ausführungen des EGMR notwendigerweise auf einer abstrakten Ebene.71 Generalisierungsfähige Ansätze können sich hieraus jedoch nur im Falle einer zahlenmäßig reichhaltigen Judikatur ergeben.72 Der EGMR unterstützt die oben beschriebene „faktische“ Wirkung seiner Urteile indem er zu Beginn auf seine Vorjudikatur verweist und so eine an alle Vertragsstaaten adressierte klare Rechtsprechungslinie deutlich macht.73 Den Vertragsstaaten kann so deutlich aufgezeigt werden, was von ihnen erwartet werden kann, um zukünftigen Verurteilungen vorzubeugen.
Grundsätzlich hat der EGMR keinen Anlass, von seiner gefestigten Rechtsprechung abzuweichen. Auf Kohärenz in seiner Rechtsprechung zu achten, spielt stets eine Rolle und wird maßgeblich durch die Vorarbeit der Kanzlei geprägt.74 Jedoch legt das Gericht stets Wert darauf im jeweiligen Fall individuell zu entscheiden. Das faktenorientierte Vorgehen erlaubt eine gewisse Individualisierung. Dabei bemüht sich der EGMR, nicht einfach Begründungen vom vorherigem Fall zu übernehmen, sondern eine situative Rechtsprechung zu gewährleisten.75
In dem Spannungsfeld zwischen konkreter Einzelfallentscheidung einerseits und der Formulierung allgemein gültiger europäischer Standards andererseits, fällt das zweitgenannte Ziel insbesondere dank der kontinuierlichen Weiterentwicklung der EGMR-Rechtsprechung nicht aus dem Blick.76
7. Präjudizien
Die Freiheit welche der EGMR in seinem Vorgehen innehat, muss durch die stabilisierende Wirkung von Präjudizien abgefedert werden.77 Eine jurisprudence constante ist unumgänglich, da Kohärenz ein mitentscheidendes Merkmal von Rationalität ist.78 Eine Bindung an Präjudizien entsteht aus dem Erfordernis, Gleiches gleich zu behandeln und einer Erwartung an Rechtssicherheit.79 Unter der Bedingung eines Normtextes geringer Bindungskraft, wie jenem der EMRK, sind Präjudizien zur Stabilisierung des Entscheidungssystems besonders wichtig.80 Um eine Erstarrung der Rechtsordnung zu umgehen, ist es allerdings notwendig einen Ausgleich zwischen dem Erfordernis der Rechtssicherheit und der Änderung als unzureichend wahrgenommener Entscheidungen zu finden.81 Dabei sind „good reasons“ erforderlich, um von der bisherigen Rechtsprechung abzuweichen.82
Das Recht erhebt stets einen Anspruch auf eine erwartungsstabilisierende Funktion. Diese könnte die Konvention jedoch nicht leisten, wenn alle Fälle im Sinne des juristischen Diskurses uneingeschränkt nach den „besseren Gründen“ entschieden würden.83 Urteile der Großen Kammer prägen allen voran die Anwendung der Konvention. Zwar wenden die Adressaten einer Norm, die Vertragsstaaten, die Norm an, was ebenfalls Auswirkungen auf die Entwicklung der Norm hat84, indem der EGMR aber letztgültig festlegt, ob und wie die Norm auf den Einzelfall anzuwenden ist, kann er als stärkerer Akteur bei der Bestimmung des Norminhalts gesehen werden.85 Die Aufstellung und Einhaltung von Präjudizien führt dabei zu einer Selbstbindung des Gerichts durch die ebenfalls Legitimität generiert wird.86 Die juristische Technik der Leitentscheidung ist auch angesichts der Fülle an Rechtsprechung praktisch unumgänglich.87 Rechtsfragen können über den Verweis verfahrensökomisch gelöst werden können, ohne selbst erneut die argumentative Hauptlast tragen zu müssen.88 Dies ist relevant, wenn viele Urteile in der gleichen oder ähnlichen Sache zu treffen sind.89 Als besondere Form des Umgangs mit diesen Fällen hat der Gerichtshof das Piloturteilsverfahren entwickelt, indem er dem betroffenen Staat klare Maßnahmen anordnet, um Folgebeschwerden zu vermeiden.
8. Neuere Entwicklungen
Funktionsfähig zu bleiben ist für den EGMR unerlässlich. Der Gerichtshof muss aufgrund der Beschwerdeflut Maßnahmen treffen, um einen Menschenrechtsschutz zu gewährleisten, der auch weiterhin auf dem von ihm vorgegebenen Niveau verläuft. Um den Anforderungen gerecht zu werden, wurden daher unter anderem mit dem 14. Zusatzprotokoll entsprechende Reformen getroffen. Neuerungen im Stil der Rechtsprechung sind ebenfalls vor dem Hintergrund der Arbeitsbelastung zu sehen. Der Gerichtshof lehnt es grundsätzlich ab, den verurteilten Staaten Maßnahmen anzuordnen. Konkret erfolgte dies jedoch bspw. im Fall Assanidze gg. Georgien, um einen Beschwerdeführer umgehend aus der Haft zu entlassen.90 Um Wiederholungsbeschwerden zu vermeiden sprach der Gerichtshof im Fall Kudla gg. Polen das erste Mal eine Empfehlung aus. 91 Es enthielt die direkte Aufforderung, ein Rechtsmittel zu schaffen, dass einen vorhandenen Fehler im polnischen Rechtssystems beseitigen sollte. Unter der Berufung auf Art. 46 EMRK hat der EGMR diese Rechtsprechung fortentwickelt.92 Der EGMR sah sich im Fall Hutten-Czapska gg. Polen mit einer Unsumme an Folgebeschwerden konfrontiert. Dabei wurde erstmals die Bezeichnung „pilot procedure“ verwendet, durch welche dem Gerichtshof die Möglichkeit gegeben wird, durch den Erlass eines Grundsatzurteils von der Befassung mit Wiederholungsfällen entlastet zu werden.93 Dieses neue Vorgehen wurde dem Gerichtshof maßgeblich in zwei Resolutionen des Ministerkomitees empfohlen. Der EGMR solle verstärkt auf das eigentliche Problem hinweisen, welches über den Einzelfall hinausgeht.94
In Abkehr der bisherigen Praxis ging der EGMR unter Hinweis auf seine Arbeitsbelastung dazu über, seine Schlussfolgerungen in den genannten Piloturteilen deutlich präziser zu fassen, mit der Konsequenz, dass das Ermessen des Staates eingeschränkt wird.95
Insgesamt kann festgehalten werden, dass der EGMR insbesondere bezüglich der Darstellung des Sachverhalts mit der Wiedergabe langer Passagen der innerstaatlichen Entscheidungen, der Entwicklung der innerstaatlichen Judikatur, sowie der Gesetzeslage, einschließlich der Anführung von Gesetzesmaterialien und von Reformvorhaben anfangs eher zu weiten Urteilsfassungen neigte. Aufgrund der größeren Arbeitsbelastung wird jedoch vor allem jene Fälle betreffend, zu denen es bereits eine reichhaltige Judikatur gibt, die Urteilsfassungen im Allgemeinen eher kürzer gehalten.96
9. Kritik
Der EGMR geht nicht davon aus, eine abstrakte Definition der von der Konvention verwendeten Begriffe oder Rechte und Verpflichtungen geben zu müssen.97 So sei es „nicht Aufgabe des Gerichtshofs, den Staaten Lösungsmodelle aufzuzeigen.“98 Die Konventionsstaaten empfinden dies teils als unbefriedigend, weil damit kaum Richtlinien gegeben werden, um sich den Erfordernissen der Konvention anzupassen. Insbesondere bestimmten Teilen seiner frühen Rechtsprechung wird allgemein wenig Konsistenz bescheinigt.99 Er sollte in den Begründungen der Urteile deutlicher machen, wie er die Erfordernisse der Konvention auffasst und sich nicht auf die Feststellung beschränken, dass im konkreten Fall die Gebote der Konvention nicht respektiert wurden.100 Der EGMR solle auch aufzeigen, was im Einzelfall zur Durchführung seiner Urteile notwendig ist.101 Schließlich befassen die Regierungen den EGMR häufig, um eine authentische Interpretation der aus der Konvention ergebenden Verpflichtungen zu erhalten.102 Flexibilität und Einzelfallgerechtigkeit werden oft positiv gesehen, jedoch wird dem EGMR entgegengehalten, dass seine Rechtsprechung wegen der Anwendung des Konzepts im einzelnen Fall unter mangelnder Vorhersehbarkeit leide.103 Diese Kasuistik führe zu unverständlichem, inkonsistenten case law.104 Eine ausreichende Rechtssicherheit bietende Dogmatik habe er nicht entwickelt.105 Dem Gerichtshof wird vorgeworfen, Entscheidungen zu treffen, in denen fast nur die Fakten aufgelistet werden, ohne aber die eigentlichen Entscheidungsgründe zu benennen. Oft verweise der Gerichtshof z.B. lediglich auf das generelle Vorhandensein einer „margin of appreciation“ ohne die Gründe dafür dazulegen, warum er im konkreten Einzelfall eine Maßnahme nicht strikt überprüfe. Dies wirke sich auf die Nachvollziehbarkeit seiner Entscheidungen und damit auf die Rechtsicherheit aus. Eine bessere Begründung in den Urteilsausführungen wird daher angemahnt.106 Die mit steter Regelmäßigkeit auftretende Kritik der Rechtsunsicherheit zeigt dies z.B. in aller Deutlichkeit, wenn die Präzedenzfallregel des Gerichtshofs, wie folgt kommentiert wird: „No clarication has been given as to what constitutes cogent, weighty or good reasons.“107 Eine solche Kritik verkennt jedoch die Unmöglichkeit dessen, was sie fordert.108 Das Problem der Unsicherheit der Anwendung juristischer Normen auf Einzelfälle ist ein strukturelles und unaufhebbar.109
In Berücksichtigung seiner primären Aufgabe, über den konkreten Beschwerdefall zu entscheiden, soll der EGMR bei der Urteilsbegründung also etwas mutiger sein und die gebotene Vorsicht mit einer großzügigeren Sicht verbinden.110 Wiederum führt dies jedoch an anderer Seite zu Kritik der Vertragsstaaten. Hier wird eine allzu progressive und ausufernde Rechtsprechung des EGMR angemahnt.111 Die besonders laute Kritik von britischer Seite muss vor dem Hintergrund eines beträchtlichen Unmutes über das EGMR- Urteil Hirst gg. Vereinigte Königreich (Nr.2) 112 verstanden werden, welches eine landesweite Diskussion über die Legitimität des EGMR ausgelöst hatte. Auch bei anderen Konventionsstaaten mit gut ausgebautem Grundrechtschutz, lässt sich aufgrund des vermeintlich unterlaufenen Souveränitätsprinzips eine gewisse Unzufriedenheit in der Rechtsprechung des EGMR ausmachen.113
Der EMGR geht - entgegen der weit verbreiteten Annahme - einen Mittelweg zwischen stark einzelfallbezogenen und abstrakt-generellen Begründungen. In seiner Rechtsprechung hat er sich zwar gegen allumfassende, mit Absolutheitsanspruch auftretende und daher stark determinierende Definitionen entschieden. Jedoch bedeutet dies nicht, dass er rein einzelfallbezogen entscheiden würde. Er legt dabei keine abschließenden Definitionen, sondern entscheidungsleitende Faktoren fest.114 Diese treten sowohl in der Auslegung, als auch in der Abwägung der Verhältnismäßigkeitsprüfung auf.115
III. Vergleich
Im nachfolgenden Vergleich soll unter Berücksichtigung der bereits erfolgten Analyse des Entscheidungsstils des EGMR besonders auf die charakteristischen Merkmale der jeweiligen Stile eingegangen werden, um so eine Feststellung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu geben.
1. Vergleich mit französischem Stil
Im Hinblick auf redaktionelle Abfassungen richterlicher Entscheidungen bestehen grundsätzliche Unterschiede.116 In der deutschen und anglo-amerikanischen Tradition verfasste Urteile beinhalten - in Hinblick auf die Zielsetzung, die Parteien zu überzeugen - eine Abwägung der im Rechtsstreit erörterten Argumente.117 Dagegen ist im romanischen Rechtskreis eher ein Streben nach Klarheit und Präzision des Urteils stilprägend.118 In der französischen Rechtsprechung sind Wertungsgrundlagen oder die Andeutung von Zweifeln verpönt, obiter dicta sind unvorstellbar.119 Dies resultiert in einer sehr unterschiedlichen Urteilslänge. Die vor allem im Attendu-Stil verfassten considérants der Urteile des Conseil d'Etat zeigen den weitergehenden Begründungsmangel auf, der bis zu einem vollständigen Begründungsverzicht gehen kann.120 Dass auch französische Richter sich mit Präjudizien auseinandersetzen und das juristische Schrifttum auswerten ist unbestritten. Die vorherrschende Urteilsstilistik verbietet es jedoch, solche Erwägungen offenzulegen und sie so einer allgemein kritischen Prüfung zugänglich zu machen. Französische Urteile versuchen daher eher den Eindruck zu erwecken, als sei es einzig und allein das Gesetz selbst, aus dem mit Hilfe kognitiver Denkakte die konkrete Sachentscheidung abgeleitet wird.121
Der in Frankreich traditionelle Urteilsstil ist zunächst als „imperatoria brevis“122 geschätzt worden, jedoch gerät er mittlerweile in starke Kritik.123 Die Ermittlung einer Tragweite der Urteile sei erschwert und könne so die Rechtsentwicklung negativ beeinflussen.124 Ausführliche Urteilsbegründungen sind daher mittlerweile eine von der Rechtslehre allgemein erhobene Forderung wie folgendes Zitat zeigt: „Il lui faut, dorénavant, non plus seulement bien décider, mais encore expliquer en toute clarté le pourqoui de sa décision.“125 Das erklärt die explizite gesetzliche Verpflichtung der erstinstanzlichen Verwaltungsgerichte, ihre Entscheidungen begründen zu müssen.126
Im Gegensatz etwa zur Tradition der französischen Cour de Cassation hat sich der EGMR von Beginn an bemüht, seine Entscheidungen transparent zu begründet.127 Erste Urteile wie bspw. Lawless gg. Irland orientieren sich dennoch stilistisch an den Urteilen der Cour de Cassation, indem im Teil „En droit“/„The law“ ein einziger langer Satz, unterbrochen von „considérant que“/„whereas“ verwendet wurde.128 Maßgeblichen Einfluss darauf hatte wohl René Cassin als erster Präsident des Gerichtshofs.129 Gewisse Fallkonstellationen und deren Komplexität zeigten jedoch die fehlende Praktikabilität des Stils auf.130 Schnell wurde der anfangs besonders französisch inspirierte Stil apodiktischer Feststellung durch einen Stil der detaillierten Urteilsbegründung und des Verweises auf Präjudizien ersetzt, der sich vor allem im common law,131 aber auch in Deutschland132 und Spanien133 entwickelt hat.134 Im Vergleich zum Gerichtshof der Europäischen Union steht der EGMR - selbst wenn die Urteile des EuGH in den letzten Jahren etwas ausführlicher geworden sind135 - deutlich weniger in der französischen Rechtstradition. Urteile des EuGH sind daher „a far cry from the transparent, easy to read judgments of the ECtHR.“136 Anders als bspw. beim EuGH sind die Richter in Straßburg auch nicht gezwungen, ihre Ausführungen so einfach oder knapp wie möglich zu halten.137 Eine Übersetzung in zahlreiche andere Sprachen bleibt aus, da die Urteile des EGMR wie bereits erwähnt nur auf Englisch und Französisch verfasst und veröffentlich werden.138
2. Vergleich mit englischem Stil
Aufgrund unterschiedlicher Entwicklungen ist die Struktur der Rechtsordnung, die Methodik der Rechtsfindung und damit auch die Stilistik angloamerikanischer Gerichtsentscheidungen eine gänzlich andere, als auf dem europäischen Kontinent.139 In England kam es weder zu einer Bürokratisierung, noch Verbeamtung der Rechtspflege. Daneben blieb eine umfassende legislatorische oder wissenschaftliche Rationalisierung des Rechtsstoffs, wie sie auf dem Kontinent durch die großen Kodifikationen geleistet worden ist, aus. Dies führte zu einem induktiven Denkstil der entsprechend „reasoning from case to case“ vom einzelnen Sachproblem ausgehend die Lösung nicht aus definierten Begriffen abzuleiten versucht, sondern sie auf ihre Sachgerechtigkeit und Vernünftigkeit vor dem Hintergrund ähnlich liegender Fälle überprüft.140 Die Frage nach der Tragweite der einschlägigen Präjudizien, den darin liegenden Entscheidungsgründen (ratio decidendi) und bloßen obiter dicta, sind zentraler Bestandteil des Urteils. Aus ihnen werden allgemeine Regeln, Grundsätze und Prinzipien gewonnen, die auf den konkreten Fall anwendbar sind. Maßgebliche Vorentscheidungen und deren Sachverhalte werden daher ausführlich referiert, sodass sie mit dem streitigen Sachverhalt verglichen werden können. Unterschiede werden herausgearbeitet und auf ihre rechtliche Relevanz geprüft. Durch einen Prozess des Diskurses über die Präjudizien soll die Chance für einen Konsens über die Vernünftigkeit und Angemessenheit der vorgeschlagenen Falllösung erhöht werden.141 Eine kasuistische Differenzierung ist für die Rechtsgewinnung somit entscheidend. Die Begründungen sind regelmäßig anschaulicher und lebensnaher als bei kontinentaleuropäischen Richtern.142 Anglo-amerikanische Richter, welche ein hohes soziales Prestige genießen, sehen dabei keinen Anlass ihre Persönlichkeit hinter einer apodiktischen, abstrakt klingenden Amtssprache - wie sie aus französischen und deutschen Urteilen bekannt ist - zu verstecken und ziehen einen Stil ohne feststehende Formeln, Schemata und Stereotype vor.143 Seit jeher war es den anglo-amerikanische Richtern daneben möglich, abweichende Meinungen in Sondervoten niederzulegen, die einen Bestandteil des Urteils bilden und mit ihm zusammen und dem Namen des Richters veröffentlicht werden.144 Dabei zögern sie nicht Empfindungen bezügliches des Falles Ausdruck zu geben. Dies erfolgt an den Stellen der Urteilsbegründung, in der es um eine Frage geht, die sich nicht in einem begriffstechnischen und dogmatischen Kontext stellt, sondern in Bezug auf ethische und politische Maßstäbe und Wertentscheidungen beantwortet werden muss.145
Die bereits beschriebene Methode des EGMR - der Lösung von Einzelfallfragen unter Beachtung mehr oder weniger einschlägiger, Vorentscheidungen - in Anlehnung an das common law, lässt sich mit der Vielseitigkeit der europäischen Rechtssysteme erklären, denen die Richter entstammen. In der Rechtsprechung eines Gerichtshofes, der sich mit zahlreichen, unterschiedlichen Rechtssystemen auseinander zu setzen hat, spielen rechtsdogmatische Erwägungen zwangsläufig eine geringere Rolle, als in einem einheitlichen Rechtssystem.146 In Abwesenheit eines Rechtssatzes, der dem common law entsprechend stare decisis anordnet, folgt die vermeintliche Bindung an Präjudizien daher aus dem Erfordernis, Gleiches gleich zu behandeln und einer Erwartung an Rechtssicherheit.147 Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, dass die Richter des EGMR keine „case lawyer“ im Sinne einer anglo-amerikanischen Rechtsprechung sind. Es scheint zweifelhaft, ob man überhaupt von einem case law des EGMR sprechen kann, da die für diese Rechtsquelle typische Bindung an Präjudizien eben gerade nicht gegeben ist.148 Richter des EGMR sind zwar gehalten, bereits getroffene Entscheidungen zu lesen, um diese mit in die Entscheidungsfindung einzubeziehen und somit Kohärenz zu gewährleisten, jedoch soll bei der zu treffenden Entscheidung immer auf den jeweiligen Einzelfall abgestellt werden.149 Eine Präjudizienauslegung wie im angelsächsichen Raum ist deswegen unpassend, da fast alle Richter am EGMR kontinental-europäisch rechtlich geprägt sind und die EMRK eine Kodifikation des Rechts darstellt. Der durch ein case law vorgegebene Maßstab wäre hier entweder zu großflächig oder zu banal und kleinflächig, um allen Vertragsstaaten gerecht zu werden.150
Anders als es etwa bei den Entscheidungen des Supreme Court der USA oder des Vereinigten Königreichs der Fall ist, wird die Tatsache, dass der EGMR eine gemeinsame Urteilsbegründung finden muss teils negativ aufgefasst. Es führe zu vagen und undurchsichtigen Begründungen und lasse einen persönlichen Ton vermissen.151 Jedoch wird gerade dadurch die legitimatorische Wirkung der Entscheidungen geformt. Dass die Form und der Tonfall der Urteile des EGMR unpersönlich sind, macht die Legitimation gerade aus. Es besteht durch den Wahlmodus der EGMR-Richter keine Abhängigkeit von Kompetenz oder gar Größe einzelner Richterpersönlichkeiten.152 Auf die dem EGMR möglichen Sondervoten wurde in diesem Zusammenhang bereits eingegangen. Eine persönliche Note soll somit auch hier in den Urteilen gegeben werden.
3. Vergleich mit deutschem Stil
Deutsche Gerichtsentscheidungen haben sowohl mit dem französischen als auch mit dem anglo-amerikanischen Begründungsstil Gemeinsamkeiten. Mit dem französischen Stil teilt die deutsche Rechtsprechung die Neigung einer eher unpersönlichen apodiktischen Amtssprache.153 Ziel sei es „durch äußere Zucht zu erreichen, dass die peinliche Unzulänglichkeit des Persönlichen möglichst ausgeschalten bleibt“. 154 Teils soll dadurch das Missfallen von Richterkollegen vermieden werden.155 Jedoch wird die schwere Verständlichkeit der Urteile für Nichtjuristen heftig kritisiert.156
Gänzlich anders als in der französischen Rechtsprechung erfolgt jedoch der Begründungstext und Sachverhalt nicht nur in reduzierter Form. Im Gegensatz zu der Entwicklung in Frankreich, die dort ausführlichere Begründungen fordert, stellt sich für die deutschen Gerichtsentscheidungen das gegensätzliche Problem dar. Zunehmende Länge der Urteile wird immer kritischer bewertet.157 Die Entscheidungsgründe sollen auf das Wesentliche reduziert und auf weitergehende dogmatische Ziselierarbeit soll verzichtet werden.158
Während Zitate in den Urteilen der französischen Cour de Cassation und des Conseil d'Etat überhaupt fehlen159 sind deutsche Gerichte bei der statistischen Häufigkeit von Schrifttumsnachweisen führend.160 Teils wird vertreten, das Urteil deutscher Gerichte erfolgt wie in einer wissenschaftlichen Abhandlung: „It speaks rather like the professor than the superior.“ 161 Durch die Rechtslehre ist eine Prägung erfolgt, die den argumentativen Stil als rechtsstaatliche Rationalitätsgarantie für die richterliche Entscheidung hervorgebracht hat.162 Die in deutscher und anglo-amerikanischer Tradition verfassten Urteile beinhalten eine Abwägung der im Rechtstreit erörterten Argumente mit dem Ziel, die Parteien zu überzeugen.163 Dabei stimmt die deutsche Rechtsprechung insoweit mit der anglo-amerikanischen überein, als dass auch hier eine offene Erörterung von Präjudizien eine große und wachsende Rolle in der Urteilsbegründung spielt.164 Eine strenge Bindung an obergerichtliche Präjudizien besteht im deutschen Recht jedoch nicht.165 Dabei nehmen die Gerichte oft nicht die Präjudizien selbst, sondern nur die für sie aufgestellten sogenannten „Leitsätze“ zur Kenntnis, die in einer abstrakten, stark verkürzten Formulierung die wesentlichen rechtlichen Aussagen der Gerichtsentscheidungen wiedergeben.166 Im Hinblick auf verallgemeinerungsfähige Grundsätze in den Urteilen gibt bspw. das Bundesverfassungsgericht klare Angaben. In seiner Begründungspraxis neigt es zur Abstraktion.167 Die Darlegung, der maßgeblichen Rechtsgrundsätze nimmt einen breiten Raum ein, wohingegen die Subsumtion des konkreten Einzelfalls häufig knapp ausfällt.168 Die Urteile sind - im Gegensatz zum induktiven Vorgehen des EGMR - eher deduktiv und das Gericht neigt zu Generalisierung.169 Der EGMR hält sich in seiner Entscheidungspraxis eher zurück. Er widmet sich mit einer erstaunlichen Detailgenauigkeit den Besonderheiten des Einzelfalls meist ohne aufzuzeigen, welche fallübergreifenden Erwägungen hieraus abzuleiten wären.170
Bei der Prüfung eines Grundrechtseingriffs sind zwischen BVerfG und EGMR sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede zu entdecken. So entspricht die Prüfung beim EGMR der deutschen Grundrechtsprüfung gemäß der Grundstruktur aus Schutzbereich, Eingriff und Rechtfertigung. Jedoch sind beim EGMR die Schutzbereichsbestimmung und Eingriffe viel genauer geregelt und präziser ausformuliert als in der deutschen Grundrechtsprüfung.171
Auch im Maß der konkreten Vorgaben zeigen sich Unterschiede. Anders als das BVerfG, das teilweise sehr konkrete Rechtsfolgenanordnungen in seinen Urteilen gibt, vermeidet es der EGMR - wie bereits erwähnt - grundsätzlich den Vertragsstaaten konkreten Vorgaben dazu zu machen, wie sie im Einzelnen mit einer festgestellten Konventionsverletzung umzugehen haben, sondern überlassen die Umsetzung der Entscheidung dem Ermessen der betroffenen Parteien. Dieses unterschiedliche Vorgehen ergibt sich schlicht aus dem Grund, da der EGMR - auch wenn er häufig als „Verfassungsgericht Europas“172 bezeichnet wird - nicht verfassungsrechtlich sondern völkerrechtlich eingerichtet ist.
IV. Fazit
Das Streben nach individuellem Grundrechtsschutz einerseits und der Etablierung eines europaweiten Menschenrechtsstandards andererseits prägen die Begründungen der EGMR-Urteile. Dabei muss der Gerichtshof einen Spannungsbogen schlagen zwischen der ihm eingeräumten relativ großen Entscheidungsfreiheit, dem Streben nach möglichst effektivem173 und durchsetzbarem Menschenrechtsschutz und der Rücksichtnahme auf nationale Interessen.174 Ein Urteil, das den Konventionsstaaten Richtlinien geben will, darf daher nicht kursorisch gehalten werden kann, sondern bedarf einer entwickelten Begründung, ohne dass deshalb seine Ausführungen eine „empirische Breite“ annehmen müssen.175
Das folgende Zitat umschreibt den Stil des EGMR mit den treffenden Worten: „The more searching and tentative style of the European Court [...], its open wrestling with the weaknesses as well as the strengths of the position [...] gives winners fewer grounds for gloating and leaves losers less reason to feel angry and alienated...By showing that it has taken serious arguments seriously, a court bolsters the authority of its decision.“176 Der EGMR legt stets Wert darauf, auf die einzelnen Parteipositionen ausführlich einzugehen. Er zeigt den Gang seiner Entscheidungsfindung auf und versucht in einem Drahtseilakt eine Balance zwischen den Interessen aller Beteiligten zu wahren. So finden die Ziele des Einzelnen, der Mitgliedsstaaten und des Gerichtshofs selbst Einfluss in die Entscheidung. Dazu bedient er sich der nötigen Förmlichkeit, zeigt jedoch auch an gegebener Stelle Empathie. Er will Verständnis für die Entscheidungen schaffen und Sympathien gewinnen. Jedoch liegt eben hier auch seine größte Schwäche. Es ist fraglich, ob ein Gericht, das in dem Maß wie der EGMR auf das Wohlwollen der Urteilsadressaten angewiesen ist, überhaupt einen unabhängigen Entscheidungsstil pflegen kann oder ob es nicht stets dem Druck unterliegt zu gefallen.
Anhand der Methodik konnte der EGMR eine europäische Menschenrechtsordnung eigener Prägung aufbauen.177 Der dafür entwickelte Entscheidungsstil ist exakt auf die Erfordernisse angepasst und ergibt sich aus der einzigartigen Stellung des Gerichtshofs als „Verfassungsgericht“ auf völkerrechtlicher Ebene. Bei den gängigen Urteilsstilen bedient sich der Gerichtshof, indem er jeweils das entnimmt was für ihn zielführend ist und entwickelt daraus einen Stil, der wie das gesamte Völkerrecht, ständigen Veränderungen unterliegt.
[...]
1 Heer-Reißmann, Die Letztentscheidungskompetenz des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte in Europa, S. 67f.
2 Gebauer, Parallele Grund- und Menschenrechtsschutzsysteme in Europa?, S. 232.
3 Gruber, Methodische Besonderheiten des Unionsrechts, in: Europarecht - Grundlagen der Union, S. 922.
4 Art. 76 VerfO EGMR; Art 44 Abs. 3 EMRK i.V.m. Art. 78 VerfO EGMR.
5 Meyer-Ladewig/Brunozzi, EMRK Kommentar, Art. 45, Rn. 2.
6 Grabenwarter, Menschenrechtsschutz und Menschenrechtspolitik durch den EGMR, in: Gouvernement des juges - Fluch oder Segen, S. 66f.
7 Grabenwarter/Pabel, EMRK, § 14 Rn. 5.
8 Ebd., § 14 Rn. 5.
9 Grabenwarter/Pabel, EMRK, § 14 Rn. 6.
10 Pabel, Die Rolle der Großen Kammer des EGMR bei der Überprüfung von Kammer-Urteilen im Lichte der bisherigen Praxis, in: EuGRZ 2006, S. 10.
11 EGMR, 18.10.2006 (GK), Üner/NED, Nr. 46410/99, Z. 57f.
12 Grabenwarter/Pabel, EMRK, § 14 Rn. 6.
13 Matscher, Europäische Union und Europäische Menschenrechtkonvention, in: Recht zwischen Umbruch und Bewahrung, S. 519.
14 EGMR, 30.10.2012, Ghimp u.a./MLD, Nr. 32520/09, Z. 52ff.
15 Gebauer, S. 226.
16 Wildhaber, Präjudizienbindung im Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, in: Präjudiz und Sprache, S. 121.
17 Tavernier, Cohérence et impact, S. 419.
18 Ebd., S. 419 f.
19 Baade, Der Europäische Gerichtshof für Menschenrecht als Diskurswächter, S. 288.
20 Arold, Legal Culture of the ECtHR, S. 63.
21 Perelman, Logique juridique, S. 163.
22 EGMR Urteil, Christine Goodwin/Vereinigtes Königreich, Nr. 28957/95, § 90.
23 EGMR Urteil, Rees/Vereinigte Königreich, Nr. 9532/81, § 47.
24 Baade, S. 289.
25 Ebd., S. 286.
26 Baade, S. 288.
27 Gebauer, S. 230f.
28 Grabenwarter, EMRK, § 14 Rn. 7.
29 Gebauer, S. 231.
30 Schweizer/Sutter, Das Institut der abweichenden oder zustimmenden Richtermeinung im System der EMRK, S. 112.
31 Lepsius, Vorlesung zur EMRK, Gedächtnisprotokoll, 23.05.2017.
32 Perelmann, S. 163.
33 Baade, S. 267.
34 Ebd., S. 267.
35 Pietrowicz, Die Umsetzung der zu Art. 6 Abs. 1 EMRK ergangenen Urteile des EGMR in der Russischen Förderation, S. 62.
36 Matscher, EU und EMRK, S. 507.
37 Nordirland Fall 18.1.78 A/25 = EuGRZ 1979, 149, § 187.
38 Grabenwarter, Wirkungen eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte - am Beispiel des Falls M. gegen Deutschland in: JZ, S. 859.
39 Grabenwartner/Pabel, EMRK, § 16, Rn. 8.
40 Cremer, Zur Bindungswirkung von EGMR Urteilen, in EuGRZ 2004, S. 694.
41 Gebauer, S. 220f.
42 Frowein/Villiger, HRLJ 1988, S. 40.
43 Ress, Supranationaler Menschenrechtsschutz und der Wandel der Staatlichkeit in: ZaöRV, S. 630.
44 Lepsius, 30.05.2017.
45 Gebauer, S. 244.
46 EGMR, 25.2.1993, Funke/Frankreich, Serie A Nr. 256-A, Ziff. 55f.
47 Gebauer, S. 245f.
48 EGMR, 7.7.1989, Soering/Vereinigtes Königreich, Serie A Nr. 161, Ziff. 89.
49 EGMR, 26.9.1995, Vogt/Deutschland, Serie A Nr. 323, Ziff. 52.
50 EGMR, 7.12.1976, Handyside/Vereinigtes Königreich, Serie A. Nr. 24 Ziff. 58.
51 Gebauer, S. 246.
52 Keller/Kühne, Verfassungsgerichtsbarkeit des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in: ZaörV, 2016, 76 (2), S. 272.
53 Gebauer, S. 248.
54 Ebd., S. 248.
55 EGMR, 23.03.1995, Loizidou/Türkei, Serie A Nr. 310, Ziff. 75.
56 Gebauer, S. 248.
57 Matscher, EU und EMRK, S. 518f.
58 Gebauer, S. 221.
59 EGMR, 7.12.1976, Handyside/Vereinigtes Königreich, Serie A 24, 12, § 48.
60 EGMR, 28.11.1984, Rasmussen/Dänemark, Serie A87, Ziff. 40f., Gebauer, S. 251.
61 EGMR, 25.8.1998, Hertel/Schweiz RJD 1998-VI, Ziff. 47.
62 Gebauer, S. 252.
63 van Dijk/ van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, S. 87 f.
64 Lepsius, 30.05.2017.
65 Gebauer, S. 229f.
66 Matscher, EU und EMRK, 506.
67 EGMR 25.09.1992, Pham Hoan/Frankreich, Serie A Nr. 243 = EuGRZ 1992, 472, § 33.
68 Matscher, EU und EMRK, 518.
69 EGMR 18.01.1978, Irland/Vereintes Königreich, Serie A Nr. 25, Ziff. 154.
70 Gebauer, S. 234.
71 Matscher, EU und EMRK, S. 510.
72 Gebauer, S. 228.
73 Grabenwarter, EMRK, § 14, Rn. 6.
74 Lepsius, 16.05.2017.
75 Lepsius, 30.05.2017.
76 Gebauer, S. 229.
77 Baade, S. 275.
78 Sudre, L'effectivité des arrêts, RTDH 2008, 937f.
79 Wildhaber, Präjudiz und Sprache, S. 117.
80 Kriele, Rechtsgewinnung, S. 240.
81 Baade, S. 280.
82 EGMR, 11.07.2002, Christine Goodwin/das Vereinigte Königreich [GK], Nr. 28957/95, § 74.
83 Ladeur, Richterrecht und Dogmatik, in: KritV 1996, S. 84f.
84 Baade, S. 277.
85 Venzke, How Interpretation Makes International Law, S. 71.
86 Elster, Ulysses Unbound, S. 272f.
87 Luhmann, Recht der Gesellschaft, S. 356f.
88 Schönberger, Rechtsfindung und Auslegung, VVDStRL 2011, S. 319.
89 Birsan/ Callewaert, Commentaire in: Fabri/Sorel, Motivation des decisions, S. 199f.
90 EGMR 08.04.2004, Assanidze / Georgien, EuGRZ 2004, 268.
91 EGMR 26.10.2000, Kudla / Polen , EuGRZ 2004, 484.
92 Schwaighofer, S. 34.
93 Ebd., S. 35.
94 Resolution 2004 (3) oft he Committee of Ministers on judgments revealing an underlying systemic problem; Recommendation 2004 (6) of the Committee of Ministers to member states in the improvement of domestic remedies.
95 Grabenwarter, EMRK, S. 96.
96 Matscher, EU und EMRK, S. 520.
97 Ebd., S. 519.
98 EGMR, 12.2.85, Colozza u Rubinat/Italien, A/89 = EuGRZ 1985, 631, §§ 29-30.
99 Wachsmann, Conclusions, in: Sudre, L'interprétation, S. 346.
100 Matscher, EU und EMRK, S. 519.
101 Bulach, S. 196.
102 Matscher, EU und EMRK, S. 515.
103 Gebauer, S. 252.
104 Greer, What's wrong?, in: HRQ 2008, S. 700.
105 Scheyli, Konstitutioneller Anspruch des EGMR in: EuGRZ, 2004, S. 634.
106 Macdonald, The Margin of Appreciation in: The European System for the Protection of Human Rights, S. 85.
107 Senden, Interpretation of Fundamental Rights, S. 9.
108 Baader, S. 297.
109 Morlok, Der Text hinter dem Text, in: Verfassung im Diskurs der Welt, S. 134.
110 Matscher, EU und EMRK, S. 520.
111 Keller/Müller, Das Zusammenspiel von Bundesgericht und EGMR analysiert aus dem Blickwinkeln der Subsidiarität, in: Justice-Justiz-Giustizia, 2012/1, S. 3
112 EGMR, 6.10.2005, Hirst/Vereinigtes Königreich (Nr. 2), Nr. 74025/01.
113 Keller/Müller, Das Zusammenspiel von Bundesgericht und EGMR analysiert aus dem Blickwinkeln der Subsidiarität, in: Justice-Justiz-Giustizia, 2012/1, S. 3.
114 Matscher, CEDH cinquantième anniversaire, in: RTDH 2009, S. 918.
115 Baade, S. 282.
116 Danwitz, Verwaltungsrechtliches System und Europäische Integration, S. 43.
117 Touffait/Tunc, Pour une Motivation plus explicite des Décisions de Justice notamment de celles de la Cour de Cassation in: Revue trimmestrielle de droit civil, S. 487.
118 Fromont/Rieg, Introduction au droit allemand, Tome I - Les fondements, S. 207.
119 Kötz, Die Zitierpraxis der Gerichte - Eine rechtsvergleichende Studie, in: RabelsZ, S. 648.
120 Schlette, Die verwaltungsgerichtliche Kontrolle von Ermessensakten in Frankreich, S. 65f.
121 Kötz, Über den Stil höchstrichterlicher Entscheidungen, S. 9.
122 Hariou nach Schlette, S. 65 m. Fn. 309.
123 Touffait/Tunc, S. 487f.
124 Lindon, La Motivation des Arrêts de la Cour de Cassation in: La Semaine juridique, I. 2681, sub IV. b.
125 Rivero, Le Conseil d'Etat, Cour régulatrice, in: Recueil Dalloz, Chronique, S. 159.
126 Art. R 172 V Code des Tribunaux administratifs.
127 Wachsmanns, in: Débats, Le dialogue entre les juges européens est nationaux: incantation ou réalité?, S. 194.
128 EGMR, Lawless gegen Irland (Nr. 3), 1.7.1961, Nr. 332/57.
129 Eudes, Pratique judiciaire interne, S. 286.
130 Ebd., S. 286.
131 Ebd., S. 287f.
132 Lübbe-Wolff, Beratungskultur des BVerfG, EuGRZ 2014, 509.
133 Sweet, Governing with Judges, S. 145.
134 Baade, S. 287.
135 Ebd., S. 287.
136 Arold Lorenz, European Rights Culture, S. 52f.
137 Gebauer, Parallele Grund- und Menschenrechtsschutzsysteme in Europa?, S. 229.
138 Art. 76 VerfO EGMR; Art 44 Abs. 3 EMRK i.V.m. Art. 78 VerfO EGMR.
139 Kötz, Über den Stil höchstrichterlicher Entscheidungen, S. 12.
140 Ebd., S. 14.
141 Ebd., S. 15.
142 Ebd., S. 17.
143 Ebd., S. 13, 17.
144 Ebd., S. 18.
145 Kötz, Über den Stil höchstrichterlicher Entscheidungen, S. 18.
146 Matscher, Methods of Interpretation of the Convention, S. 63f.
147 Wildhaber, Präjudiz und Sprache, S. 117.
148 Matscher, EU und EMRK, S. 509.
149 Lepsius, 16.05.2017.
150 Lepsius, 13.06.2017.
151 Senden, Interpretation of Fundamental Rights, S. 21.
152 Baade, S. 288.
153 Kötz, Über den Stil höchstrichterlicher Entscheidungen, S. 19.
154 Less, Über die Vorliebe des deutschen Richters für das Unpersönliche in: JZ, S. 468.
155 Kötz, Über den Stil höchstrichterlicher Entscheidungen, S. 25.
156 Sattelmacher/Lüttig/Beyer, Bericht, Gutachten und Urteil, S. 202.
157 BMJ, Bericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Situation in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, 1988, S.11.
158 Franßen, Grußwort zum 10. Verwaltungsrichtertag in Aachen, DVBl. 1992, S. 467.
159 Schlette, S. 66.
160 Kötz, Die Zitierpraxis der Gerichte - Eine rechtsvergleichende Studiue, RabelsZ 1988, S. 657 f.
161 Wetter, The styles of Appelate Judicial Opinions, S. 71.
162 Danwitz, S. 45
163 Ebd., S. 43.
164 Kötz, Über den Stil höchstrichterlicher Entscheidungen, S. 19.
165 Ebd., S. 21.
166 Ebd., S. 21.
167 Danwitz, S. 43.
168 Paetzold, Linien der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, S. 550.
169 Lepsius, 23.05.2017.
170 Paetzold, 550f.
171 Lepsius, 13.06.2017.
172 Keller/Kühne, S. 248.
173 EGMR, Airey gegen Irland vom 09.10.1979, Nr. 6289/73, § 24.
174 Gebauer, S. 221.
175 Matscher, EU und EMRK, S. 521.
176 Glendon, Rights Talk, S. 155.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Entscheidungsstil des EGMR?
Der Entscheidungsstil des EGMR (Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte) wird durch eine Kombination aus formeller Struktur, Berücksichtigung von Parteieninteressen und dem Streben nach einem gesamteuropäischen Menschenrechtsstandard geprägt. Die Urteile folgen einem dreigliedrigen Aufbau: Verfahrensdarstellung, Sachverhaltsfeststellung und rechtliche Würdigung. Das Gericht stützt sich stark auf die Argumentation der Parteien und nimmt Bezug auf seine Vorjudikatur. Es wägt die betroffenen Interessen ab und berücksichtigt das Verhältnismäßigkeitsprinzip und den Beurteilungsspielraum der Staaten ("margin of appreciation").
Welche Kriterien beeinflussen den Entscheidungsstil des EGMR?
Mehrere Faktoren beeinflussen den Entscheidungsstil des EGMR:
- Sprache und Struktur der Urteile: Die Urteile werden in Englisch oder Französisch verfasst und folgen einer einheitlichen Struktur.
- Sondervoten: Richter können Sondervoten abgeben, um ihre abweichenden Meinungen zu äußern.
- Adressatenkreis: Das Gericht berücksichtigt die beteiligten Parteien, die Öffentlichkeit, die Rechtswissenschaft und die Vertragsstaaten.
- Wirkung der Urteile: Der EGMR berücksichtigt, dass seine Urteile Feststellungsurteile sind und die Umsetzung den Vertragsstaaten obliegt.
- Leitprinzipien: Das Gericht wendet das Verhältnismäßigkeitsprinzip und das Subsidiaritätsprinzip an.
- Individualisierung und Generalisierung: Die Urteile sind einzelfallbezogen, enthalten aber auch generalisierungsfähige Aussagen.
- Präjudizien: Der EGMR orientiert sich an seiner Vorjudikatur, kann aber unter bestimmten Umständen davon abweichen.
Wie unterscheidet sich der Entscheidungsstil des EGMR von französischen, englischen und deutschen Urteilsstilen?
Der Entscheidungsstil des EGMR unterscheidet sich in einigen Punkten von den nationalen Urteilsstilen:
- Französischer Stil: Der französische Stil ist durch Klarheit und Präzision gekennzeichnet. Wertungsgrundlagen oder Zweifel werden vermieden, und obiter dicta sind unüblich. Im Gegensatz dazu bemüht sich der EGMR um transparente Begründungen und bezieht Präjudizien ein.
- Englischer Stil: Der englische Stil ist induktiv und orientiert sich stark an Präjudizien. Richter haben mehr Freiheit, ihren persönlichen Stil einzubringen. Der EGMR lehnt sich an das Common Law an, um die unterschiedlichen Rechtssysteme Europas zu berücksichtigen, vermeidet aber strikte Bindung an Präjudizien.
- Deutscher Stil: Der deutsche Stil ist durch eine unpersönliche Amtssprache und ausführliche Begründungen gekennzeichnet. Der EGMR verfolgt einen Mittelweg zwischen Einzelfallbezogenheit und der Formulierung allgemeiner europäischer Standards.
Welche neueren Entwicklungen gibt es im Entscheidungsstil des EGMR?
Um mit der Beschwerdeflut umzugehen, hat der EGMR einige Reformen durchgeführt, darunter das Piloturteilsverfahren. In diesem Verfahren kann das Gericht dem betroffenen Staat konkrete Maßnahmen anordnen, um Folgebeschwerden zu vermeiden. Der EGMR ist auch dazu übergegangen, seine Schlussfolgerungen in Piloturteilen präziser zu fassen, was das Ermessen der Staaten einschränkt.
Welche Kritik gibt es am Entscheidungsstil des EGMR?
Einige Kritikpunkte am Entscheidungsstil des EGMR sind:
- Mangelnde Konsistenz und Vorhersehbarkeit in der Rechtsprechung
- Unzureichende Dogmatik und fehlende Rechtssicherheit
- Mangelnde Klarheit bei der Anwendung des Konzepts des Beurteilungsspielraums
- Eine allzu progressive und ausufernde Rechtsprechung, die das Souveränitätsprinzip unterläuft
Was ist das Fazit zum Entscheidungsstil des EGMR?
Der Entscheidungsstil des EGMR ist das Ergebnis des Spannungsfelds zwischen individuellem Grundrechtsschutz und der Etablierung eines europaweiten Menschenrechtsstandards. Der EGMR bemüht sich um eine Balance zwischen Entscheidungsfreiheit, effektivem Menschenrechtsschutz und Rücksichtnahme auf nationale Interessen. Obwohl der Stil des EGMR kritisiert wird, hat er es dem Gericht ermöglicht, eine europäische Menschenrechtsordnung eigener Prägung aufzubauen.
- Citar trabajo
- Linda Huhs (Autor), 2018, Pflegt der EGMR einen eigenen Entscheidungsstil oder orientiert er sich an Vorbildern?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1192039