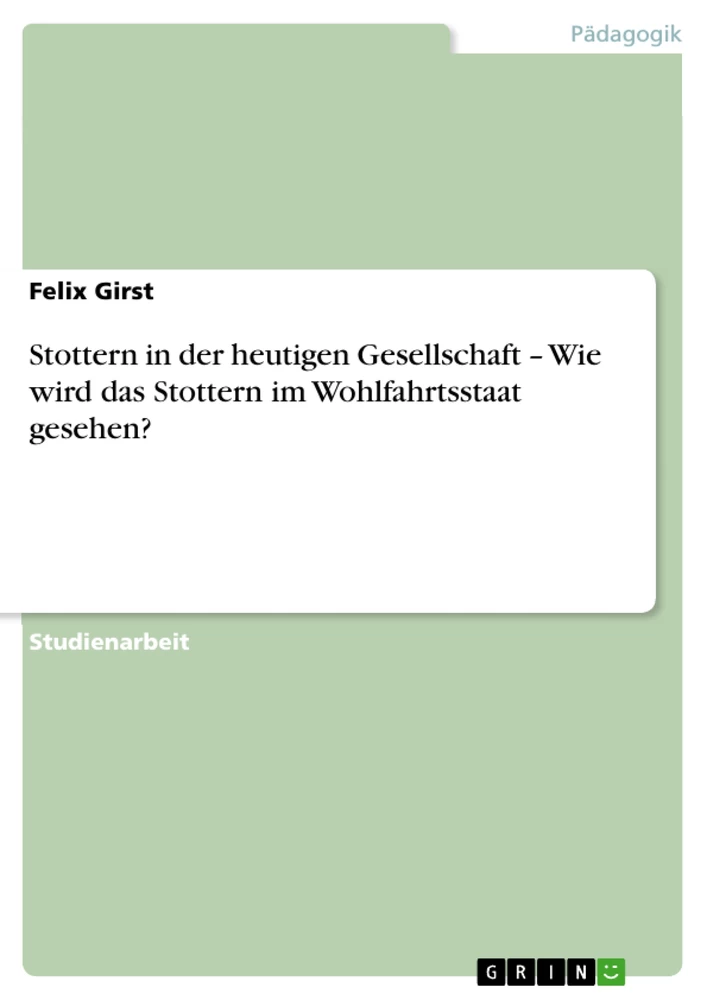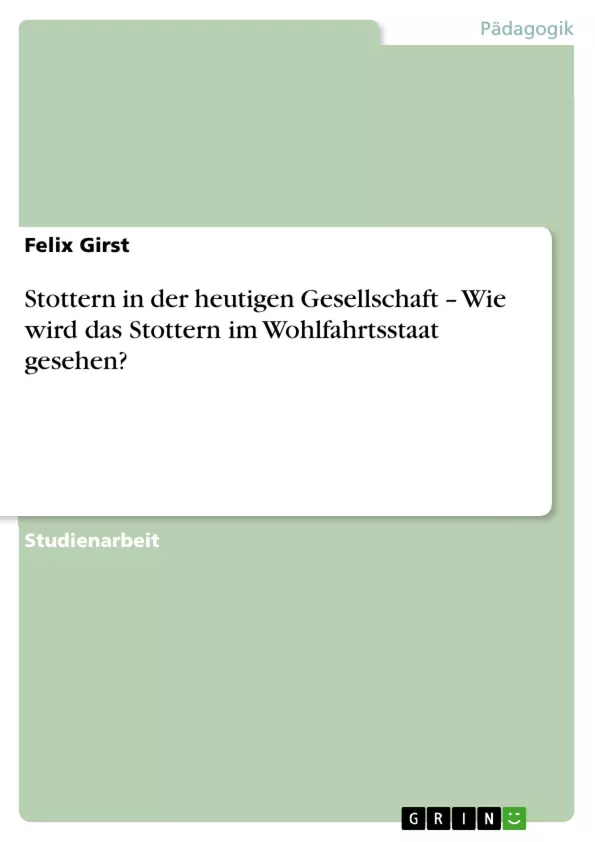Stottern in der heutigen Gesellschaft – Wie wird das Stottern im Wohlfahrtsstaat gesehen?
Die Frage drängt sich auf, wie das Stottern in der heutigen Gesellschaft gesehen wird und wie das Stottern im Wohlfahrtsstaat gesehen wird. Anfangs bedarf es eine genaue Begriffsbestimmung bevor wir in die Ätiologie gehen. Anschließend wird die UN-Behindertenrechtskonvention erläutert und das Stottern in der Gesellschaft beschrieben. In der Familie, der Schule und der Gesellschaft wird der Fokus gesetzt und die unterschiedlichen Lebenslagen sowie Perspektiven diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffserklärung
- 2.1 Behinderung
- 2.2 Stottern
- 2.3 Wohlfahrtsstaat
- 3. Ätiologie
- 4. UN-Behindertenrechtskonvention
- 5. Exkurs: ICF-Modell
- 6. Exklusion im Wohlfahrtsstaat durch das Stottern
- 7. Stottern in der heutigen Gesellschaft
- 7.1 Familie
- 7.2 Schule und Arbeit
- 7.3 Gesellschaftliches Leben
- 8. Staatliche Hilfen
- 9. Möglichkeiten der barrierefreien Teilhabe von Stotterern am Wohlfahrtsstaat
- 10. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wahrnehmung und den Umgang mit Stottern im deutschen Wohlfahrtsstaat. Sie beleuchtet die Definition von Stottern als Behinderung, die gesellschaftlichen Auswirkungen und die Möglichkeiten der Teilhabe von stotternden Menschen. Die Arbeit analysiert den Einfluss von Stottern auf verschiedene Lebensbereiche und die verfügbaren staatlichen Unterstützungssysteme.
- Definition und Auswirkungen von Stottern
- Stottern als Behinderung im Kontext des Wohlfahrtsstaates
- Gesellschaftliche Wahrnehmung und Diskriminierung von Stotterern
- Staatliche Hilfen und Unterstützungsmöglichkeiten
- Barrierefreie Teilhabe von Stotterern am gesellschaftlichen Leben
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und benennt die hohe Anzahl von Stotterern in Deutschland. Sie betont die Bedeutung der Sprache für die menschliche Entwicklung und Kommunikation und hebt hervor, dass Stottern als Beeinträchtigung der Sprache eine erhebliche Auswirkung auf die soziale Teilhabe hat. Der einleitende Zitat von Wilhelm von Humboldt unterstreicht die zentrale Rolle der Sprache für die menschliche Identität. Der einleitende Abschnitt liefert einen ersten Überblick über die Thematik und führt die wesentlichen Fragestellungen der Arbeit an.
2. Begriffserklärung: Dieses Kapitel liefert eine präzise Definition von Behinderung gemäß SGB IX und erläutert Stottern als Sprachbehinderung, differenziert von Poltern. Es werden die verschiedenen Aspekte der Sprache und ihrer Komponenten detailliert dargelegt und die Bedeutung flüssigen Sprechens für die soziale Interaktion hervorgehoben. Die Definition von Stottern wird genau eingegrenzt und von anderen Sprachstörungen abgegrenzt. Das Kapitel legt die Grundlage für das Verständnis der weiteren Ausführungen.
3. Ätiologie: [Da der bereitgestellte Text keine Informationen zur Ätiologie enthält, kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden.]
4. UN-Behindertenrechtskonvention: [Da der bereitgestellte Text keine Informationen zur UN-Behindertenrechtskonvention enthält, kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden.]
5. Exkurs: ICF-Modell: [Da der bereitgestellte Text keine Informationen zum ICF-Modell enthält, kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden.]
6. Exklusion im Wohlfahrtsstaat durch das Stottern: [Da der bereitgestellte Text keine Informationen zu diesem Kapitel enthält, kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden.]
7. Stottern in der heutigen Gesellschaft: Dieses Kapitel beleuchtet die Auswirkungen von Stottern auf verschiedene Lebensbereiche: Familie, Schule und Arbeit sowie das gesellschaftliche Leben. Es beschreibt die Herausforderungen, denen stotternde Menschen in diesen Kontexten begegnen, wie z.B. Ablehnung, Statusverlust und soziale Isolation. Der Kontrast zur heutigen, perfektionsorientierten Gesellschaft wird herausgestellt, in der selbst kleine Abweichungen schnell als störend wahrgenommen werden.
8. Staatliche Hilfen: [Da der bereitgestellte Text keine Informationen zu staatlichen Hilfen enthält, kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden.]
9. Möglichkeiten der barrierefreien Teilhabe von Stotterern am Wohlfahrtsstaat: [Da der bereitgestellte Text keine Informationen zu diesem Kapitel enthält, kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden.]
Schlüsselwörter
Stottern, Sprachstörung, Behinderung, Wohlfahrtsstaat, soziale Teilhabe, Kommunikation, Diskriminierung, Inklusion, Sprachtherapie, gesellschaftliche Integration.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Umgangs mit Stottern im deutschen Wohlfahrtsstaat
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Wahrnehmung und den Umgang mit Stottern im deutschen Wohlfahrtsstaat. Sie beleuchtet die Definition von Stottern als Behinderung, die gesellschaftlichen Auswirkungen und die Möglichkeiten der Teilhabe von stotternden Menschen. Die Arbeit analysiert den Einfluss von Stottern auf verschiedene Lebensbereiche und die verfügbaren staatlichen Unterstützungssysteme.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Definition und Auswirkungen von Stottern, Stottern als Behinderung im Kontext des Wohlfahrtsstaates, die gesellschaftliche Wahrnehmung und Diskriminierung von Stotterern, staatliche Hilfen und Unterstützungsmöglichkeiten sowie die barrierefreie Teilhabe von Stotterern am gesellschaftlichen Leben.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Begriffserklärung (Behinderung, Stottern, Wohlfahrtsstaat), Ätiologie, UN-Behindertenrechtskonvention, Exkurs: ICF-Modell, Exklusion im Wohlfahrtsstaat durch das Stottern, Stottern in der heutigen Gesellschaft (Familie, Schule/Arbeit, Gesellschaftliches Leben), Staatliche Hilfen, Möglichkeiten der barrierefreien Teilhabe und Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis bietet eine detaillierte Übersicht.
Welche Definitionen werden verwendet?
Die Arbeit liefert eine präzise Definition von Behinderung gemäß SGB IX und erläutert Stottern als Sprachbehinderung, differenziert von Poltern. Die Definition von Stottern wird genau eingegrenzt und von anderen Sprachstörungen abgegrenzt.
Welche Auswirkungen von Stottern auf das Leben Betroffener werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die Herausforderungen, denen stotternde Menschen in verschiedenen Lebensbereichen begegnen, wie z.B. Ablehnung, Statusverlust und soziale Isolation in Familie, Schule/Arbeit und im gesellschaftlichen Leben. Der Kontrast zur heutigen, perfektionsorientierten Gesellschaft wird hervorgehoben.
Welche Informationen zu staatlichen Hilfen und Unterstützungsmöglichkeiten werden gegeben?
Der bereitgestellte Text enthält leider keine konkreten Informationen zu staatlichen Hilfen und Unterstützungsmöglichkeiten für Stotternde. Dieses Thema wird in der vollständigen Arbeit detaillierter behandelt werden.
Welche Informationen zur UN-Behindertenrechtskonvention, Ätiologie und dem ICF-Modell sind enthalten?
Der bereitgestellte Text enthält keine Informationen zur UN-Behindertenrechtskonvention, zur Ätiologie von Stottern und zum ICF-Modell. Diese Aspekte werden in der vollständigen Arbeit behandelt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Stottern, Sprachstörung, Behinderung, Wohlfahrtsstaat, soziale Teilhabe, Kommunikation, Diskriminierung, Inklusion, Sprachtherapie, gesellschaftliche Integration.
- Quote paper
- Felix Girst (Author), 2022, Stottern in der heutigen Gesellschaft – Wie wird das Stottern im Wohlfahrtsstaat gesehen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1192272