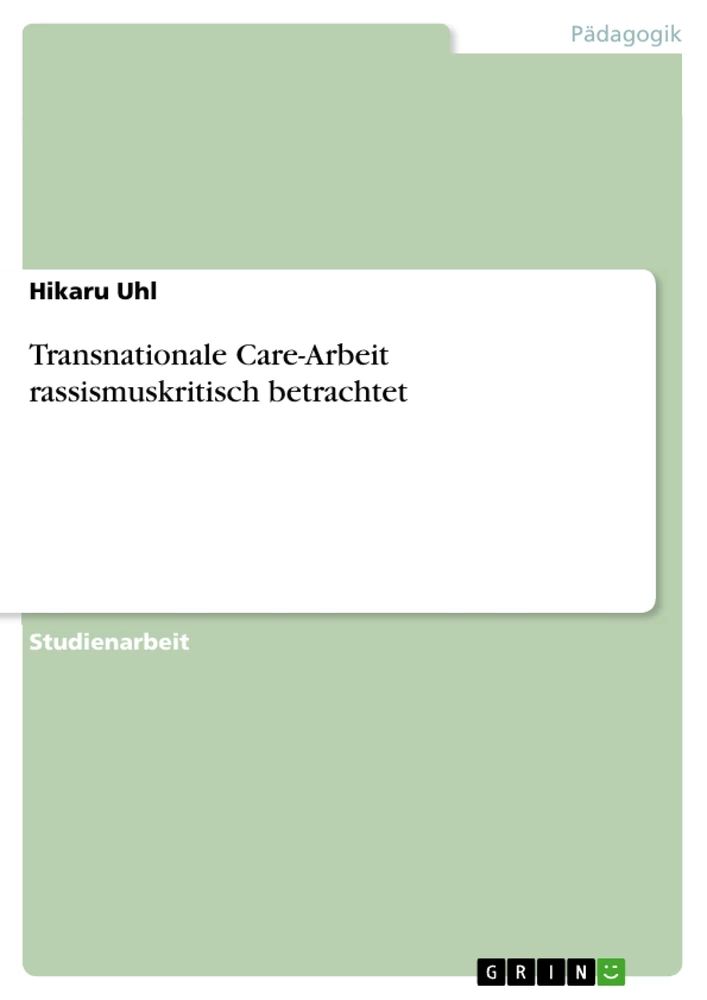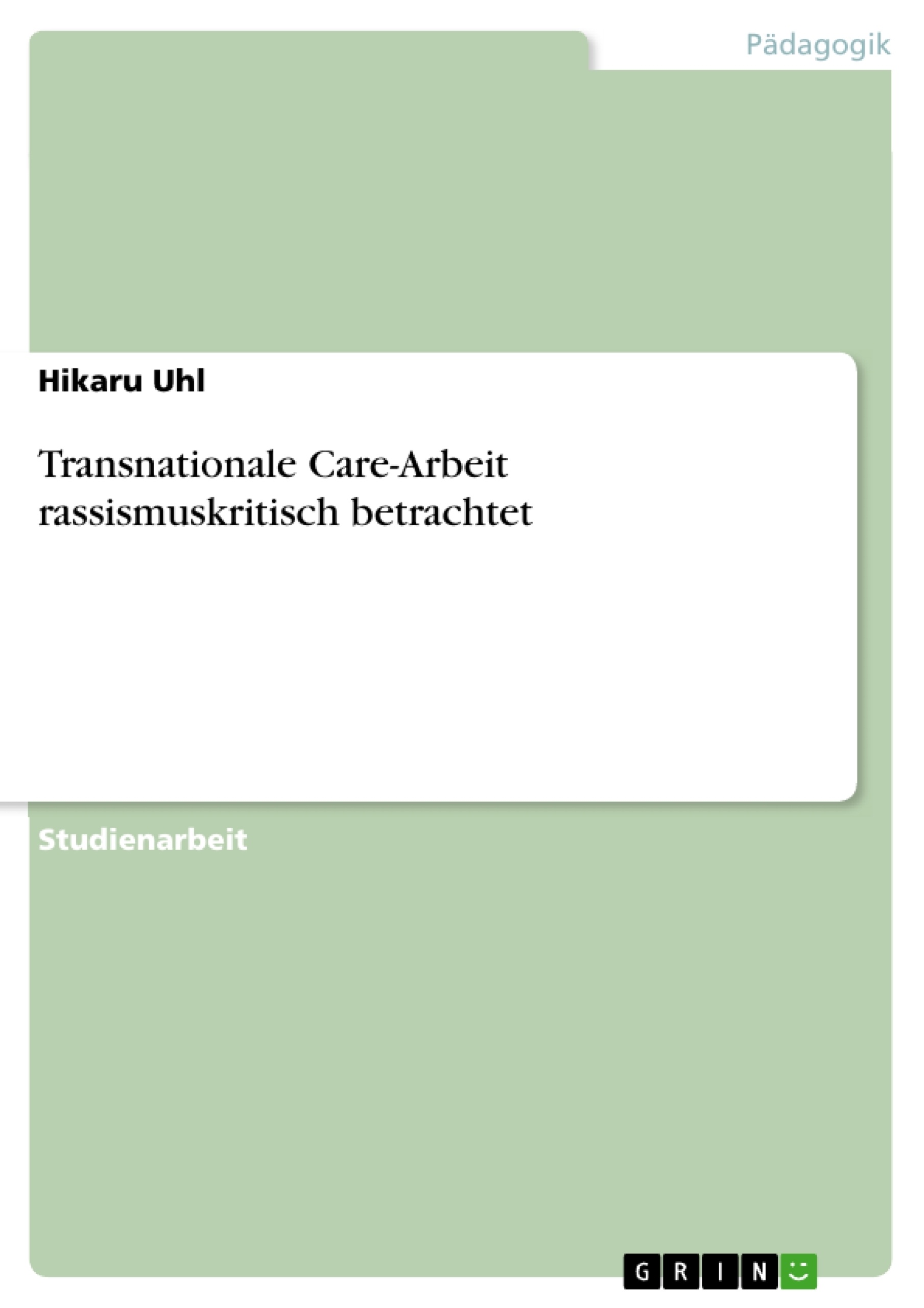Inwiefern gründet das Konzept der transnationalen Care-Arbeit auf Rassismen bzw. stärkt diese?
Wer kennt das nicht: Pflegebedürftige Menschen, die von einer 24h-Pflegekraft aus beispielsweise Osteuropa in ihren eigenen vier Wänden betreut werden. Längst ist dies kein Einzelfall mehr, sondern scheint zu einem etablierten Modell zu mutieren. Dieser beschriebene Fall fällt unter anderem unter die Bezeichnung der sogenannten transnationalen Care-Arbeit. Care-Arbeit umfasst sorgende Tätigkeiten, und der Begriff transnational kennzeichnet hierbei, dass Menschen ihre Heimat verlassen, um anderswo, in der Regel in reicheren Ländern, diese Care-Arbeit zu leisten. Aus einer ökonomischen Perspektive finden sich gehäuft Stimmen die diese transnationale Care-Arbeit als eine win-win Situation bezeichnen, da die Care-Arbeiter*innen zum einen finanziell besser dastehen und durch ihre beachtenswerte Summe an Rücküberweisungen in ihr Heimatland eine Art Entwicklungshilfe darstellen. Zum anderen profitieren die Käufer*innen transnationaler Care-Arbeit von den günstigen und flexiblen Arbeitskräften die eine gute Alternative zum deutschen Pflegesystem bieten. Doch darf der Blickwinkel meiner Meinung nach keinesfalls ausschließlich auf dem ökonomischen zum erliegen kommen, denn transnationale Care-Arbeit ist ein Phänomen das in hohem Maße auf verschiedenen gesellschaftlich tief eingebetteten Konstruktionen basiert und diese auch gewissermaßen hervorbringt bzw. sichtbar macht. Meines Erachtens nach sind die Rassekonstruktion und die Geschlechterkonstruktion besonders schwerwiegend dabei, welche Formen die transnationale Care-Arbeit annimmt und hervorbringt. Daher soll hier der Fokus auf die rassismuskritische Perspektive gelegt werden, und die feministische Perspektive zusätzlich mit einbezogen werden. Aufgrund der offensichtlich prekär anmutenden Arbeitsbedingungen und Löhne von Care-Arbeiter*innen die aus dem Ausland kommen um in Deutschland tätig zu sein, lässt sich die Annahme formulieren, dass auch das Konzept der transnationalen Care-Arbeit an Rassekonstruktionen anschließt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die transnationale Care- Arbeit
- 3. Die rassismuskritische und feministische Perspektive
- 4. Transnationale Care- Arbeit aus rassismuskritischer und feministischer Perspektive
- 4.1 Umverteilung sozialer Güter
- 4.2 Rechtliche Rahmenbedingungen transnationaler Care- Arbeit
- 4.3 Kulturrassistischer Feminismus in der transnationalen Care- Arbeit
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit der transnationalen Care- Arbeit aus rassismuskritischer und feministischer Perspektive. Ziel ist es, die Konstruktion von Rasse und Geschlecht im Kontext dieser Arbeitsform aufzuzeigen und deren Auswirkungen auf die Lebensbedingungen der Care-Arbeitenden zu analysieren.
- Die Rolle von Rassekonstruktionen in der transnationalen Care- Arbeit
- Die Folgen der Prekarisierung von Care- Arbeit für Migrant*innen
- Die Verbindung zwischen transnationaler Care- Arbeit und den herrschenden Geschlechterverhältnissen
- Die Bedeutung der feministischen Perspektive für die Analyse von Care- Arbeit
- Möglichkeiten zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von transnationalen Care-Arbeitenden
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung Die Einleitung stellt die transnationale Care- Arbeit als ein gesellschaftliches Phänomen vor, das in den Kontext von Rassekonstruktionen und Geschlechterverhältnissen eingebettet ist. Es wird die Forschungsfrage formuliert, inwiefern das Konzept der transnationalen Care- Arbeit auf Rassismen gründet oder diese verstärkt.
- Kapitel 2: Die transnationale Care- Arbeit Dieses Kapitel definiert den Begriff der Care- Arbeit und beleuchtet die Besonderheiten der transnationalen Care- Arbeit. Die Arbeitsmigration im Kontext der Care- Arbeit wird anhand von verschiedenen Wanderungsbewegungen und dem Lohnunterschied zwischen Herkunfts- und Zielländern erklärt.
- Kapitel 3: Die rassismuskritische und feministische Perspektive Kapitel 3 erläutert die Bedeutung einer rassismuskritischen Perspektive, die Rassekonstruktionen als Grundlage von Diskriminierung und Ungleichheit analysiert. Zudem wird die Rolle der feministischen Perspektive für die Analyse von Care- Arbeit und die Reproduktion von Geschlechterverhältnissen hervorgehoben.
- Kapitel 4: Transnationale Care- Arbeit aus rassismuskritischer und feministischer Perspektive Dieses Kapitel befasst sich mit den Auswirkungen der transnationalen Care- Arbeit auf die Umverteilung sozialer Güter und die rechtlichen Rahmenbedingungen. Außerdem wird die Bedeutung des „doing gender“ im Kontext der transnationalen Care- Arbeit und der Einfluss des kulturrassistischen Feminismus untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der transnationalen Care- Arbeit, Rassekonstruktionen, Geschlechterverhältnisse, Prekarisierung, Arbeitsmigration, feministische Perspektive und kulturrassistischer Feminismus. Die Arbeit analysiert die Rolle von Rassekonstruktionen in der transnationalen Care- Arbeit und ihre Auswirkungen auf die Lebensbedingungen der Care-Arbeitenden. Besonderes Augenmerk liegt auf der Verbindung zwischen transnationaler Care- Arbeit und den herrschenden Geschlechterverhältnissen. Die Arbeit plädiert für eine rassismuskritische und feministische Analyse von Care- Arbeit, um die Arbeitsbedingungen von transnationalen Care-Arbeitenden zu verbessern.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter transnationaler Care-Arbeit?
Es bezeichnet das Phänomen, dass Menschen (oft aus Osteuropa) ihre Heimat verlassen, um in reicheren Ländern wie Deutschland Pflege- und Sorgearbeiten zu leisten.
Warum wird transnationale Care-Arbeit oft als „Win-Win-Situation“ bezeichnet?
Ökonomisch gesehen verdienen die Arbeiter*innen mehr als in ihrer Heimat, während die Arbeitgeber in Deutschland von günstigen und flexiblen Pflegekräften profitieren.
Welche Kritikpunkte äußert die rassismuskritische Perspektive?
Die Arbeit untersucht, inwiefern das Modell auf Rassekonstruktionen basiert und diese verstärkt, indem migrantische Arbeitskräfte in prekären und unterbezahlten Verhältnissen gehalten werden.
Wie hängen Geschlechterrollen und transnationale Pflege zusammen?
Pflegearbeit ist historisch stark verweiblicht. Das Konzept des „doing gender“ zeigt, wie traditionelle Rollenbilder durch die Beschäftigung von Migrantinnen in der Sorgearbeit reproduziert werden.
Was ist „kulturrassistischer Feminismus“ in diesem Kontext?
Es beschreibt eine Form des Feminismus, die zwar Frauenrechte betont, dabei aber unbewusst rassistische Strukturen nutzt, indem sie die Befreiung einheimischer Frauen auf Kosten migrantischer Frauen ermöglicht.
Wie beeinflussen rechtliche Rahmenbedingungen die Care-Arbeit?
Oft bewegen sich diese Arbeitsverhältnisse in rechtlichen Grauzonen, was die Prekarisierung und Abhängigkeit der Care-Arbeiter*innen weiter verschärft.
- Quote paper
- Hikaru Uhl (Author), 2020, Transnationale Care-Arbeit rassismuskritisch betrachtet, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1192274