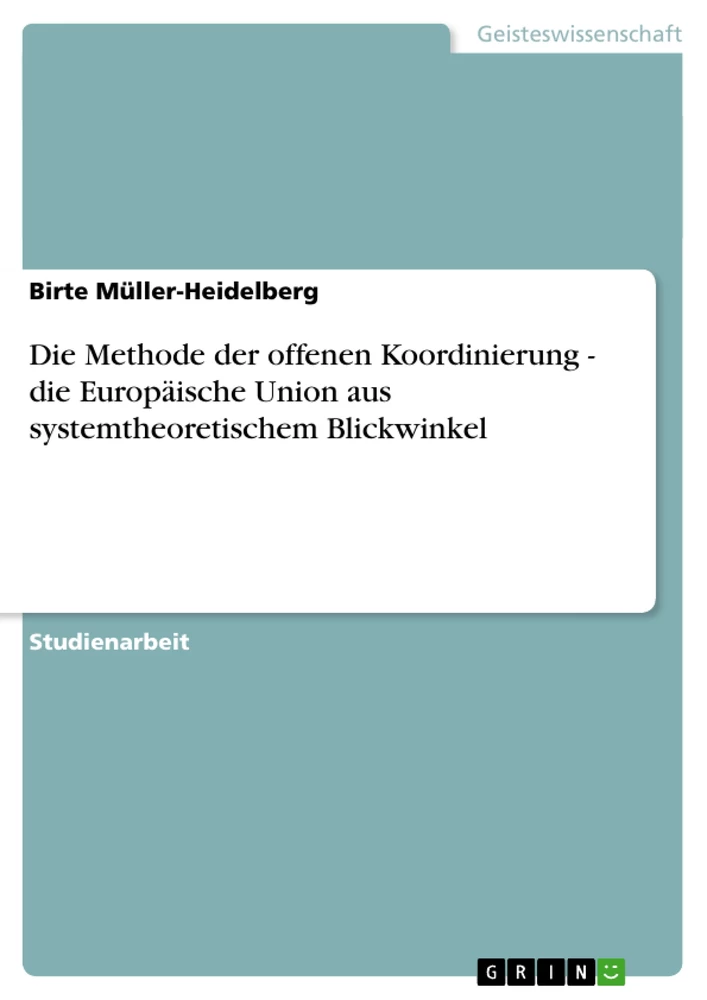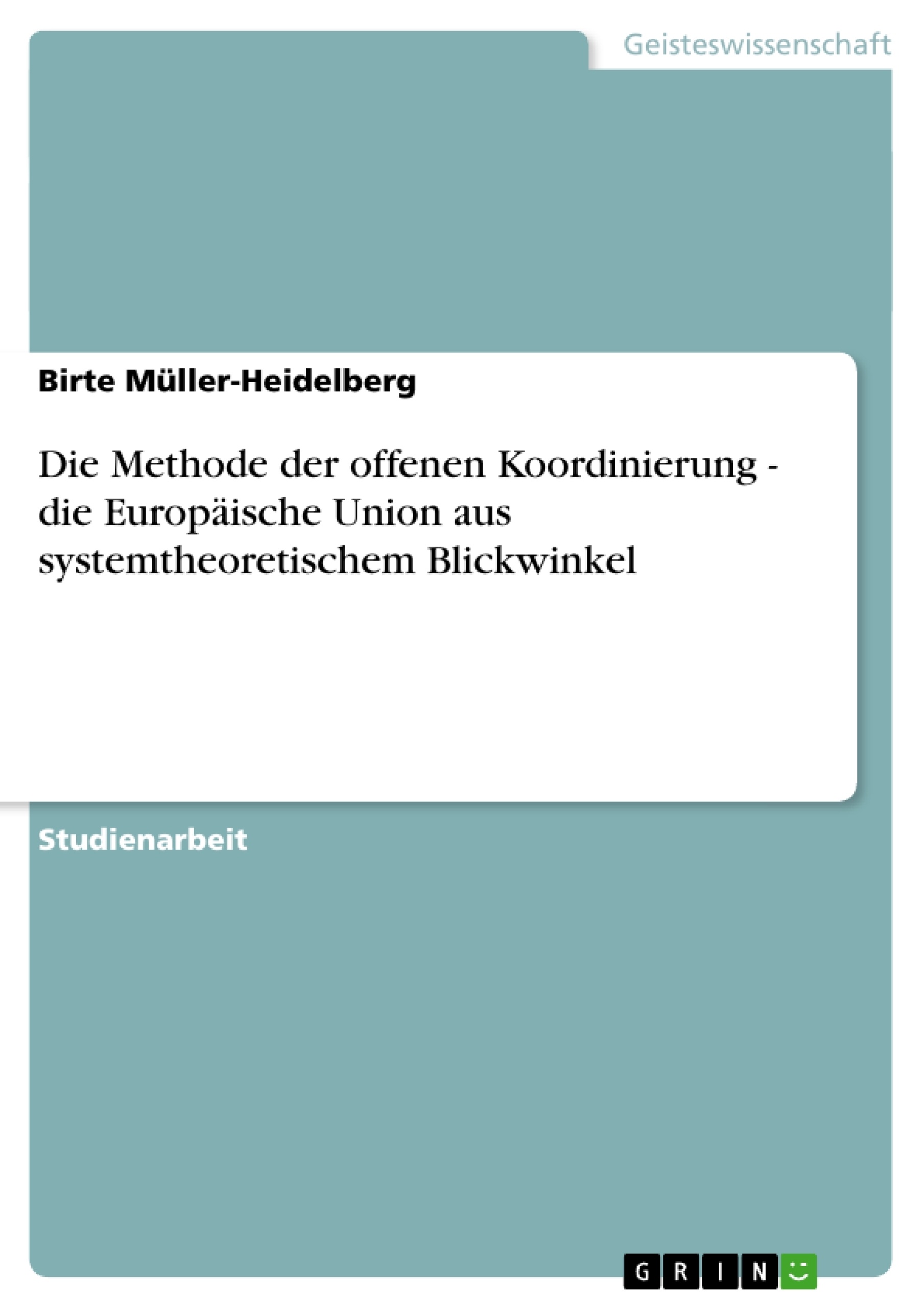Die Europäische Union ist nicht nur ein Staatengebilde, das ganz auf praktischer Ebene zusammenarbeitet. Den in ihr lebenden Menschen, sowie auch jenen, die sie von anderen Kontinenten oder Nachbarländern aus von außen betrachten, mag der Zusammenschluss der 15 Länder wie ein rein logischer und sinnvoller Verbund vorkommen. Das Leben in und um die Europäische Union wird durch ihre Existenz erleichtert und modernisiert. Zusätzlich zu den alltäglichen anwendbaren Fragestellungen des Lebens in der Europäischen Union stellt sie aber auch ein theoretisches Konstrukt dar. Die Europäische Union existiert nicht nur als Staatenbund, sondern auch als ein für die Wissenschaft, genauer gesagt für die Soziologie, interessantes System.
Um ein System als solches zu erkennen und seine Grenzen abzustecken, müssen drei Prämissen betrachtet werden: die Mitgliedsrolle, die kollektive Identität sowie das Vorhandensein von Verhaltensprogrammen.
Die Mitgliedsrolle definiert sich über die Bereitschaft, Hierarchien anzuerkennen und das Erfüllen von Erwartungen. „Dazu gehören“ darf nur, wer eben diesen Anforderungen entspricht. In der Europäischen Union sind diese Voraussetzungen, die sich in vielen Systemen ganz und gar auf mündliche Absprachen oder rein auf Verhaltensweisen gründen, sogar vertraglich festgehalten. Die Hierarchien schlagen sich in Fragen nieder wie der, welche Länder Vetorechte erhalten und welche nicht, oder wer zwei, wer nur ein Mitglied in der Kommission stellen darf. Ebenso klar definiert sind die zu erfüllenden Erwartungen. Mitgliedsländer der Europäischen Union dürfen ein Haushaltsdefizit von drei Prozent nicht überschreiten und sind schon vor ihrer Aufnahme in den erlauchten Kreis verpflichtet, ihre Verfassungen anzupassen. Beispielhaft seien hier das Einhalten von Menschenrechten, sowie die Abschaffung der Todesstrafe genannt.
Die kollektive Identität ist eine ideologische Abbildung der Mitgliedsrolle. Um als vollwertiges Mitglied anerkannt zu werden, muss sich nicht nur an die entsprechenden Regeln gehalten werden; es muss auch klar erkennbar sein, dass das jeweilige Mitglied die Werte und Normen verinnerlicht hat.
Inhaltsverzeichnis
- Die Europäische Union als System
- Probleme bei der Koordinierung von Teilsystemen
- Die Methode der offenen Koordinierung
- Offene Koordinierung - ein Lösungsansatz für die Systemtheorie?
- Vorzüge und Probleme der offenen Koordinierung
- Die Methode der offenen Koordinierung als Lösungsansatz der Systemtheorie Bewertung und Prognose
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Europäische Union aus systemtheoretischer Perspektive, wobei die Methode der offenen Koordinierung im Mittelpunkt steht. Die Arbeit untersucht die Funktionsweise der offenen Koordinierung im Kontext der komplexen Strukturen der Europäischen Union und beleuchtet die Vor- und Nachteile dieses Ansatzes.
- Die Europäische Union als System und ihre Teilsysteme
- Die Herausforderungen der Koordinierung von Teilsystemen in der EU
- Die Methode der offenen Koordinierung als Koordinationsmechanismus
- Bewertung der Wirksamkeit der offenen Koordinierung im Hinblick auf die Systemtheorie
- Die Rolle der offenen Koordinierung in der Gestaltung der europäischen Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Europäische Union als System
Dieses Kapitel definiert die Europäische Union als ein komplexes soziales System mit eigenen Grenzen, Strukturen und Funktionen. Es werden die drei zentralen Elemente eines Systems – Mitgliedsrolle, kollektive Identität und Verhaltensprogramme – im Kontext der EU erläutert.
Probleme bei der Koordinierung von Teilsystemen
Hier werden die Herausforderungen der Koordinierung von Teilsystemen innerhalb der Europäischen Union behandelt. Die Arbeit beleuchtet die Schwierigkeiten, die aus der Autonomie der einzelnen Mitgliedstaaten und der steigenden Anzahl an Teilsystemen entstehen.
Die Methode der offenen Koordinierung
Dieses Kapitel erläutert die Methode der offenen Koordinierung als einen Koordinationsmechanismus, der auf Zusammenarbeit und gegenseitigem Lernen basiert. Es werden die Prinzipien und Anwendungsgebiete der offenen Koordinierung im Kontext der EU beschrieben.
Schlüsselwörter
Die Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt auf der systemtheoretischen Betrachtung der Europäischen Union, der Methode der offenen Koordinierung und der Herausforderungen der Koordinierung von Teilsystemen. Weitere wichtige Schlagwörter sind: Staatenbund, EU-Politik, Systemtheorie, Koordinationsmechanismen, Funktionsfähigkeit, Handlungsfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die systemtheoretische Sicht auf die EU?
Die EU wird als komplexes soziales System betrachtet, das durch Mitgliedsrollen, kollektive Identität und spezifische Verhaltensprogramme definiert ist.
Was ist die Methode der offenen Koordinierung (MOK)?
Die MOK ist ein Steuerungsmechanismus der EU, der auf freiwilliger Zusammenarbeit, Benchmarking und gegenseitigem Lernen statt auf harten Gesetzen basiert.
Welche Probleme treten bei der Koordinierung der EU-Teilsysteme auf?
Herausforderungen entstehen durch die Autonomie der Mitgliedstaaten und die Schwierigkeit, nationale Interessen mit europäischen Zielen zu harmonisieren.
Ist die offene Koordinierung ein effektiver Lösungsansatz?
Die Arbeit bewertet Vorzüge wie Flexibilität und Probleme wie mangelnde Verbindlichkeit aus Sicht der Systemtheorie.
Wie definiert sich die Mitgliedsrolle in der EU?
Sie definiert sich über die Anerkennung von Hierarchien und das Erfüllen vertraglich festgehaltener Erwartungen, wie etwa Haushaltskriterien.
- Quote paper
- Birte Müller-Heidelberg (Author), 2003, Die Methode der offenen Koordinierung - die Europäische Union aus systemtheoretischem Blickwinkel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11926