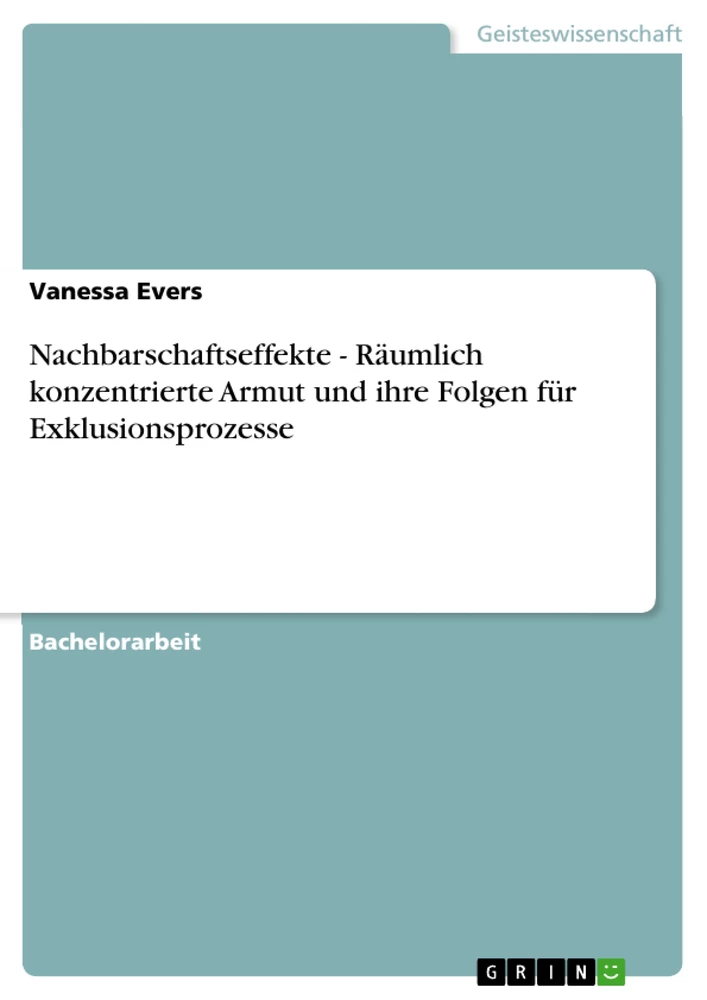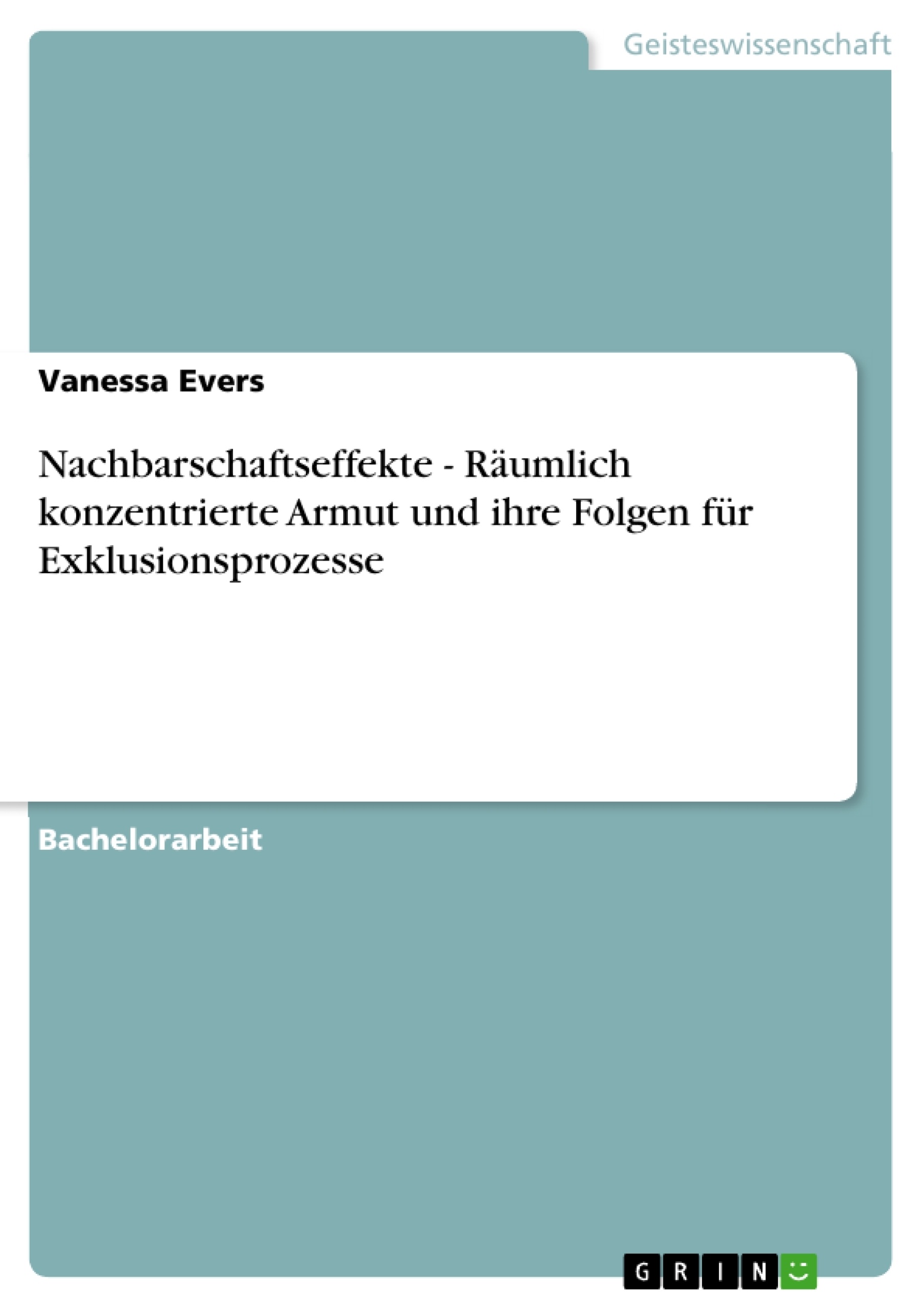Das Thema der sozialräumlichen Segregation und den damit verbundenen Ausgrenzungsprozessen steht seit gut zwei Jahrzehnten wieder im Fokus stadtsoziologischer Untersuchungen. Mit dem Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft und den damit einher gehenden ökonomischen und sozialen Veränderungen haben Armut und Ausgrenzung eine neue Dynamik und Qualität erreicht (vgl. Häußermann 2000: o. S.; Siebert/ Dorsch 2001: 121). Seit Anfang der 1980er Jahre ist in den meisten westlichen Industrienationen eine kontinuierliche Zunahme der von Armut betroffenen Menschen zu verzeichnen: Breite Bevölkerungsschichten sind derzeit von sozialer Exklusion betroffen oder zumindest bedroht . Durch die nachlassende Kraft der drei Integrationsmodi (Arbeitsmarkt, Staat und soziale Netze), bilden sich neue sozialräumliche Strukturen heraus, die Quartiere der Armut und Ausgrenzung entstehen lassen. In diesen Quartieren konzentrieren sich die von Armut, Dauerarbeitslosigkeit und sozialer Diskriminierung betroffenen Bevölkerungsgruppen. Dort bildet sich dann möglicherweise ein Milieu heraus, das aus dem Ort der Benachteiligten einen benachteiligenden Ort macht (Häußermann 2000: o.S.). Es handelt sich also nicht lediglich um die Zunahme von Armut und sozialer Deprivation, sondern um die Herausbildung neuer Ungleichheitsstrukturen, die mit Begriffen wie „Spaltung der Stadt“ oder „Ausgrenzung“ benannt werden. In den Städten gibt es eine wachsende Armutsbevölkerung, was sich an der zunehmenden Zahl von Sozialhilfeempfängern und Langzeitarbeitslosen erkennen lässt (Häußermann 2000: o.S.).
In der stadtsoziologischen und stadtteilpolitischen Diskussion führten diese Entwicklungen zu der weit verbreiteten These, dass die räumliche Konzentration deprivierter Haushalte einen negativen, sich selbst verstärkenden Effekt nach sich zieht (vgl. Häußermann/ Siebel 2004: 160ff): Arme Wohnviertel machen ihre Bewohner ärmer. Der Wohnort als solcher avanciert somit zu einer eigenständigen Komponente der sozialräumlichen Benachteiligung (Häußermann 2003:147); und soziale Ungleichheit wird damit nicht nur verfestigt, sondern zugleich verschärft.
Inhaltsverzeichnis
- Das stadtpolitische Interesse an Nachbarschaftseffekten
- Soziale Segregation: Die homogene Nachbarschaft als Problem?
- Die Entstehung benachteiligender Quartiere: Das Problemviertel
- Die benachteiligende Wirkung benachteiligter Räume
- Sozialräumliche Betrachtungsweisen: Defizit oder Ressource?
- Das Quartier als Ort defizitärer Ausstattung
- Das Quartier als Ressource
- Wissenschaftliche Studien zu Nachbarschaftseffekten
- These der Konzentrationseffekten
- Farwick, Andreas (2001): Segregierte Armut in der Stadt. Ursachen und Folgen der räumlichen Konzentration von Sozialhilfeempfängern
- Oberwittler, Dietrich (2004): Stadtstruktur, Freundeskreise und Delinquenz: Eine Mehrebenenanalyse zu sozialökologischen Kontexteffekten auf schwere Jugenddelinquenz
- Friedrichs, Jürgen/ Blasius, Jörg (2000): Leben in benachteiligten Wohngebieten
- These der Quartierstypeneffekten
- Keim, Rainer/ Neef, Rolf (2007): Wir sind keine Sozialen
- Vogel/Kronauer (2001): Was sind Quartierseffekte, was Lageeffekte?
- These der Konzentrationseffekten
- Zusammenfassung der Studienergebnisse für eine sozial integrative Stadtentwicklung
- Die Perspektive impliziert den Effekt
- Der Effekt impliziert die stadtteilpolitische Interventionsmaßnahme?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Auswirkungen räumlich konzentrierter Armut auf Exklusionsprozesse. Ziel ist es, die bestehenden wissenschaftlichen Studien zu Nachbarschaftseffekten zu analysieren und deren Relevanz für eine sozial integrative Stadtentwicklung zu bewerten.
- Soziale Segregation und ihre Mechanismen
- Entstehung und Charakteristika benachteiligter Quartiere
- Auswirkungen räumlicher Armutskonzentration auf Exklusionsprozesse
- Bewertung unterschiedlicher sozialwissenschaftlicher Betrachtungsweisen von Sozialräumen
- Relevanz der Studienergebnisse für stadtteilpolitische Interventionen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet das stadtpolitische Interesse an Nachbarschaftseffekten im Kontext sozialräumlicher Segregation und des Strukturwandels. Kapitel 2 erörtert Mechanismen sozialer Segregation und die Problematik der Bewertung homogener Quartiere. Kapitel 3 skizziert die Entstehung benachteiligter Quartiere. Kapitel 4 behandelt die benachteiligenden Wirkungen solcher Räume. Kapitel 5 analysiert verschiedene sozialwissenschaftliche Betrachtungsweisen von Sozialräumen. Kapitel 6 referiert und differenziert wissenschaftliche Studien zu Nachbarschaftseffekten.
Schlüsselwörter
Soziale Segregation, räumliche Armutskonzentration, Exklusionsprozesse, Nachbarschaftseffekte, Konzentrationseffekte, Quartierstypeneffekte, sozial integrative Stadtentwicklung, Stadtteilpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Nachbarschaftseffekte?
Nachbarschaftseffekte beschreiben die Theorie, dass der Wohnort selbst einen eigenständigen Einfluss auf die Lebenschancen der Bewohner hat – arme Viertel können ihre Bewohner demnach „ärmer machen“.
Was versteht man unter sozialräumlicher Segregation?
Dies bezeichnet die räumliche Trennung verschiedener sozialer Gruppen innerhalb einer Stadt, was oft zur Bildung von Problemvierteln führt.
Führt räumliche Armutskonzentration zwangsläufig zu Exklusion?
Wissenschaftliche Studien untersuchen, ob die Konzentration von Armut negative, sich selbst verstärkende Effekte auf die soziale Teilhabe (Exklusion) hat.
Kann ein Quartier auch eine Ressource sein?
Ja, die Arbeit beleuchtet auch Sichtweisen, in denen das Quartier trotz Benachteiligung als soziales Netzwerk und Unterstützungsressource für seine Bewohner fungiert.
Welche Rolle spielt die Stadtteilpolitik bei Nachbarschaftseffekten?
Die Politik nutzt Studienergebnisse, um gezielte Interventionsmaßnahmen für eine sozial integrative Stadtentwicklung zu entwerfen und der „Spaltung der Stadt“ entgegenzuwirken.
- Quote paper
- Vanessa Evers (Author), 2008, Nachbarschaftseffekte - Räumlich konzentrierte Armut und ihre Folgen für Exklusionsprozesse , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119298