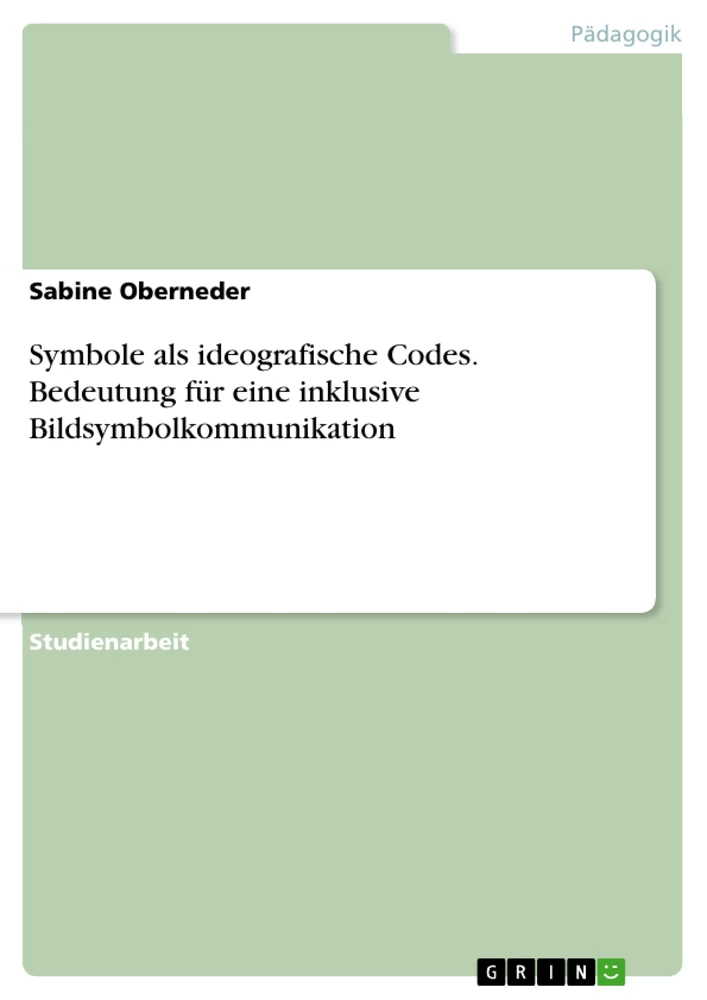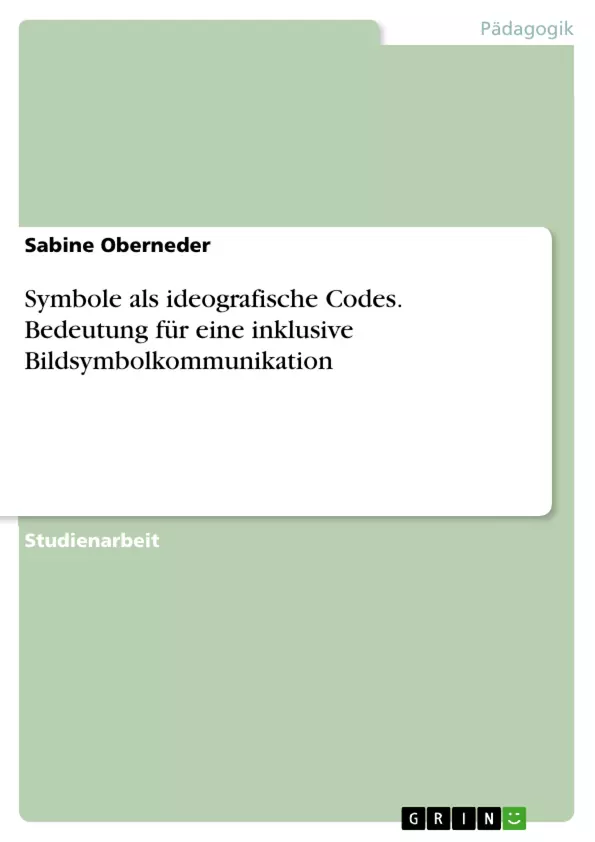Seit dem Schuljahr 2018/19 ist das Kollegium meiner Schule verpflichtet, in Inklusions- und Schwerstbehindertenklassen Metacomsymbole auf IPads und in "Ich-Büchern" einzusetzen. Auch das Schulgebäude ist mit diesen Bildsymbolen bespickt, die Handlungsanweisungen oder Hinweise auf Personen, Räumlichkeiten und dergleichen geben. Die technologische Ausstattung hinsichtlich Kommunikationsanbahnung mit deprivilegierten Kindern wurde großartig aufgestockt. Im Anhang findet sich eine Aufzählung für Interessierte. Anhand der an die LehrerInnen-schaft herangetragenen Dringlichkeit des Einsatzes dieser Technologien ergibt sich folgende These: Eine Symbolsprache als Kommunikationsunterstützung kann Inklusion deprivilegierter Kinder vorantreiben.
Gleich vorweg gehört das Verstörende, das diese These in sich trägt zum Ausdruck gebracht, wenn mit Kantner/ Schaufler darauf verwiesen wird, dass ideographische Codes, was einer Symbolsprache entspricht, nicht wie das Alphabet, das, den Sprachcode abbildend, vermittelnd zwischen Denken und Schreiben agiert (und dadurch emotional geladen ist, Anm. S.O.), arbeiten, sondern als getrennt von der gesprochenen Sprache zu betrachten sind, die rein den Inhalt einer Aussage abbilden. Dennoch: Eine Betrachtung der ideografischen Codes und ihre konstruktiven Nuancen hinsichtlich Inklusion lohnt sich, denn nach Kantner/ Schaufler sind Codes als Symbolisierungsebene für zwischenmenschliche Kommunikation unabdingbar.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Hauptteil
- 2.1 Zur Etymologie des Begriffs Symbol
- 2.2 Zur Genealogie des Begriffs Symbol
- 2.3 Der Symbolbegriff bei Cassirer in Bezug auf seine Bedeutung für inklusive Bildsymbolkommunikation
- 2.4 Grenzen und Kritik am Einsatz von Symbolen als inklusives Kommunikationsmittel unter Bedachtnahme der ästhetischen und seelischen Relevanz mit besonderer Berücksichtigung der Sichtweisen von Cassirer (1923), Damasio (2007) und Mahr (2003)
- 2.4.1 Die Körper-Geist-Dimension des Menschlichen bei Damasio
- 2.4.2 Die ästhetische Dimension des Menschlichen nach Mahr
- 3 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Einsatz von Symbolen als ideografische Codes zur Verbesserung der Kommunikation und Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigungen. Die Arbeit analysiert die theoretischen Grundlagen des Symbolbegriffs und hinterfragt die Grenzen und Möglichkeiten ihrer Anwendung im Kontext inklusiver Bildung.
- Der Symbolbegriff und seine etymologische und genealogische Entwicklung
- Cassirers Symbolbegriff und seine Relevanz für inklusive Bildsymbolkommunikation
- Grenzen und Kritikpunkte beim Einsatz von Symbolen in der inklusiven Kommunikation
- Die Rolle von Körper, Geist und Ästhetik im Kontext der Symbolverwendung
- Potenzial und Herausforderungen von Symbolen für die inklusive Teilhabe
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die These auf, dass eine Symbolsprache die Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigungen fördern kann. Sie führt in die Problematik ein, indem sie den Einsatz von Metacomsymbolen an der Schule der Autorin beschreibt und den scheinbaren Widerspruch zwischen der emotionalen Neutralität ideographischer Codes und ihrem inklusiven Potenzial aufzeigt. Die Notwendigkeit einer präzisen Begriffsbestimmung von Inklusion und Kommunikation wird hervorgehoben, wobei Bezug auf relevante Theorien und Studien genommen wird. Die Autorin beleuchtet das trilemmatische Verhältnis von Empowerment, Normalisierung und Dekonstruktion innerhalb der Inklusionstheorie und betont die Bedeutung von Dekonstruktion und Empowerment für ein authentisches Zur-Sprache-Kommen von Andersheit.
2 Hauptteil: Dieser Kapitelteil erörtert den Symbolbegriff umfassend. Er beginnt mit der Etymologie und Genealogie des Begriffs „Symbol“, bevor er Cassirers Symbolbegriff im Hinblick auf seine Bedeutung für inklusive Bildsymbolkommunikation analysiert. Im Anschluss werden kritische Aspekte und Grenzen des Symbolgebrauchs in der inklusiven Kommunikation beleuchtet. Dabei werden die Perspektiven von Damasio (Körper-Geist-Dimension) und Mahr (ästhetische Dimension) einbezogen, um ein ganzheitliches Verständnis des menschlichen Erlebens im Kontext von Symbolen zu ermöglichen. Die Herausforderungen und Chancen werden im Hinblick auf die inklusive Praxis diskutiert.
Schlüsselwörter
Inklusion, Bildsymbolkommunikation, ideografische Codes, Metacomsymbole, Symbolbegriff (Cassirer), Kommunikation, Körper-Geist-Problematik, Ästhetik, Empowerment, Dekonstruktion, Normalisierung, Deprivilegierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Symbolischer Inklusionsansatz
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Einsatz von Symbolen als ideografische Codes zur Verbesserung der Kommunikation und Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigungen. Sie analysiert die theoretischen Grundlagen des Symbolbegriffs und hinterfragt die Grenzen und Möglichkeiten seiner Anwendung im Kontext inklusiver Bildung.
Welche Aspekte des Symbolbegriffs werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die etymologische und genealogische Entwicklung des Symbolbegriffs, analysiert Cassirers Symbolbegriff in Bezug auf inklusive Bildsymbolkommunikation und untersucht kritische Aspekte und Grenzen des Symbolgebrauchs in der inklusiven Kommunikation. Dabei werden die Perspektiven von Damasio (Körper-Geist-Dimension) und Mahr (ästhetische Dimension) berücksichtigt.
Welche konkreten Beispiele werden genannt?
Die Autorin beschreibt den Einsatz von Metacomsymbolen an ihrer Schule als Ausgangspunkt ihrer Überlegungen. Die Arbeit vergleicht die scheinbar emotionale Neutralität ideographischer Codes mit ihrem inklusiven Potenzial.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Theorien und Studien zur Inklusion und Kommunikation. Sie beleuchtet das trilemmatische Verhältnis von Empowerment, Normalisierung und Dekonstruktion innerhalb der Inklusionstheorie und betont die Bedeutung von Dekonstruktion und Empowerment für ein authentisches Zur-Sprache-Kommen von Andersheit. Die Perspektiven von Cassirer, Damasio und Mahr werden eingebunden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil mit Unterkapiteln zur Etymologie, Genealogie des Symbolbegriffs, Cassirers Symbolbegriff und dessen Kritik, sowie einem Fazit. Der Hauptteil analysiert die Körper-Geist-Dimension nach Damasio und die ästhetische Dimension nach Mahr im Kontext des Symbolgebrauchs.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Inklusion, Bildsymbolkommunikation, ideografische Codes, Metacomsymbole, Symbolbegriff (Cassirer), Kommunikation, Körper-Geist-Problematik, Ästhetik, Empowerment, Dekonstruktion, Normalisierung, Deprivilegierung.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Potential und die Herausforderungen von Symbolen für die inklusive Teilhabe. Die genaue Schlussfolgerung des Fazits wird in der Zusammenfassung der Kapitel nicht explizit genannt, ist aber im Kontext der vorherigen Kapitel zu finden.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehrende, Erzieher, Therapeuten und alle, die sich mit inklusiver Bildung und Kommunikation beschäftigen. Sie bietet einen theoretischen Rahmen für den Einsatz von Symbolen in der inklusiven Praxis und weist auf wichtige kritische Aspekte hin.
Wo finde ich den vollständigen Text der Seminararbeit?
Die bereitgestellte HTML-Datei enthält eine Vorschau mit Inhaltsverzeichnis, Zielen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörtern. Der vollständige Text der Seminararbeit ist nicht hier enthalten.
- Quote paper
- Sabine Oberneder (Author), 2019, Symbole als ideografische Codes. Bedeutung für eine inklusive Bildsymbolkommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1193128