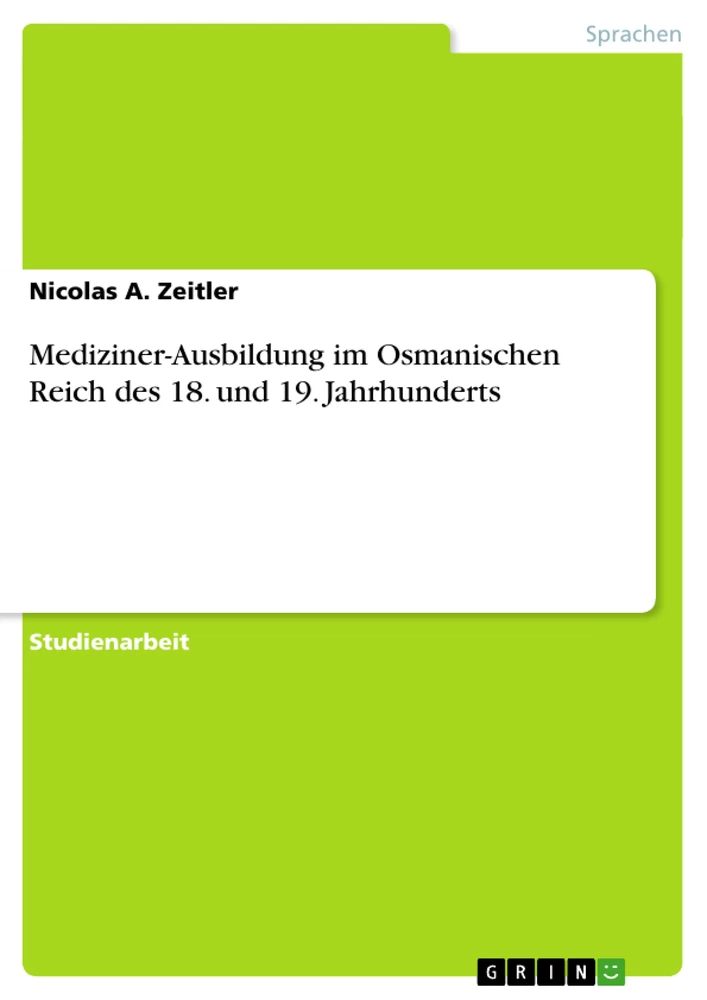Im 18. und 19. Jahrhundert war die Medizin und damit auch die Ausbildung von Ärzten
im Osmanischen Reich tiefgreifenden Veränderungen unterworfen. In diesem Zeitraum
spielte sich ein Übergang ab von der klassischen medizinischen Lehre der Osmanen, die
sich auf Autoritäten vergangener Jahrhunderte bis hin zur Spätantike berief, zu einer
Heilkunde, die von westlich-europäischen Einflüssen, etwa aus Österreich, Deutschland
und Frankreich geprägt war.
Diese Veränderungen stellt die Arbeit exemplarisch am Beispiel Istanbuls
dar. Vorgestellt wird zu diesem Zweck zunächst die medizinische Medrese der
Süleymaniye, die bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts eine bedeutende
Ausbildungsstätte für osmanische Ärzte war. Alsdann werden die Einflüsse aus Europa
und die vom Osmanischen Staat angestrengten Reformen beschrieben, die nachhaltig
auf die Mediziner-Ausbildung und die Ausübung der Heilkunde einwirkten. Am
Beispiel der modernen militärmedizinischen Fakultät und des Hamidianischen
Kinderkrankenhauses in Istanbul wird die Umsetzung der Reformen verdeutlicht.
Besonderes Augenmerk gilt dabei auch der Frage, inwieweit die im 18. und 19.
Jahrhundert nachdrücklich vorangetriebene Neuausrichtung in der Medizin
ausschließlich fachlichen Entwicklungen Rechnung trug und welche Rolle bei ihrer
Umsetzung auch rein politische Erwägungen spielten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- "Alte" Autoritäten der medizinischen Lehre
- Der Einfluss medizinischer Lehrer aus früheren Jahrhunderten
- Djālīnūs/ Galen
- Al-Rāzī/ Rhazes
- Ibn Sīnā/Avicenna
- Ibn al-Nafīs
- Osmanische Mediziner-Ausbildung an der Süleymaniye
- Die Einrichtung der medizinischen Medrese
- Der Lehrbetrieb an der Süleymaniye
- Die Frage nach der Sektion von Leichen
- Reformen in der medizinischen Ausbildung
- Wissenstransfer zwischen Ost und West
- Die Entstehung der modernen militärmedizinischen Fakultät
- Ein weiteres Beispiel für die Verwestlichung: Die Hamidianische Kinderklinik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Veränderungen in der medizinischen Ausbildung im Osmanischen Reich während des 18. und 19. Jahrhunderts. Sie analysiert den Übergang von der traditionellen, auf antiken Autoritäten basierenden Lehre hin zu einer von westeuropäischen Einflüssen geprägten Heilkunde, exemplarisch am Beispiel Istanbuls.
- Der Einfluss antiker und islamischer medizinischer Autoritäten auf die osmanische Medizin.
- Die Organisation und der Lehrbetrieb an der medizinischen Medrese der Süleymaniye.
- Der Wissenstransfer zwischen Ost und West und die daraus resultierenden Reformen.
- Die Rolle politischer Erwägungen bei der Umsetzung der medizinischen Reformen.
- Die Entwicklung moderner medizinischer Einrichtungen in Istanbul.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt den Wandel der medizinischen Ausbildung im Osmanischen Reich vom 18. bis zum 19. Jahrhundert, gekennzeichnet durch den Übergang von klassischer Lehre zu westlichen Einflüssen. Kapitel II präsentiert bedeutende medizinische Autoritäten der Vergangenheit (Galen, Rhazes, Avicenna, Ibn al-Nafis), deren Lehren die osmanische Medizin lange prägten. Kapitel III fokussiert auf die medizinische Medrese der Süleymaniye als wichtige Ausbildungsstätte und Kapitel IV beschreibt Reformen in der medizinischen Ausbildung, den Wissenstransfer zwischen Ost und West sowie die Entstehung moderner medizinischer Fakultäten, unter anderem anhand der Hamidianischen Kinderklinik.
Schlüsselwörter
Mediziner-Ausbildung, Osmanisches Reich, Istanbul, Süleymaniye, Galen, Rhazes, Avicenna, Ibn al-Nafīs, Reformen, Wissenstransfer, Westliche Einflüsse, Militärmedizin, Hamidianische Kinderklinik, Traditionelle Medizin, Moderne Medizin, Politische Erwägungen.
- Arbeit zitieren
- Nicolas A. Zeitler (Autor:in), 2005, Mediziner-Ausbildung im Osmanischen Reich des 18. und 19. Jahrhunderts, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119327