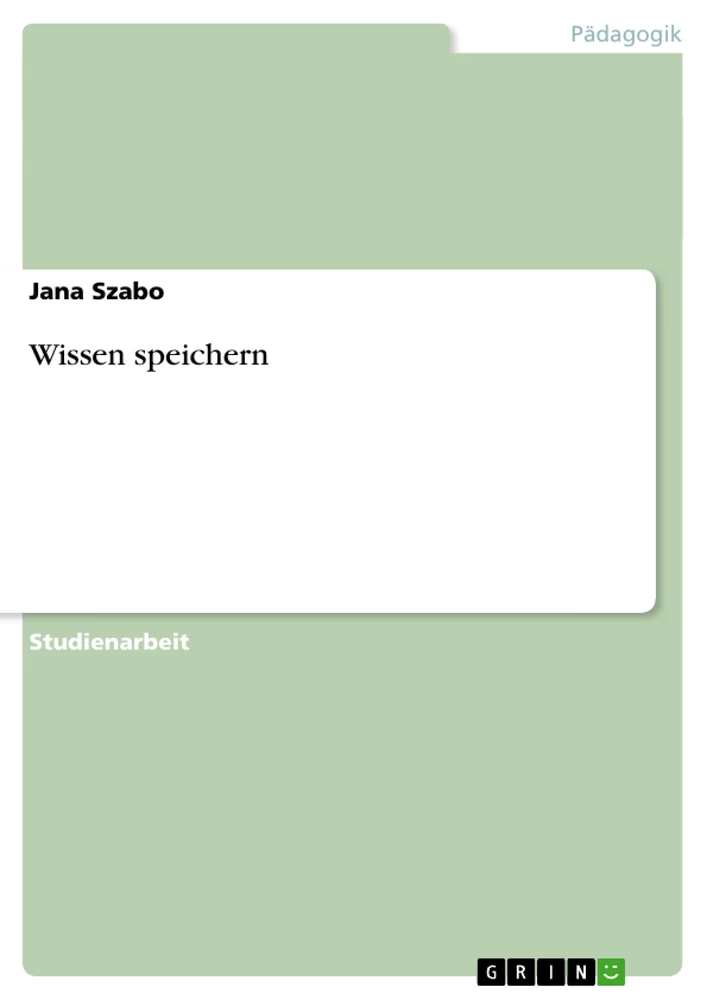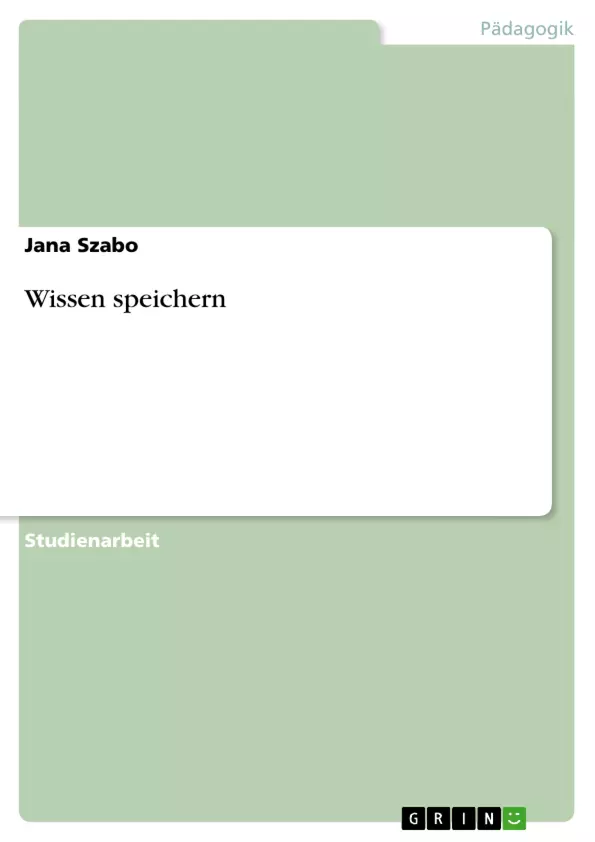Lange Zeit ging man in der Psychologie davon aus, dass es für das was wir in unserer Alltagssprache Gedanken, Gefühle, Absichten, Erinnerungen und so weiter nennen, Entsprechungen im Gehirn gibt. Mit Hilfe von Computerprogrammen erhoffte man sich, die Natur dieser Gefühle, Gedanken, Absichten und Erinnerungen aufklären zu können. Doch schon bald stellte man fest, dass ein Gehirn kein Computer ist. Computer muss man programmieren, damit sie Programme ordnungsgemäß und ohne Fehler ausführen. Auch läuft Speicherung und Verarbeitung in einem Computer anders ab, als im menschlichen Gehirn. Während beide Vorgänge im Computer seriell, also Schritt für Schritt und somit streng getrennt ablaufen, findet im Gehirn vielmehr eine Zusammenarbeit zwischen beiden Vorgängen statt. (vgl. Spitzer 2000, S 209)
Wie wird nun das Wissen, welches wir uns im Laufe unserer Lebensjahre aneignen, im Gehirn gespeichert?
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Statische Regeln vs. Dynamische Prozesse
- Piaget und Entwicklungsphasen
- Gedächtnis
- Leben ohne Hippocampus
- Gedächtnis im Netz
- Einzelereignisse vs. Allgemeinheit
- Katastrophale Interferenz
- Wettlauf gegen den Verfall
- Der Hippocampus als Trainer des Cortex
- Ein Netzwerkmodell der Alzheimerischen Erkrankung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Speicherung von Wissen im Gehirn. Sie hinterfragt ältere, statische Modelle der Informationsverarbeitung und setzt diese in Relation zu dynamischen Prozessmodellen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Rolle des Hippocampus und der Interaktion zwischen Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklungspsychologischen Aspekte des Lernens im Kontext von Netzwerkmodellen und berücksichtigt die Auswirkungen von Gedächtnisprozessen auf Erkrankungen wie Alzheimer.
- Statische vs. dynamische Modelle der Gedächtnisverarbeitung
- Die Rolle des Hippocampus bei der Gedächtniskonsolidierung
- Entwicklungspsychologische Aspekte des Lernens nach Piaget und deren Modellierung
- Netzwerkmodelle der Informationsverarbeitung im Gehirn
- Zusammenhang zwischen Gedächtnisprozessen und neurodegenerativen Erkrankungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung führt in die Thematik der Wissensspeicherung im Gehirn ein und stellt die Frage nach der Funktionsweise des menschlichen Gedächtnisses im Vergleich zu Computerprogrammen. Sie betont den Unterschied zwischen serieller Verarbeitung bei Computern und der parallelen Zusammenarbeit von Speicherung und Verarbeitung im Gehirn.
2. Statische Regeln vs. Dynamische Prozesse: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des Verständnisses von Gedächtnisprozessen. Es vergleicht frühere, statische Modelle, die von regelhaften Verknüpfungen von Gedächtnisinhalten ausgingen, mit neueren, dynamischen Prozessmodellen. Die Arbeit betont, dass die Informationsverarbeitung im Gehirn ein dynamischer Prozess ist, der nur schwer durch statische Regeln beschrieben werden kann und veranschaulicht dies am Beispiel der Sprachverarbeitung.
3. Piaget und Entwicklungsphasen: Dieses Kapitel verbindet die Netzwerkmodelle der Informationsverarbeitung mit der Entwicklungspsychologie nach Piaget. Es beschreibt Piagets vier Phasen der kognitiven Entwicklung (sensomotorisch, präoperational, konkret-operational, formal-operational) und erläutert, wie diese Phasen durch Assimilation und Akkommodation charakterisiert sind. Die Anwendung dieser Konzepte auf Netzwerkmodelle und ein Beispiel zum Verständnis des Drehmoments bei Kindern veranschaulichen die Interaktion von Theorie und Modell.
4. Gedächtnis: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Gedächtnisses und unterteilt ihn in Merkfähigkeit, Reproduktionsfähigkeit und das Gedächtnis im engeren Sinne. Es hebt die Bedeutung des Zusammenspiels von zwei eng benachbarten Regionen im Schläfenlappen für die Speicherung von Informationen hervor.
5. Wettlauf gegen den Verfall: Dieses Kapitel beschreibt den Wettlauf zwischen dem Verfall von Gedächtnisinhalten und den Mechanismen, die dazu beitragen, dass Erinnerungen erhalten bleiben. Der Fokus liegt auf dem Hippocampus und seiner Funktion bei der Konsolidierung von Erinnerungen.
6. Ein Netzwerkmodell der Alzheimerischen Erkrankung: Dieses Kapitel präsentiert ein Netzwerkmodell zur Erklärung der Alzheimer Erkrankung. Es ist zu vermuten, dass hier die Zusammenhänge zwischen den beschriebenen Gedächtnisprozessen und den Auswirkungen neurodegenerativer Erkrankungen näher beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Wissensspeicherung, Gedächtnis, Hippocampus, Netzwerkmodelle, dynamische Prozesse, Entwicklungspsychologie, Piaget, Assimilation, Akkommodation, Alzheimer Krankheit, Informationsverarbeitung.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Wissensspeicherung im Gehirn
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Speicherung von Wissen im Gehirn. Sie vergleicht ältere, statische Modelle der Informationsverarbeitung mit neueren, dynamischen Prozessmodellen und konzentriert sich dabei auf die Rolle des Hippocampus und die Interaktion zwischen Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis. Die Arbeit beleuchtet auch entwicklungspsychologische Aspekte des Lernens und die Auswirkungen von Gedächtnisprozessen auf Erkrankungen wie Alzheimer.
Welche Modelle der Gedächtnisverarbeitung werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht statische Modelle, die von regelhaften Verknüpfungen von Gedächtnisinhalten ausgehen, mit dynamischen Prozessmodellen, die die Informationsverarbeitung im Gehirn als dynamischen Prozess beschreiben, der nur schwer durch statische Regeln erfasst werden kann. Dies wird am Beispiel der Sprachverarbeitung veranschaulicht.
Welche Rolle spielt der Hippocampus?
Der Hippocampus spielt eine zentrale Rolle bei der Gedächtniskonsolidierung, also dem Übergang von Kurzzeit- in Langzeitgedächtnis. Die Hausarbeit untersucht seine Funktion im Kontext des Wettlaufs zwischen dem Verfall von Gedächtnisinhalten und den Mechanismen zur Erhaltung von Erinnerungen.
Wie werden entwicklungspsychologische Aspekte berücksichtigt?
Die Arbeit integriert Piagets vier Phasen der kognitiven Entwicklung (sensomotorisch, präoperational, konkret-operational, formal-operational) und deren Charakterisierung durch Assimilation und Akkommodation in die Netzwerkmodelle der Informationsverarbeitung. Ein Beispiel zum Verständnis des Drehmoments bei Kindern veranschaulicht die Interaktion von Theorie und Modell.
Welche Netzwerkmodelle werden verwendet?
Die Hausarbeit verwendet Netzwerkmodelle, um die Informationsverarbeitung im Gehirn zu beschreiben und um die Alzheimer Erkrankung zu erklären. Diese Modelle stellen die parallele und verteilte Verarbeitung von Informationen im Gehirn dar.
Wie wird die Alzheimer-Erkrankung behandelt?
Die Hausarbeit präsentiert ein Netzwerkmodell zur Erklärung der Alzheimer-Erkrankung. Es wird vermutet, dass hier die Zusammenhänge zwischen den beschriebenen Gedächtnisprozessen und den Auswirkungen neurodegenerativer Erkrankungen näher beleuchtet werden.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit umfasst folgende Kapitel: Einführung, Statische Regeln vs. Dynamische Prozesse, Piaget und Entwicklungsphasen, Gedächtnis, Wettlauf gegen den Verfall und Ein Netzwerkmodell der Alzheimerischen Erkrankung. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Wissensspeicherung, Gedächtnis, Hippocampus, Netzwerkmodelle, dynamische Prozesse, Entwicklungspsychologie, Piaget, Assimilation, Akkommodation, Alzheimer Krankheit, Informationsverarbeitung.
Was sind die Zielsetzung und Themenschwerpunkte?
Ziel der Hausarbeit ist es, die Speicherung von Wissen im Gehirn zu untersuchen, statische und dynamische Modelle zu vergleichen, die Rolle des Hippocampus zu beleuchten, entwicklungspsychologische Aspekte zu berücksichtigen und den Zusammenhang zwischen Gedächtnisprozessen und neurodegenerativen Erkrankungen aufzuzeigen.
- Citar trabajo
- Jana Szabo (Autor), 2003, Wissen speichern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11938