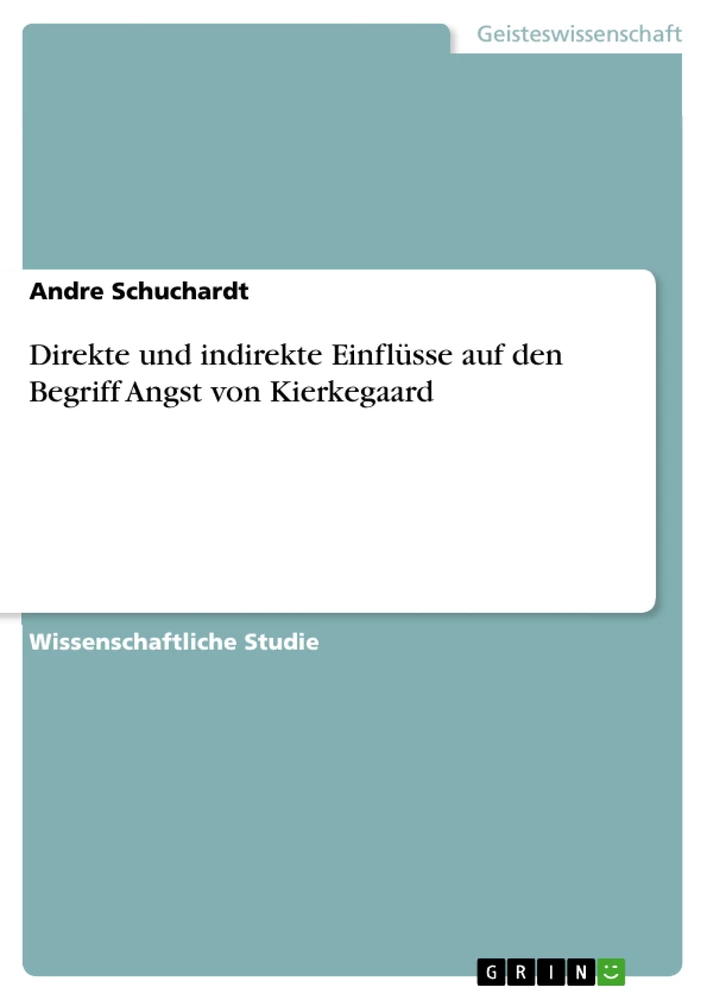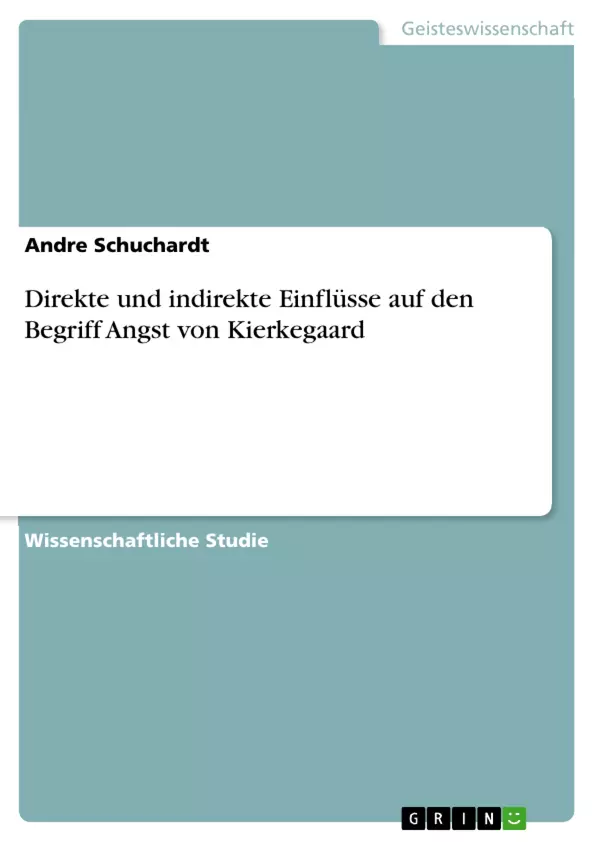1844 wurde in Kopenhagen ein Buch mit dem Titel „Der Begriff Angst“ publiziert. Sein Autor nennt sich Vigilius Haufniensis, oder übersetzt: Beobachter Kopenhagens. Hinter diesem Namen verbarg sich niemand anders als Søren Kierkegaard. Nach „Entweder-Oder“, „Die Wiederholung“ und „Furcht und Zittern“ sein viertes großes Werk.
„Es gibt wohl kaum einen Philosophen, bei dem das Denken so eng mit dem Leben verknüpft ist wie bei S[ø]ren Kierkegaard.“ Dies liest man so oder so ähnlich immer wieder in Kierkegaard-Biographien. Was brachte ihn dazu, den Begriff Angst zu verfassen? Welche Einflüsse in seinem Leben prägten ihn, bewegten ihn dazu? Und wen greift er in seinem Werk an, wessen Ansichten übernimmt er? Diese direkten und indirekten Einflüsse aufzuzeigen ist Ziel dieser Arbeit. Es werden nur die philosophischen und persönlichen Einflüsse betrachtet, theologisches wird außen vor gelassen.
„Der Begriff Angst“ wird im folgenden entweder Begriff Angst, der Begriff oder die Angst genannt. Zitate aus dem Begriff stehen direkt im Text hinter dem Zitat, andere Zitate sind gesondert angegeben. Zitiert wird aus der Reclam-Ausgabe von 1992, übersetzt von Gisela Perlet. Es folgen zuerst die indirekten Einflüsse, wie Familie, Freunde und Lehrer, danach die direkten im Text erwähnten in der Reihenfolge Kritisierung, Übernommene Ansichten und lediglich als Beispiel verwendete.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Festlegungen
- Søren Aabye Kierkegaard
- Nicht direkt erwähnte aber vorhandene Einflüsse
- Michael Pedersen Kierkegaard (1756 - 1838)
- Anne Sørensdatter Lund Kierkegaard
- Regine Olsen (1822-1904)
- Lehrer und Dozenten
- Freunde und Bekannte
- Direkte Erwähnungen im Text
- Kritiken und Angriffe
- Unterstützung, Übernahme, Bewunderung
- Als anschauliche Beispiele verwendete
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die direkten und indirekten Einflüsse auf Søren Kierkegaards Werk „Der Begriff Angst“. Der Fokus liegt auf philosophischen und persönlichen Einflüssen, theologische Aspekte werden ausgeklammert. Ziel ist es, die prägenden Faktoren zu identifizieren, die Kierkegaard zum Verfassen dieses Werkes motivierten, sowie seine Auseinandersetzung mit anderen Denkern zu beleuchten.
- Kierkegaards biografischer Hintergrund und seine persönlichen Beziehungen
- Der Einfluss von Lehrern und Dozenten auf Kierkegaards Denken
- Kierkegaards Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Philosophen (Kritik und Zustimmung)
- Die Rolle von Familie und Freunden in der Entwicklung seiner Gedanken
- Der Entstehungskontext von "Der Begriff Angst"
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung legt die Zielsetzung der Arbeit und die methodischen Vorgehensweisen fest. Kapitel 2 bietet eine kurze biographische Skizze Kierkegaards. Kapitel 3 beleuchtet indirekte Einflüsse, beginnend mit der Beschreibung der Persönlichkeit seines Vaters, Michael Pedersen Kierkegaard, und seiner Mutter, Anne Sørensdatter Lund Kierkegaard. Die Beziehung zu Regine Olsen wird ebenfalls detailliert dargestellt, ebenso wie der Einfluss von Lehrern und Freunden. Kapitel 4 behandelt die direkten Einflüsse, indem es auf Kritiker, Philosophen, deren Ansichten Kierkegaard übernahm, und Denker, die er lediglich als Beispiele verwendete, eingeht.
Schlüsselwörter
Søren Kierkegaard, Der Begriff Angst, Philosophie, Biographie, Einflussfaktoren, Hegel, Schelling, Indirekte Einflüsse, Direkte Einflüsse, Familie, Freunde, Lehrer, Kritik, Übernahme, Existentialismus.
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde Kierkegaards Werk „Der Begriff Angst“ veröffentlicht?
Das Werk wurde im Jahr 1844 in Kopenhagen unter dem Pseudonym Vigilius Haufniensis veröffentlicht.
Welche indirekten Einflüsse prägten Kierkegaards Denken?
Zu den indirekten Einflüssen zählen seine Eltern (Michael Pedersen und Anne Sørensdatter Lund Kierkegaard), seine Verlobte Regine Olsen sowie seine Lehrer, Dozenten und Freunde.
Welche Philosophen werden im Text direkt erwähnt?
Kierkegaard setzt sich im Werk kritisch mit Denkern wie Hegel und Schelling auseinander, übernimmt aber auch Ansichten anderer Philosophen.
Werden theologische Aspekte in dieser Arbeit untersucht?
Nein, die vorliegende Arbeit beschränkt sich explizit auf die philosophischen und persönlichen Einflüsse; Theologisches wird ausgeklammert.
Was bedeutet das Pseudonym „Vigilius Haufniensis“?
Übersetzt bedeutet der Name „Beobachter Kopenhagens“.
Warum ist Kierkegaards Biografie für sein Werk so wichtig?
Es gibt kaum einen Philosophen, bei dem das Denken so eng mit den persönlichen Lebensumständen verknüpft ist wie bei Søren Kierkegaard.
- Arbeit zitieren
- Andre Schuchardt (Autor:in), 2007, Direkte und indirekte Einflüsse auf den Begriff Angst von Kierkegaard, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119399