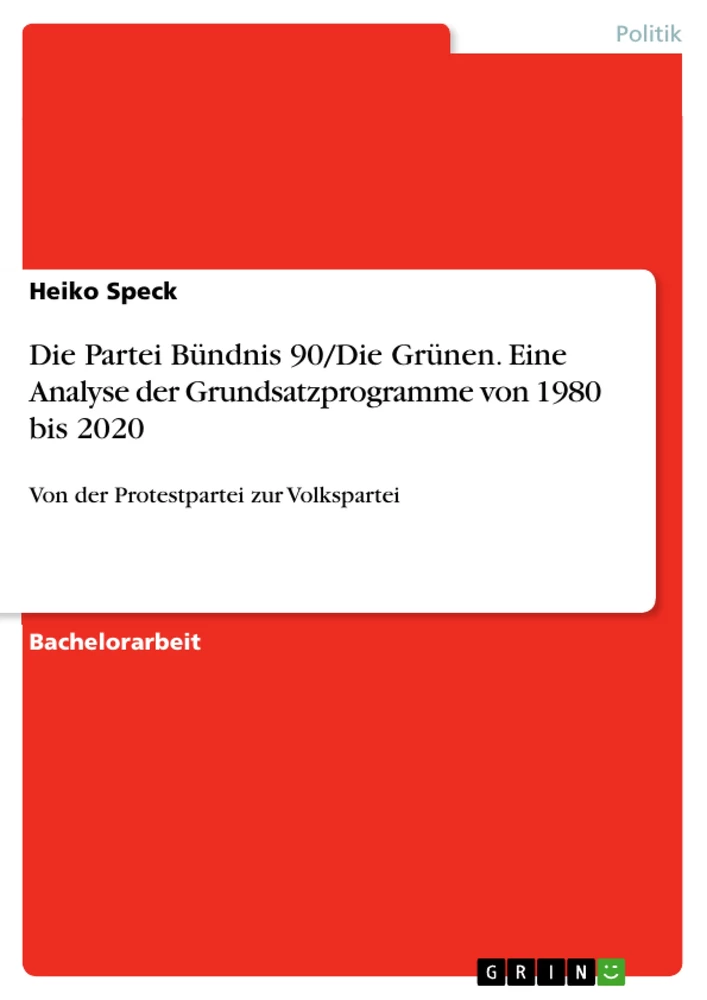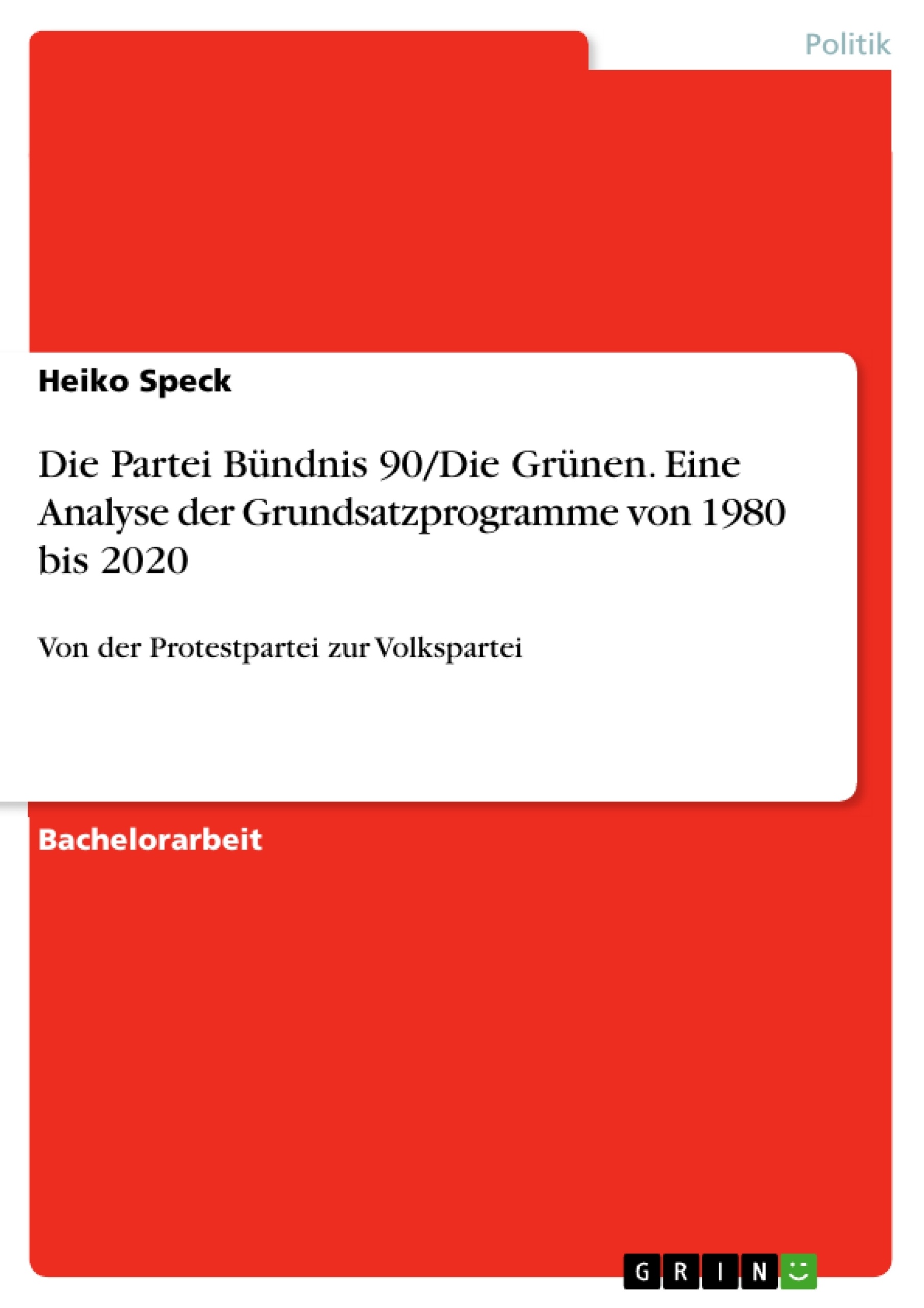Inwiefern ist die Partei Bündnis 90/Die Grünen anhand des Grundsatzprogrammes 2020 als Volkspartei zu identifizieren? Zur Betrachtung wird im Rahmen der Analyse im Detail das aktuellste Programm aus dem Jahr 2020 analysiert – ergänzend werden die Programme von 1980 und 2002 ebenfalls in Kurzform betrachtet.
Als Methodik dient in der Betrachtungsweise der Grundsatzprogramme die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring, wobei sich die Intensität der Analyse unterscheidet: Im Kern der Arbeit steht die Analyse des Grundsatzprogrammes von 2020 und inwiefern die Kriterien des Volksparteitypus, angelehnt an die Definition von Otto Kirchheimer, zutreffen. Die Programme von 1980 und 2002 werden zusammenfassend dargestellt.
Ziel ist es, die Grünen in dem politischen Feld der Parteien (nach der Bundestagswahl 2021 neben der SPD, CDU, FDP und AfD als fünfte Partei im Bundestag) programmatisch zutreffend einordnen zu können und damit eine valide Aussagekraft über den aktuellen Parteitypus zu gewinnen.
Die Partei Bündnis 90/Die Grünen hat sich innerhalb weniger Jahrzehnte von einer Vereinigung verschiedenster ökologischer Bewegungen zu einer regierungsfähigen und etablierten Partei im Deutschen Bundestag entwickelt. Über die Jahre durchliefen die Grünen seit der Gründung 1980 verschiedenste Phasen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zur Thematik der Volksparteien
- 2.1 Otto Kirchheimers „,,Wandel des westeuropäischen Parteiensystems\"
- 2.2 Entwicklung des Begriffs der Volkspartei
- 3. Methodik
- 3.1 Qualitative Inhaltsanalyse der Grundsatzprogramme
- 3.2 Kategorisierung zur Analyse des Volksparteientypus
- 4. Grüne Politik – eine umweltpolitische Bewegung wird zur Partei
- 4.1 Entstehungsgeschichte der Grünen und Relevanz grüner Politik
- 4.2 Die Grundsatzprogramme der Grünen
- 4.2.1 Das erste Grundsatzprogramm 1980
- 4.2.2 Das zweite Grundsatzprogramm 2002
- 4.2.3 Das dritte Grundsatzprogramm 2020
- 4.3 Bisherige Versuche der Klassifizierung zur Volkspartei
- 5. Spezifische Analyse des Volksparteienbegriffes im Grundsatzprogramm 2020
- 5.1 Strukturierte Analyse nach den fünf Dimensionen
- 5.1.1 Politische Dimension
- 5.1.2 Gesellschaftliche Dimension
- 5.1.3 Konzeptionelle Dimension
- 5.1.4 Kulturelle Dimension
- 5.1.5 Regierungsfähige Dimension
- 5.2 Ergebnis der Analyse
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Grundsatzprogramme der Partei Bündnis 90/Die Grünen von 1980 bis 2020, um zu untersuchen, inwieweit sich die Partei im Laufe der Zeit zu einer Volkspartei entwickelt hat. Sie untersucht insbesondere das aktuelle Grundsatzprogramm von 2020 anhand spezifischer Kriterien und analysiert, inwieweit es als Ausdruck einer Volkspartei betrachtet werden kann.
- Entwicklung der Grünen von einer Protestpartei zu einer etablierten Partei
- Analyse des Volksparteienbegriffes im Kontext der Grünen
- Klassifizierung der Grünen anhand der Grundsatzprogramme
- Vergleich verschiedener Programmatik-Epochen der Grünen
- Analyse der programmatischen Entwicklung der Grünen im Hinblick auf Volksparteikriterien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Motivation der Arbeit vor. Kapitel 2 definiert den Begriff der Volkspartei anhand von verschiedenen wissenschaftlichen Ansätzen und historischen Entwicklungen. Kapitel 3 erläutert die methodische Herangehensweise, die qualitative Inhaltsanalyse der Grundsatzprogramme, sowie die Kategorisierung der Volksparteikriterien. Kapitel 4 beleuchtet die Entstehungsgeschichte der Grünen und die Relevanz grüner Politik. Es werden die drei Grundsatzprogramme der Grünen aus den Jahren 1980, 2002 und 2020 vorgestellt.
Kapitel 5 analysiert das Grundsatzprogramm von 2020 im Detail anhand spezifischer Kriterien, die für die Klassifizierung einer Volkspartei relevant sind. Das Ergebnis der Analyse wird in Kapitel 6 zusammengefasst und interpretiert.
Schlüsselwörter
Volkspartei, Bündnis 90/Die Grünen, Grundsatzprogramme, qualitative Inhaltsanalyse, Protestpartei, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Politikwissenschaft, politische Transformation, Regierungsfähigkeit.
- Arbeit zitieren
- Heiko Speck (Autor:in), 2021, Die Partei Bündnis 90/Die Grünen. Eine Analyse der Grundsatzprogramme von 1980 bis 2020, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1194176