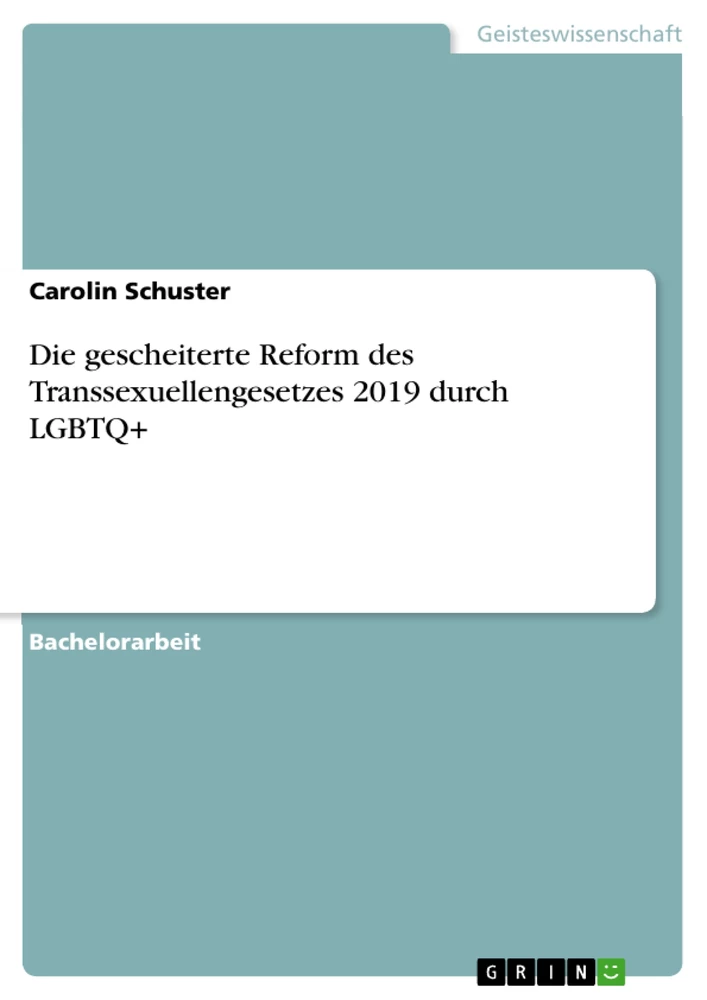Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, aus welchen Gründen die Verbände der LGBTQ+-Community (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Plus) den Reformentwurf des Transsexuellengesetzes (TSG) aus Mai 2019 ablehnten und welche Regelungen ein gelungener Gesetzesentwurf enthalten sollte. Dazu wurden 25 Stellungnahmen von LGBTQ+-Verbänden zum Reformentwurf des Transsexuellengesetzes ausgewertet und zusammengefasst.
Die Auswertung zeigt, dass der Gesetzesentwurf aus Sicht der Verbände lediglich acht Verbesserungen beinhaltet hätte. Allerdings ergaben sich 13 Kritikpunkte und fünf unerfüllte Forderungen an eine Neufassung des Gesetzes.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Begriffe
- 1.1.1 Trans*/ Transgeschlechtlichkeit
- 1.1.2 Inter*/ Intersexualität
- 1.2 Methodik
- 2 Das Transsexuellengesetz
- 2.1 Das geltende Transsexuellengesetz
- 2.1.1 Vornamensänderung
- 2.1.2 Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit
- 2.2 Die geplante Reform des Transsexuellengesetzes
- 2.2.1 Gründe für die Reform des Transsexuellengesetzes
- 2.2.2 Inhalte der geplanten Reform des Transsexuellengesetzes
- 3 Stellungnahmen der LGBTQ+-Verbände
- 3.1 Positive Aspekte des Reformentwurfs
- 3.2 Kritikpunkte am Reformentwurf
- 3.2.1 Große Unterscheidung der Regelungen zwischen trans* und inter* Personen
- 3.2.2 Überholtes Verständnis von Trans*- und Intergeschlechtlichkeit/ krumme Formulierungen und unzutreffende Definitionen
- 3.2.3 Gerichtliche Verfahren für Vornamens- und/oder Personenstandsänderung für trans*Personen
- 3.2.4 Beratungszwang für trans*Personen
- 3.2.5 Änderung des Geschlechts ist weiterhin fremdbestimmt
- 3.2.6 Anhaltende Begutachtung unter „Deckmantel“ von Beratung
- 3.2.7 Ehegattenbefragung
- 3.2.8 Regelung zur erneuten Antragstellung
- 3.2.9 Jugendliche ab 14 Jahren brauchen die Zustimmung ihrer Eltern oder müssen das Familiengericht anrufen, um einen Antrag auf eine Vornamens- und/oder Personenstandsänderung stellen zu können
- 3.2.10 Regelung der Elternschaft (alter Vorname und falsche Elternbezeichnung in Urkunden)
- 3.2.11 Notwendigkeit einer ärztlichen Bescheinigung (oder Versicherung an Eides statt) für inter* Personen
- 3.2.12 Glaubwürdigkeitsprüfung durch Beratungsstelle
- 3.2.13 Keine wissenschaftliche Basis für die Feststellung der Ernsthaftigkeit, Dauerhaftigkeit oder Unumkehrbarkeit von Transgeschlechtlichkeit
- 3.3 Forderungen der Verbände
- 3.3.1 Aufheben der Beschränkung der Beratung durch medizinisch oder psychotherapeutisch ausgebildete Personen sowie Durchführung von psychosozialer und/oder Trans*Peer-Beratung
- 3.3.2 Angleichung der beiden Verfahrensarten zu einem administrativen Verfahren mit Selbsterklärung zur Geschlechtszugehörigkeit vor dem Standesamt
- 3.3.3 Streichen der Begründungspflicht in der Beratungsbescheinigung
- 3.3.4 Sanktionen für den Verstoß gegen das Offenbarungsverbot und Recht auf Änderung von nicht amtlichen Dokumenten
- 3.3.5 Eintrag des aktuellen Vornamens und der sozialen Rolle in Geburtsurkunden; Ausstellung neuer Urkunden
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Ablehnung des Reformentwurfs des Transsexuellengesetzes (TSG) von 2019 durch LGBTQ+-Verbände. Ziel ist es, die Gründe für die Ablehnung zu identifizieren und die von den Verbänden geforderten Regelungen für einen gelungenen Gesetzesentwurf zu ermitteln. Die Arbeit analysiert die Stellungnahmen der Verbände und fasst deren Kritikpunkte und positiven Aspekte zusammen.
- Bewertung des Reformentwurfs des TSG durch LGBTQ+-Verbände
- Analyse der Kritikpunkte der Verbände am Reformentwurf
- Identifizierung der positiven Aspekte des Reformentwurfs aus Sicht der Verbände
- Zusammenstellung der Forderungen der Verbände an eine Neufassung des Gesetzes
- Untersuchung des Verständnisses von Trans- und Intersexualität im Reformentwurf
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Bachelorarbeit ein und definiert wichtige Begriffe wie Trans- und Intersexualität. Es beschreibt auch die Methodik der Arbeit, die auf der Auswertung von Stellungnahmen von LGBTQ+-Verbänden basiert.
2 Das Transsexuellengesetz: Dieses Kapitel beschreibt das geltende Transsexuellengesetz und seine geplante Reform. Es beleuchtet die Gründe für die Reform und deren Inhalte. Es wird auf die bestehenden Regelungen zur Vornamensänderung und zur Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit eingegangen.
3 Stellungnahmen der LGBTQ+-Verbände: Dieser zentrale Abschnitt präsentiert die Auswertung der Stellungnahmen der LGBTQ+-Verbände zum Reformentwurf. Er gliedert die Ergebnisse in positive Aspekte, Kritikpunkte und Forderungen. Die Kritikpunkte reichen von einem überholten Verständnis von Trans- und Intersexualität bis hin zu Ungleichbehandlungen und unnötigen bürokratischen Hürden. Die positiven Aspekte konzentrieren sich vorwiegend auf das Ablösen des TSG als Spezialgesetz und die Schaffung von Beratungsstrukturen. Die Forderungen der Verbände zielen auf eine Angleichung der Verfahren für trans- und intersexuelle Menschen und eine Vereinfachung des Prozesses ab.
Schlüsselwörter
Transsexuellengesetz (TSG), LGBTQ+-Community, Transgeschlechtlichkeit, Intersexualität, Reformentwurf, Verbände, Stellungnahmen, Kritikpunkte, Forderungen, Gleichbehandlung, rechtliche Verfahren, Beratung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Analyse der Ablehnung des Reformentwurfs des Transsexuellengesetzes durch LGBTQ+-Verbände
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit analysiert die Kritik und die Forderungen von LGBTQ+-Verbänden zum Reformentwurf des Transsexuellengesetzes (TSG) von 2019. Sie untersucht die Gründe für die Ablehnung des Entwurfs und fasst die Verbändeforderungen für eine gelungene Gesetzesreform zusammen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Bewertung des Reformentwurfs durch LGBTQ+-Verbände, Analyse der Kritikpunkte, Identifizierung positiver Aspekte, Zusammenfassung der Forderungen der Verbände, Untersuchung des Verständnisses von Trans- und Intersexualität im Reformentwurf sowie eine detaillierte Darstellung des geltenden und des geplanten TSG.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit basiert auf der Auswertung von Stellungnahmen der LGBTQ+-Verbände zum Reformentwurf des Transsexuellengesetzes. Die Methodik wird im ersten Kapitel detailliert beschrieben.
Welche zentralen Kritikpunkte der LGBTQ+-Verbände werden genannt?
Die Kritikpunkte umfassen eine große Unterscheidung der Regelungen zwischen trans* und inter* Personen, ein überholtes Verständnis von Trans*- und Intergeschlechtlichkeit, gerichtliche Verfahren für Vornamensänderungen, Beratungszwang, fremdbestimmte Geschlechtsänderung, anhaltende Begutachtung unter dem Deckmantel der Beratung, Ehegattenbefragung, Regelungen zur erneuten Antragstellung, die Zustimmungspflicht der Eltern für Jugendliche unter 14 Jahren, Probleme mit der Elternschaft in Urkunden, die Notwendigkeit ärztlicher Bescheinigungen für inter* Personen, Glaubwürdigkeitsprüfungen und das Fehlen einer wissenschaftlichen Basis für die Feststellung der Dauerhaftigkeit von Transgeschlechtlichkeit.
Welche positiven Aspekte des Reformentwurfs werden hervorgehoben?
Die positiven Aspekte konzentrieren sich hauptsächlich auf das Ablösen des TSG als Spezialgesetz und die Schaffung von Beratungsstrukturen. Genaueres wird in Kapitel 3 der Arbeit erläutert.
Welche Forderungen stellen die LGBTQ+-Verbände auf?
Die Verbände fordern unter anderem das Aufheben der Beschränkung der Beratung, die Angleichung der Verfahren für trans- und intersexuelle Menschen, das Streichen der Begründungspflicht in der Beratungsbescheinigung, Sanktionen für Verstöße gegen das Offenbarungsverbot, die Eintragung des aktuellen Vornamens in Geburtsurkunden und die Ausstellung neuer Urkunden.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Einleitung (mit Begriffsbestimmungen und Methodik), Das Transsexuellengesetz (bestehendes und geplantes Gesetz), Stellungnahmen der LGBTQ+-Verbände (positive Aspekte, Kritikpunkte, Forderungen) und Fazit.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Verständnis der Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Transsexuellengesetz (TSG), LGBTQ+-Community, Transgeschlechtlichkeit, Intersexualität, Reformentwurf, Verbände, Stellungnahmen, Kritikpunkte, Forderungen, Gleichbehandlung und rechtliche Verfahren.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel findet sich im Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel" der Arbeit.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit den rechtlichen und gesellschaftlichen Aspekten von Trans- und Intergeschlechtlichkeit auseinandersetzen, insbesondere für Wissenschaftler, Rechtsanwälte, Politiker und Mitglieder der LGBTQ+-Community.
- Arbeit zitieren
- Carolin Schuster (Autor:in), 2020, Die gescheiterte Reform des Transsexuellengesetzes 2019 durch LGBTQ+, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1194226