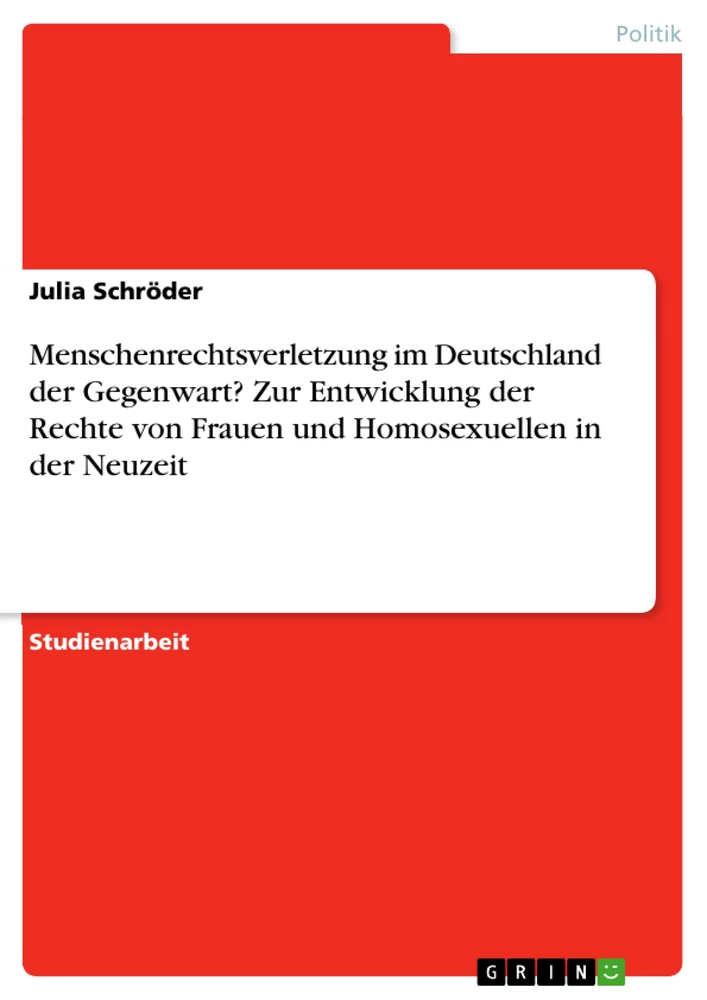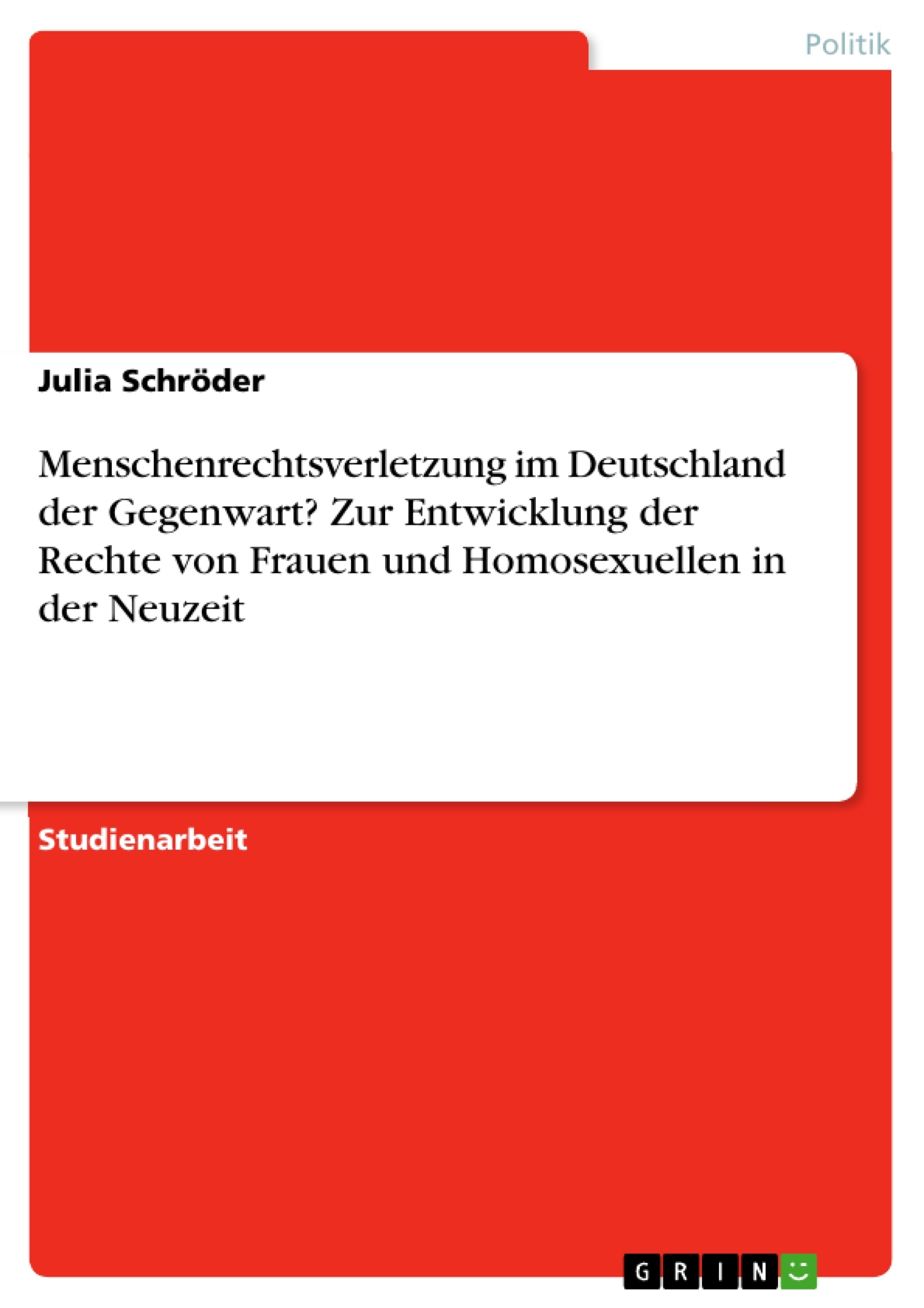Mit dem Thema „Zeitgeist“ haben wir eine Entwicklung der Rechte bestimmter, häufig benachteiligter Personengruppen verbunden. Aufgrund der heute immer noch belastenden Vorurteile gegenüber Frauen und Homosexuellen haben wir uns für die historische Entwicklung ihrer Rechte im Deutschland der Neuzeit interessiert. Daraus ergab sich die Frage „Inwieweit gibt es trotz der Entwicklung der Rechte von Frauen und Homosexuellen in der Neuzeit Menschenrechtsverletzung im Deutschland der Gegenwart?“.
Zunächst haben wir uns gemeinsam mit den Menschenrechten und der Menschenrechtsverletzung weltweit beschäftigt, um einen Überblick zu bekommen. Daraufhin werden die Rechte der beiden Gesellschaftsgruppen getrennt im historischen Kontext betrachtet und diese auf die geltenden Menschenrechte bezogen. Wir haben uns dabei ausschließlich auf die christlich abendländische Kultur bezogen, da wir aufgrund der derzeitigen Flüchtlingsproblematik nicht zusätzlich auf neue Kulturen in Deutschland eingehen können.
Diese Arbeit enthält zu Beginn Informationen zu den heutigen Menschenrechten und deren Verletzung. Es folgen die historischen Entwicklungen der gesellschaftlichen und gesetzlichen Anerkennung von Frauen und Homosexuellen bis in die Gegenwart. Schlussendlich werden die Ergebnisse auf die Menschenrechte bezogen. Das Ziel unserer Arbeit besteht in einer Meinungsbildung des Gegenwartsbezugs mit Blick auf den historischen Kontext.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Menschenrechtsverletzung
- 2.1 Geltende Menschenrechte
- 2.2 Menschenrechtsverletzung in der Gegenwart weltweit
- 2.3 Bekämpfung der Menschenrechtsverletzung
- 2.3.1 Amnesty International
- 3. Entwicklung der Frauenrechte im Deutschland der Neuzeit
- 3.1 Deutscher Bund
- 3.2 Deutsches Kaiserreich
- 3.3 Erster Weltkrieg
- 3.4 Zwischen den Weltkriegen – Weimarer Republik
- 3.5 Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg
- 3.6 Bundesrepublik Deutschland
- 3.7 Deutsche Demokratische Republik
- 3.8 Wiedervereinigung bis heute
- 4. Bezug auf die Menschenrechte
- 5. Entwicklung der Rechte Homosexueller in Deutschland
- 5.1 Deutsches Kaiserreich (1871-1918)
- 5.2 Weimarer Republik (1918-1933)
- 5.3 Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945)
- 5.3.1 Deutsche Demokratische Republik (1949-1990)
- 5.3.2 Bundesrepublik Deutschland (1949-1990)
- 5.4 Wiedervereinigung bis heute (nach 1989)
- 6. Bezug auf die Menschenrechte
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Rechte von Frauen und Homosexuellen in Deutschland im historischen Kontext und bezieht diese auf die geltenden Menschenrechte. Ziel ist es, einen Gegenwartsbezug herzustellen und die anhaltende Relevanz der Thematik im Lichte der historischen Entwicklung aufzuzeigen.
- Entwicklung der Frauenrechte in Deutschland
- Entwicklung der Rechte Homosexueller in Deutschland
- Menschenrechtsverletzungen weltweit und in Deutschland
- Die Rolle von Organisationen wie Amnesty International
- Der Bezug der historischen Entwicklungen auf die aktuellen Menschenrechte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Fragestellung der Arbeit: Inwieweit bestehen trotz der Entwicklung der Rechte von Frauen und Homosexuellen in der Neuzeit Menschenrechtsverletzungen im heutigen Deutschland? Die Arbeit fokussiert auf die christlich-abendländische Kultur aufgrund der aktuellen Flüchtlingsproblematik. Es wird ein Überblick über die Struktur der Arbeit gegeben, beginnend mit den Menschenrechten, ihrer Verletzung und Bekämpfung, gefolgt von der historischen Entwicklung der Rechte von Frauen und Homosexuellen und schließlich der Bezugnahme auf die Menschenrechte.
2. Menschenrechtsverletzung: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die geltenden Menschenrechte, ihre Verletzung und die Bemühungen um deren Bekämpfung. Es beginnt mit der Beschreibung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 und ihren zentralen Prinzipien, wie der Gleichheit vor dem Gesetz und dem Recht auf Freiheit und Sicherheit. Anschließend werden Beispiele aktueller Menschenrechtsverletzungen weltweit aufgezeigt, die von Diskriminierung aufgrund von Rasse, Religion oder Geschlecht bis hin zu Verletzungen der Meinungs- und Pressefreiheit reichen. Das Kapitel erläutert, wie Staaten und Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty International versuchen, gegen diese Verletzungen vorzugehen. Die Bedeutung von internationaler Zusammenarbeit und staatlicher Rechenschaftspflicht im Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen wird hervorgehoben.
3. Entwicklung der Frauenrechte im Deutschland der Neuzeit: Das Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Frauenrechte von ca. 1800 bis zur Gegenwart. Es beginnt mit der Darstellung der traditionellen Rollenvorstellungen, die Frauen auf den privaten Raum beschränkten und ihnen eine untergeordnete Rolle zuwiesen. Die Entstehung gegensätzlicher, egalitärer Ideale wird im Kontext der französischen Revolution diskutiert. Die Arbeit verfolgt dann die Entwicklung der Frauenrechte durch verschiedene Epochen der deutschen Geschichte, vom Deutschen Bund über das Kaiserreich und die Weimarer Republik bis zum Nationalsozialismus, der Bundesrepublik und der DDR. Dabei wird der Wandel der gesellschaftlichen und rechtlichen Anerkennung der Frau und ihrer Rolle in der Gesellschaft analysiert.
5. Entwicklung der Rechte Homosexueller in Deutschland: Dieses Kapitel zeichnet die historische Entwicklung der Rechte von Homosexuellen in Deutschland nach, beginnend mit dem Deutschen Kaiserreich, über die Weimarer Republik, die Zeit des Nationalsozialismus und die Nachkriegszeit bis zur Gegenwart. Es analysiert, wie die rechtliche und gesellschaftliche Situation Homosexueller sich in diesen unterschiedlichen Perioden entwickelt hat, die Stigmatisierung, Verfolgung und Diskriminierung, aber auch die allmähliche Verbesserung ihrer Rechte und gesellschaftlichen Akzeptanz werden thematisiert. Der Fokus liegt auf dem Wandel der rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen auf die Lebensrealität Homosexueller.
Schlüsselwörter
Menschenrechte, Menschenrechtsverletzung, Frauenrechte, Rechte Homosexueller, Deutschland, Geschichte, Neuzeit, Amnesty International, Diskriminierung, Gleichberechtigung, gesellschaftliche Entwicklung, rechtliche Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Entwicklung der Frauen- und Homosexuellenrechte in Deutschland
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Das Dokument bietet eine umfassende Übersicht über die Entwicklung der Frauen- und Homosexuellenrechte in Deutschland im historischen Kontext. Es analysiert diese Entwicklungen vor dem Hintergrund der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und beleuchtet aktuelle Menschenrechtsverletzungen weltweit und in Deutschland. Zusätzlich wird die Rolle von Organisationen wie Amnesty International thematisiert.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Die zentralen Themen sind: die Entwicklung der Frauenrechte in Deutschland von ca. 1800 bis heute; die Entwicklung der Rechte Homosexueller in Deutschland über verschiedene historische Epochen; weltweite und deutsche Menschenrechtsverletzungen; die Rolle von Amnesty International; und der Bezug der historischen Entwicklungen auf die aktuellen Menschenrechte. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die christlich-abendländische Kultur im Kontext der aktuellen Flüchtlingsproblematik.
Welche Zeiträume werden betrachtet?
Der betrachtete Zeitraum umfasst die Neuzeit, beginnend etwa um 1800, und erstreckt sich bis in die Gegenwart. Die Analyse deckt verschiedene Epochen der deutschen Geschichte ab, darunter der Deutsche Bund, das Deutsche Kaiserreich, die Weimarer Republik, der Nationalsozialismus, die Bundesrepublik Deutschland und die DDR.
Welche Kapitel beinhaltet das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung; Menschenrechtsverletzung (mit Unterkapiteln zu geltenden Menschenrechten, aktuellen Menschenrechtsverletzungen weltweit und der Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen, inklusive Amnesty International); Entwicklung der Frauenrechte in Deutschland (mit Unterkapiteln zu verschiedenen Epochen der deutschen Geschichte); Bezug auf die Menschenrechte; Entwicklung der Rechte Homosexueller in Deutschland (mit Unterkapiteln zu verschiedenen Epochen der deutschen Geschichte); Bezug auf die Menschenrechte; und Fazit.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument untersucht die Entwicklung der Rechte von Frauen und Homosexuellen in Deutschland im historischen Kontext und bezieht diese auf die geltenden Menschenrechte. Ziel ist es, einen Gegenwartsbezug herzustellen und die anhaltende Relevanz der Thematik im Lichte der historischen Entwicklung aufzuzeigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Menschenrechte, Menschenrechtsverletzung, Frauenrechte, Rechte Homosexueller, Deutschland, Geschichte, Neuzeit, Amnesty International, Diskriminierung, Gleichberechtigung, gesellschaftliche Entwicklung, rechtliche Entwicklung.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, das Dokument enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, die die wichtigsten Punkte und Erkenntnisse jedes Abschnitts hervorhebt.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist übersichtlich strukturiert mit einem Inhaltsverzeichnis, einer Zielsetzung und Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörtern. Diese Struktur ermöglicht ein einfaches und schnelles Verständnis des Inhalts.
- Quote paper
- Julia Schröder (Author), 2017, Menschenrechtsverletzung im Deutschland der Gegenwart? Zur Entwicklung der Rechte von Frauen und Homosexuellen in der Neuzeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1194414