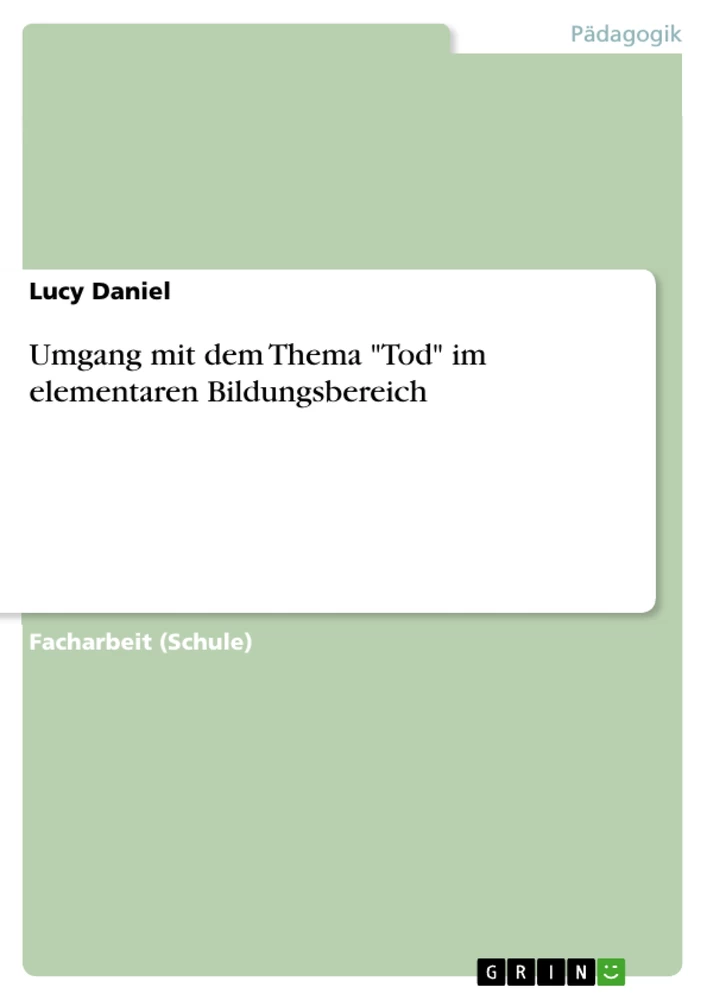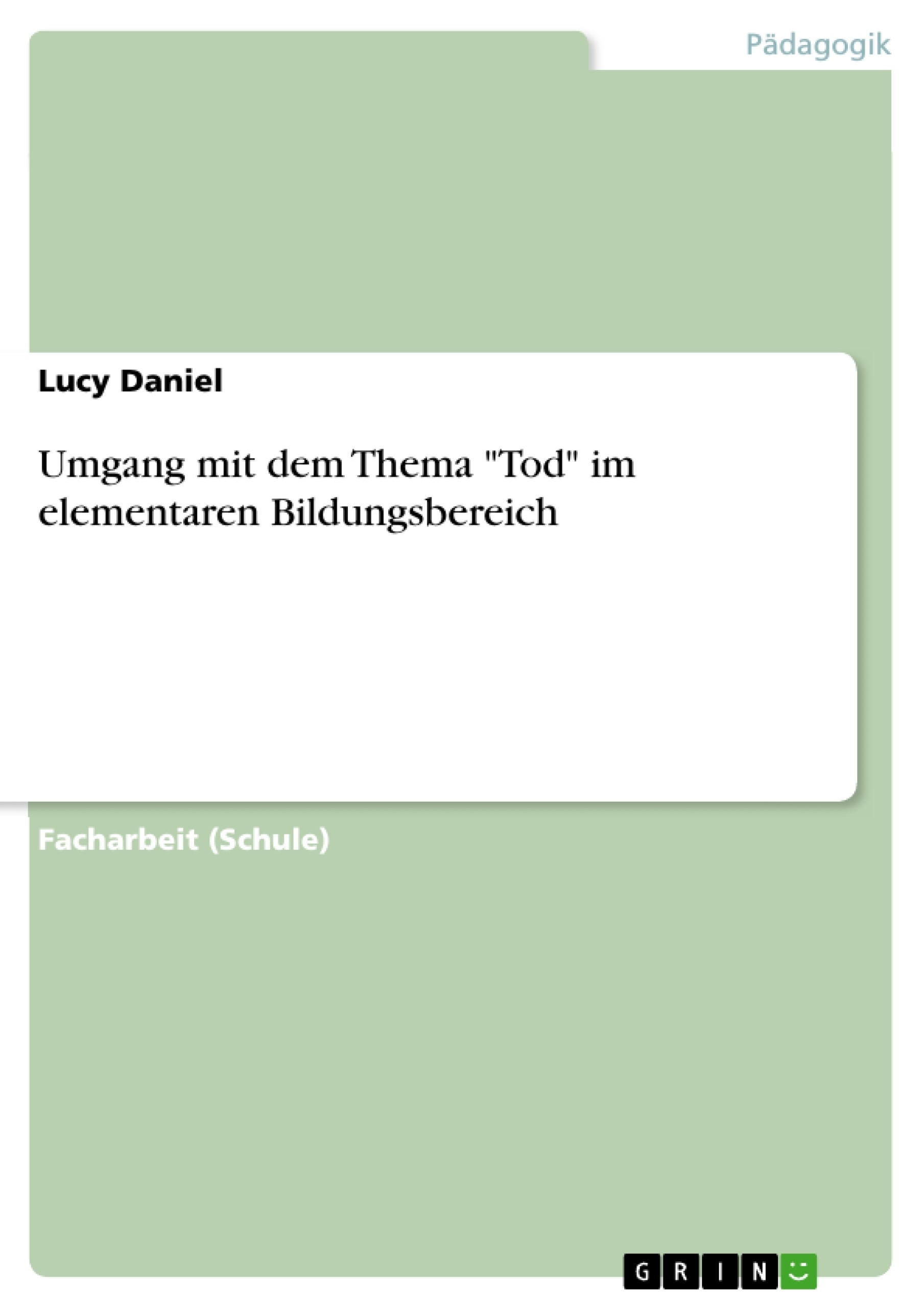Schon zum Zeitpunkt der Geburt eines Menschen steht fest, dass er einmal sterben wird. Somit ist diese Tatsache für jeden Menschen, ob alt und jung, relevant und unausweichlich.
In meiner Arbeit beschäftige ich mich mit dem „Tod“ als zum Leben gehörenden Ereignis im elementaren Bildungsbereich. Denn auch hier kann es zu einer Konfrontation mit dem Tod kommen. Ich bin der Meinung, dass es gerade in dieser Altersstufe eine große Herausforderung an die Fähigkeiten von Erzieherinnen und Erziehern ist, solche Konfrontationen zielführend zu bewältigen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Möglichkeiten der Konfrontation
2.1 Familiärer Bereich
2.2 Soziale Kontakte
2.3 Haustiere
3. Vorstellungen der Kinder vom Tod
3.1 Wie sich Kinder den Tod vorstellen
3.2 Einflussbereiche
3.3 Bewusstsein nach Altersstufen
4. Trauerbewältigung durch Trauerbegleitung
4.1 Definition Trauer
4.2 Ziele der Trauerbewältigung
4.3 Handlungsoptionen
5. Schluss
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
„Der Tod. Wir bringen ihn alle mit bei unserer Geburt.“ (Arthur Dein, 1911)
Dieses Zitat von Arthur Dein aus dem Jahr 1911 bringt für mich die Unabwendbarkeit des Todes für jeden Menschen zum Ausdruck. Schon zum Zeitpunkt der Geburt eines Menschen steht fest, dass er einmal sterben wird. Somit ist diese Tatsache für jeden Menschen, ob alt und jung, relevant und unausweichlich.
In meiner Arbeit beschäftige ich mich mit dem „Tod“ als zum Leben gehörenden Ereignis im elementaren Bildungsbereich. Denn auch hier kann es zu einer Konfrontation mit dem Tod kommen. Ich bin der Meinung, dass es gerade in dieser Altersstufe eine große Herausforderung an die Fähigkeiten von Erzieherinnen und Erziehern ist, solche Konfrontationen zielführend zu bewältigen.
Dazu erörtere ich die verschiedenen Möglichkeiten, in denen Kinder im Alter bis sechs Jahren den Tod erleben können. Das kann im familiären Bereich geschehen, aber ebenso im Bereich der sozialen Kontakte. Nicht vergessen darf man dabei die Problematik des Todes von Haustieren.
Auch die Vorstellungen der Kinder vom Tod als Ereignis sind individuell und altersabhängig. Ich beleuchte dabei die verschiedenen Einflussbereiche, denen die Kinder ausgesetzt sind. Auch das verschieden ausgeprägte Bewusstsein der Kinder je nach Altersstufe wird durch mich beleuchtet.
Da zur Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher auch die Bewältigung der Trauer gehören kann, beschäftige ich mich im Weiteren mit der Trauerbegleitung. Hierfür ist es wichtig, den Begriff der Trauer zu definieren. Für eine erfolgreiche Trauerbewältigung ist das Setzen von Zielen für diese Arbeit notwendig. Schließlich erörtere ich mehrere Handlungsoptionen zum Erreichen der Zielsetzung.
Im Schlussteil fasse ich meine während der Arbeit am Thema gewonnenen Erkenntnisse zusammen. Weiterhin erkläre ich darin, ob sich meine in dieser Einleitung geäußerte Meinung über die besondere Herausforderung an die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher bestätigt hat. Schließlich gebe ich einen Denkanstoß, wie sich die Handlungsoptionen optimieren lassen.
2. Möglichkeiten der Konfrontation
2.1 Familiärer Bereich
Die meiste Zeit im Leben von Kindern bis sechs Jahren verbringen diese im familiären Umfeld. Mutter und Vater, vielleicht vorhandene Geschwister, die Großeltern und auch gelegentlich vorbeischauende Tanten und Onkel sind dabei die üblichen Bezugspersonen. Die Wahrscheinlichkeit, dass in dieser Personengruppe ein Todesfall auftritt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
In früheren Jahrhunderten war der Tod ein völlig normaler Bestandteil des Lebens, natürlich auch für die Kinder. Noch vor etwa 100 Jahren starben die meisten Menschen, ob an Altersschwäche oder Krankheiten, einfach zuhause. Sogar die Vorbereitung der Toten für die Beerdigung und das Aufbahren fand im familiären Kreis statt. So konnten sich alle Familienmitglieder ausgiebig von den Verstorbenen verabschieden, sie nochmal sehen und so besser in Erinnerung behalten. Auch Beerdigung selbst fand unter Beteiligung der Kinder statt. (vgl. Heim / Scherm 2012, S. 53)
In den letzten 70 Jahren hat sich der Umgang mit Verstorbenen und damit mit dem Tod deutlich verändert. Das liegt einerseits an der modernen Medizin, die sehr große Fortschritte gemacht hat und weiter macht. Auch sind die persönlichen Lebensumstände der Menschen besser geworden. Dies beides führt zu einer höheren Lebenserwartung. Kinder erleben den Tod dadurch seltener. Auch die „Auslagerung“ kranker und älterer Menschen in Krankenhäuser und Pflegeheime sorgt dafür, dass der Tod als Ereignis von Kindern gar nicht wahrgenommen wird. (vgl. Heim / Scherm 2012, S. 53f)
Auch wenn das Erleben des Todes einer familiären Bezugsperson seltener geworden ist, so kann ein Kind trotzdem damit konfrontiert werden. Die Begleitung der Kinder in solchen Momenten sollte ursprünglich durch die Eltern erfolgen. Diese lagern aber diese Begleitung an dritte Personen weiter, weil sie selbst mit der Situation fertig werden müssen. Das Problem der Trauerbewältigung bringen die Kinder in den elementaren Bildungsbereich mit. Die Erziehenden können daher die Eltern der betroffenen Kinder aktiv entlasten. (vgl. Tausch-Flammer / Bickel 1994, S. 61)
2.2 Soziale Kontakte
Eine weitere Möglichkeit für Kinder, dem Ereignis des Todes zu begegnen, ist im Bereich der sozialen Kontakte. Im elementaren Bildungsbereich können es also sowohl Personen aus der Gruppe im Kindergarten, Erziehende und Betreuende in den Einrichtungen als auch Freundinnen und Freunde vom Spielplatz oder aus dem Sportverein sein. Natürlich werden auch Todesereignisse aus dem familiären Bereich mit in die sozialen Gruppen mitgebracht, wo sie dann die anderen Gruppenmitglieder damit konfrontieren.
Durch eine solche Konfrontation wird die eigentliche Stabilität der Gruppe oder Bezugssituation gefährdet. Die Kinder sind verunsichert, wie sie mit der ungewohnten Situation umgehen können. Die Zusammenarbeit der Kinder untereinander oder mit den Erziehenden kann unmöglich werden, da Lebenskrisen meist zu Veränderung des Verhaltens führen. (vgl. Witt-Loers 2013, S. 73f)
„Die Kinder benötigen die Unterstützung von Bezugspersonen, die ihren Erfahrungen einen Rahmen geben, diese spiegeln und verbalisieren.“ (Langenkamp 2016, S. 86)
Dabei ist festzustellen, dass neben den oft gleichaltrigen Kindern in der Gruppe oder auf dem Spielplatz, die Neues erzählen oder Erzähltes in ihrem Weltbild einzuordnen versuchen, natürlich die Eltern, Familien und Erziehenden ebenfalls wichtige Bezugspersonen sind. Letzteren fällt dabei eine besondere Verantwortung zu, da sie aufgrund ihrer Vorbildung besonders empathisch mit der Information über den Tod, beispielsweise eines Gruppenmitgliedes, umgehen müssen.
Dass dies gerade dann nicht einfach ist, liegt am eigenen Schmerz der Erwachsenen, der ihnen in diesem Fall natürlich auch die für die Empathie notwendige Energie raubt. Daher können im elementaren Bildungsbereich auch die Erziehenden die Quelle für Ängste und negative Fantasien der Kinder sein. Das erschwert das Verständnis vom Geschehen in der Gruppe und die Kinder fühlen sich oft allein gelassen. Diese Gefahr muss den Erziehenden immer klar sein, denn die Konfrontation mit dem Tod eines Gruppenmitgliedes ist auch für die Kinder eine plötzliche und unfreiwillige Situation. (vgl. Ennulat 2013, S. 9)
2.3 Haustiere
Ein dritter Bereich der Möglichkeiten der Konfrontation mit dem Tod ist für Kinder oft ebenso bedeutsam. Es handelt sich um Haustiere und, wenn man den Begriff etwas weiter fasst, auch um Nutztiere, beispielsweise auf einem Bauernhof. Gerade bei letzterem ist anzunehmen, dass der Tod eines Tieres häufiger eintritt und das dort lebende Kinder diesen als normal und selbstverständlich ansehen. Das beeinflusst in der Tat auch die Vorstellung der Kinder über den Tod, worauf ich in Punkt 3 dieser Arbeit noch eingehen werde.
Haustiere wie Hunde und Katzen finden wir in vielen Familien. Der Bezug zu Tieren als Lebewesen, die einen eigenen Rhythmus mitbringen, ist für viele Familien wichtig. Kinder haben im Allgemeinen Tiere gern. Ein Kontakt mit ihnen und eine Verantwortung für sie ist für die Entwicklung und das Verständnis vom Leben wichtig. Dazu gehört schließlich auch der Tod eines Haustieres. (vgl. Mead 1961, S. 82f)
Gerade bei Tieren mit kurzer Lebenserwartung wie Hamster oder Meerschweinchen ist die Wahrscheinlichkeit, auch deren Tod zu erleben, für die Kinder sehr hoch. Außerdem sind die Kinder vom Tod eines von ihnen betreuten Tieres sehr stark betroffen. Schließlich verbrachten sie meist ihre ganze bewusste Lebenszeit mit ihnen. Ein Ableben der tierischen Freunde ist dabei für die Kinder ebenso bedeutsam und einschneidend, als wäre es der Tod eines Menschen aus dem familiären Bereich. (vgl. www.mein-haustier.de, 7.11.2021)
„Auf dem Lande erleben Kinder, dass Tiere für den Menschen mehrere Funktionen haben, und sie akzeptieren das als normal. Das macht Landkindern den unbefangenen Umgang mit Tieren, auch das Töten, leichter.“ (Heubrock 2019, www.jagderleben.de)
Kinder aus dem städtischen Raum haben also meist einen anderen Bezug zu Tieren und der Tatsache, dass diese Tiere auch sterben können oder müssen. Das bedeutet jedoch nicht, dass „Landkinder“ leichter den Verlust eines tierischen Freundes verarbeiten werden. Auch hier ist es eine stets individuelle Situation.
3. Vorstellungen der Kinder vom Tod
3.1 Wie sich Kinder den Tod vorstellen
Fälschlicherweise implizieren die meisten Erwachsenen bei Kindern im elementaren Bildungsbereich, dass sie sich dem Tod und seiner Bedeutung nicht bewusst sind. Doch dem ist in Wirklichkeit nicht so. Abhängig vom Alter entwickeln Kinder durchaus klare und für sie funktionierende Todeskonzepte. Diese können sich aber von Kind zu Kind sehr stark unterscheiden. Grund dafür sind auf der einen Seite die vielfältigen Einflüsse, die aus der Umwelt und von den familiären und gesellschaftlichen Bezugspersonen auf das Kind einwirken, also die exogenen Faktoren. Genauer gehe ich darauf im Punkt 3.2 ein. Natürlich spielen auch die persönlichen Einstellungen und Erwartungen der Kinder im Rahmen der aktiven Selbststeuerung eine große Rolle. Dies behandle ich im Punkt 3.3 detaillierter. (vgl. Heim / Scherm 2012, S. 56)
Die Vielzahl der Erwachsenen sehen im Tod ein schreckliches Ereignis und versuchen, sich davor abzuschotten und zu schützen. Schnell wird diese Denkweise auch auf Kinder projiziert, da man denkt, dass Kinder ein noch größeres Problem damit haben. In der Realität sieht das jedoch ganz anders aus. Kinder sind es gewohnt, spielerisch ihre Welt zu entdecken und zu begreifen. Dabei hilft ihnen die angeborene Natürlichkeit ebenso wie die Fähigkeit, wie im Spiel von einem Lebensbereich in einen anderen zu wechseln. So benutzen Kinder bereits die Termini Tod und Sterben, bevor sie real mit diesen konfrontiert werden. (vgl. Ennulat 1997, S. 6f)
„Stocksteif kann es sich auf den Gehweg legen, der erschrockenen Mutter zurufen, jetzt bin ich tot, um danach schnell davon zu rennen.“ (Ennulat 1997, S. 7)
Werden Kinder mit dem realen Tod konfrontiert, gehen sie oft ohne Scham und Angst mit klaren Fragen auf die Erwachsenen zu. Neugierige Fragen zum Verbleib der Toten werden ebenso gestellt wie die direkte Frage nach dem Sterben als Vorgang. Damit können Kinder durchaus ihre Eltern und Erziehenden verunsichern. (vgl. Tausch-Flammert / Bickel 1994, S. 106)
3.2 Einflussbereiche
Wenn Kinder außerhalb ihrer spielerischen Weltsicht auf den Tod als reales Ereignis treffen, spielen besonders die Erwachsenen in Form von Eltern, Geschwister und Erziehenden eine beeinflussende Rolle. Dabei kommt es häufig vor, dass die Erwachsenen die Kinder davor schützen wollen, sich genauer mit dem Tod und dem Sterben auseinanderzusetzen. Begründet ist dieses Verhalten in der eigenen Angst und dem Unwillen, sich unkomfortablen Situationen stellen zu müssen. Die Bandbreite geht dabei vom puren Verschweigen oder Vertuschen über Halbwahrheiten bis hin zur Erzählung von erfundenen Geschichten und Ausflüchten. (vgl. Tausch-Flammer / Bickel 1994, S. 68)
Ein seltener gebrauchter Ansatz ist das Einbeziehen in den und Aufklären der Kinder über den natürlichen Prozess des Sterbens, denn neugierig sind die Kinder natürlich. Diese Ehrlichkeit ist dabei nicht nur für die Kinder leichter zu verstehen, sondern sie hilft auch den Eltern oder Erziehenden, besser mit der gesamten Situation umzugehen und den Verlust zu verwinden. (vgl. Rudolph 1979, S. 54)
„Es ist ein gesellschaftliches Phänomen, das Tod und Sterben fast nur noch in den Medien aber kaum in der non-medialen Wirklichkeit stattfindet.“ (Hackenberg 2021, www.medienbewusst.de)
Dieses Zitat ist zutreffend für die aktuelle Situation. Statt in den Familien selbst wird das Thema Tod sehr umfassend, sehr explizit und realistisch in den Medien dargestellt. Man kann die Nachrichten hören, sehen oder lesen – fast immer beinhalten sie eine Meldung über das Sterben oder den Tod. Das Fernhalten von der Thematik seitens der Erwachsenen, was beim realen Tod ständig praktiziert wird, findet hier gar nicht oder nur eingeschränkt statt. Ähnlich verhält es sich bei fiktionalen Inhalten.
Bei der südkoreanischen Netflix-Serie „Squid-Game“ wird die Verantwortung der Erwachsenen gegenüber den Kindern besonders deutlich. Bei jüngeren Kindern wirken die oft brutalen und realistischen Szenen fast immer traumatisch. Bleibende Schäden können entstehen, der Tod als solcher wird völlig verkannt. Hier ist ein behutsames Verständnis seitens der Erwachsenen für den Fall nötig, wenn Kinder Teile der ab 16 Jahren empfohlenen Handlung wahrgenommen haben. (www.spiegel.de, 11.11.2021)
Ein dritter für Kinder im elementarischen Bildungsbereich wichtiger Bereich sind die Märchen und Folklore in Form von religiösen Ansichten. Dabei kann ein Glauben seitens der Eltern Hoffnung und Geborgenheit vermitteln. Wird der verstorbene Großvater z.B. im Himmel verortet, so ist eine gedankliche Verbunden zwischen Kind und Großvater denkbar. Andererseits ist das „ewige Leben“ nach dem Tod hinderlich dabei, wenn man sich den wahren Ursachen zuwendet. (vgl. Tausch-Flammer / Bickel 1998, S. 70f)
Die schon beschriebene Neugier der Kinder kann durch viele Formulierungen der Religionen oft nicht kindgerecht befriedigt werden. Trotzdem wird seitens der Eltern und anderer Erwachsener die Religion an die Kinder weitergegeben. Für einige Menschen ist dieses Wissen glaubwürdig und eine Identifikation damit möglich. Daher wird es auch mit den Kindern geteilt. Für andere hingegen fällt Religion in den Bereich Legende oder Märchen und auch hier wird diese Einstellung meist an die Kinder weitergegeben. (vgl. Tausch-Flammer / Bickel 1998, S. 69)
„Im Gegensatz zum Teufel, dem in Märchen der Schrecken genommen wird indem er regelmäßig überlistet wird, versagt dieser Optimismus beim Tod, er wird im Märchen sehr ernst genommen.“ (Freund 2005, S. 107)
In den beliebten Märchen der Gebrüder Grimm ist der Tod zumindest für die Protagonisten oft von vorübergehender Natur. Schneewittchen wacht wieder auf, die sieben Geißlein und auch Rotkäppchen überleben sogar den Aufenthalt im Magen des Wolfes. Auch Dornröschen beendet ihren hundertjährigen Schlaf nach einem Kuss des Prinzen. Das Böse hingegen erlebt einen endgültigen Tod, der häufig auch sehr grausam ist. (vgl. Neumann / Schmidt 2012, S. 109)
Auch wenn das Erzählen über den Tod im Märchen auf den ersten Blick schrecklich erscheint, so hilft es den Kindern, Prozesse und Zusammenhänge in der Welt besser zu verstehen. In früheren Zeiten galten Märchen als Warnung vor reellen Gefahren und als Regelwerk für vernünftiges Verhalten. Der praktische Nutzen für das heutige Leben der Kinder scheint nicht mehr gegeben, trotzdem können sie durchaus auch aus alten Geschichten wichtige Werte entnehmen. So ist es essentiell im Märchen, dass nach dem Tod das Leben für die anderen Personen weitergeht. (vgl. Schödel 1990, S. 62)
3.3 Bewusstsein nach Altersstufen
Die individuellen Bilder, die Kinder sich vom Sterben oder dem Tod machen, sind nicht nur von den sozialen Bezugspersonen, den Medien und Märchen abhängig, sondern durchaus vom jeweiligen Alter. Je nach Entwicklungsstufe erfolgt eine andere, altersadäquate Reaktion auf den Tod. (vgl. Tausch-Flammer / Bickel 1998, S. 77)
Für Kinder im Alter von ein bis drei Jahren stellt die Abwesenheit sozialer Bezugspersonen eine beängstigende Situation dar. Da noch keine zeitliche Einordnung des Todes als dauerhafte Abwesenheit möglich ist, wird jedes Fehlen der Eltern oder Großeltern vom Kind gleich stark bedauert. So trösten z.B. Kinder ein Elternteil beim Verlust des anderen Elternteils so, als kämen die Verstorbenen nach einer gewissen Zeit wieder zurück. (vgl. Tausch-Flammer / Bickel 1998, S. 77f)
Auch im Alter von vier Jahren ist die Bedeutung des Todes als endgültiger Abschied den Kindern nicht klar vorstellbar. Durch die Erzählung von Märchen und den ersten medialen Erfahrungen ergibt sich den Kindern ein erstes Bild des Todes. Der Begriff selbst ist schon vorstellbar, allerdings werden noch immer keine spezifischen Gefühlsreaktionen hervorgerufen. (vgl. Rudolph 1979, S. 10)
Fünfjährige Kinder beginnen intensiv, sich für die Vorgänge in ihrem Umfeld zu interessieren. Fragen zum Tod gehören oft mit dazu. Allerdings ist das Verstehen der Endgültigkeit des Versterbens noch immer nicht präsent, es wird weiter auf eine Rückkehr gehofft. Diese innere Unsicherheit kann schon abgelegte Ängste und Verhaltensweisen wieder reaktivieren, ein Rückfall in das Kleinkindalter mit Bettnässen kann temporär auftreten. (vgl. Tausch-Flammer / Bickel 1998, S. 78)
Mit sechs Jahren treten erstmal emotionale Reaktionen bei den Kindern auf. Das Prinzip von Ursache und Wirkung in Bezug auf das Sterben als Prozess wird von den Kindern weitgehend erkannt. Die Verlustangst wird spezifischer, weil der Tod als endgültig verstanden und eine Wiederkehr ausgeschlossen wird. Die in Punkt 3.2 beschriebenen Einflüsse werden stärker reflektiert und der Tod von Erwachsenen, Kindern und auch Tieren vom Prozess an sich miteinander in Verbindung gebracht. Die Möglichkeit des eigenen Todes hat dabei allerdings noch keinen Platz. (vgl. Rudolph 1979, S. 10f)
4. Trauerbewältigung durch Trauerbegleitung
4.1 Definition Trauer
„Trauer ist eine natürlich Reaktion auf einen Verlust. Sie erfasst den Menschen als Ganzen und zeigt sich bei jedem auf individuelle Weise.“ (Witt-Loers 2013, S. 24)
Trauer empfinden wir als eine menschliche Reaktion auf den Verlust von für uns wichtigen Lebewesen und Objekten. So trauern wir natürlich auch um uns nahestehende Menschen. Dabei gilt, dass die Stärke der Trauer auch mit der Nähe und der Beziehung zu den Verstorbenen zusammenhängt. Die Trauer zeigt sich dabei durch viele, oft nicht zueinander passende Gefühle. Dazu gehören sehr oft Schmerz und Verzweiflung, aber auch Liebe, Dankbarkeit, Wut, Hass oder einfach Angst. (vgl. Witt-Loers 2013, S. 24)
Sehr häufig kommt es zu starken Gefühlsschwankungen der Trauernden. Gerade Kinder werden dadurch stark überfordert und neigen dazu, diese verschiedenen Gefühle in sich zu verstecken. Das liegt daran, dass diese neuen Erfahrungen durch die Konfrontation mit dem Tod die Kinder einfach überfordern. Wird diese Überforderung nicht erkannt, können sich Verhaltensweisen dramatisch und dauerhaft verändern. Auch die körperliche Entwicklung kann beeinflusst werden. (vgl. Heim / Scherm 2012, S. 57)
Deshalb ist das Zulassen von Trauer gerade bei Kindern sehr wichtig, um die neue Situation nach dem Verlust annehmen zu können. Letzterer kann dadurch besser in das zukünftige Leben integriert werden. Der Trauerprozess erfordert dabei viel Kraft und Arbeit durch die Eltern und Erziehenden und sollte frühzeitig beginnen. Dabei ist die Dauer der Trauerperiode zeitlich je nach Kind unterschiedlich lang und intensiv. Manche Menschen werden ein Leben lang von ihrer Trauer begleitet, dafür ist es aber notwendig, dass der Verlust selbst zumindest akzeptiert ist. (vgl. Witt-Loers 2013, S. 25)
4.2 Ziele der Trauerbewältigung
Wir haben im Punkt 4.1 gelernt, dass der Umgang mit trauernden Kindern stets individuell und passend sein muss. Die Einzigartigkeit eines jeden Menschen ist zu beachten. Daraus kann man ableiten, dass eine universelle Handlungsweise, die für alle Kinder anwendbar ist, nicht existiert. Ist man sich dieses Umstands bewusst, können Erziehende im elementaren Bildungsbereich der möglichen Machtlosigkeit beim Umgang mit der Trauer von Kindern vorbeugen. (vgl. Witt-Loers 2013, S. 14)
Ein wichtiges Ziel ist es, für das trauernde Kind außerhalb der Familie ein vertrauenswürdiger Ansprechpartner bei der Trauerbegleitung zu sein und zu bleiben. Wenn das Thema Tod in der Familie bisher gar kein Thema war, sind oft die Erziehenden die wichtigsten Ansprechpartner. Sie müssen schon aufgrund ihrer Ausbildung besser auf diese Situation vorbereitet sein. Ihr Ziel ist dabei die kindgerechte Bewältigung der Trauer. (vgl. Tausch-Flammer / Bickel 1998, S. 65)
„Doch der Tod hält sich nicht an altersgemäße Entwicklungsgesetze, setzt vielmehr alle menschlichen Übereinkünfte außer Kraft. Kein Kinderschutzbund kann ihn verhindern!“ (Ennolat 1998, www.kindergartenpaedagogik.de)
Ein weiteres Ziel ist daher, dass sich die Erziehenden vorbeugend darauf vorbereiten, die dadurch entstehenden Spannungen auszuhalten und dem trauernden Kind den notwendigen Raum zu geben. Eine Kollision mit dem geschützten Raum des elementaren Bildungsbereiches ist nicht zu umgehen. Daher muss primär Empathie bei den Erziehenden gegeben sein oder nötigenfalls entwickelt werden. Auch die Vorbereitung auf eine mögliche starke Neugier ist hilfreich, Beispiele aus eigenem Erleben, besonders aus der Kindheit, können hier genutzt werden. (vgl. www.kindergartenpaedagogik.de, 14.11.2021)
Schließlich ist das Zulassen vom Traurigsein eine Grundaufgabe von Erziehenden, um die Traurigkeit des Kindes zu überwinden. Die anderen Kinder in der Gruppe sind dabei einzubeziehen. Sollte das trauernde Kind beispielsweise weinen, ist ein Verständnis der Gruppe wichtig. Es muss also nicht nur das trauernde Kind unterstützt werden, sondern auch die anderen Gruppenmitglieder brauchen diese Unterstützung. Oberstes Ziel ist es, dass das Gruppengefüge durch den Einschnitt nicht dauerhaft gestört wird. Dies erscheint zu Beginn als sehr große Aufgabe, jedoch erleichtert die frühzeitige zielgerichtete Arbeit der Erziehenden diesen natürlichen Prozess deutlich. (vgl. Baer 2018, S. 30f)
4.3 Handlungsoptionen
Die wichtigste Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Trauerbegleitung im elementaren Bildungsbereich ist es, wenn die Erziehenden dem Prozess gegenüber aufgeschlossen und vorbereitet sind. Gerade Kindern soll eine bestmögliche Begleitung zukommen, sie sollen nach Möglichkeit nicht mit ihrer Trauer und ihren Gefühlen alleingelassen werden. Trotzdem gibt es Situationen, in welchen sie einen besonderen Freiraum benötigen. Sind die Erziehenden dann mit Offenheit und Verständnis für das Kind da, findet es Vertrauen und Ansprechpartner für seine zahlreichen Fragen. (vgl. Tausch-Flammer / Bickel 1998, S. 61ff)
Im Gegensatz zum Zuhause des Kindes, in welchem es durch den Todesfall zu gravierenden Änderungen kommen kann, ist der Kindergarten ein stabiles Umfeld. Hier halten sich die Änderungen zuerst einmal in engen Grenzen. Diese Vertrautheit ist für das Kind sehr hilfreich und soll durch die Erziehenden aufrechterhalten werden. Durch Beschäftigungen und die Gruppenkameraden ergibt sich zusätzlich eine Ablenkung für das Kind. In jedem Fall ist das Kind durch die Erziehenden im Blick zu behalten, um in kritischen Momenten dieses aufzufangen. Denn man sollte sich durch scheinbare oder wirkliche glückliche Momente des Kindes nicht über dessen wahre Gefühlslage täuschen lassen. (vgl. www.kindergartenpaedagogik.de, 18.11.2021)
„Nur was emotional eingebettet ist, löst auch ein Echo im Gegenüber aus.“ (Ennolat 1997, S. 12)
Die eigenen Gefühle der Erziehenden und ihr Standpunkt zum Thema Tod ist dabei wichtig. Gibt es eigenen Erfahrungen mit dieser Thematik? Wer mit seiner eigenen Trauer nicht klarkommt, kann sich auch kaum in die Trauerbewältigung anderer Menschen begeben. Diesem Umstand müssen die Erziehenden unbedingt Rechnung tragen. Ist dies gegeben, dann können durch gänzlich neue Erfahrungen die Gruppenarbeit und die Trauerbegleitung sinnvoll miteinander verbunden werden. Ein Besuch der ganzen Gruppe beispielsweise auf dem Friedhof kann zur Beantwortung quälender Fragen genutzt werden. Das trauernde Kind erhält Gelegenheit, über seinen Verlust direkt zu sprechen, die Gruppe lernt daraus und kann selbst Fragen stellen. Als Lerneffekt kann gesehen werden, dass der Tod ein normaler, zum Leben gehörender Umstand ist. So können die Erziehenden aus einer Außergewöhnlichkeit etwas völlig Natürliches werden lassen. (vgl. www.kindergartenpaedagogik.de, 18.11.2021)
5. Schluss
Abschließend möchte ich die in meiner Arbeit gewonnenen Erkenntnisse noch einmal kurz zusammenfassen. Im ersten Themenkomplex beschäftigte ich mich mit den Möglichkeiten der Konfrontation mit dem Tod im elementaren Bildungsbereich. Ich habe dabei herausgearbeitet, dass es neben der Familie noch zwei weitere wichtige Möglichkeiten dieser Konfrontation für das Kind gibt. Diese sind die sozialen Kontakte, also die Spielkameraden und Gruppenmitglieder sowie Erziehenden, und auch Haustiere. Gerade bei letztgenannten ist die Wahrscheinlichkeit, den Tod zu erleben, recht hoch.
Im zweiten Abschnitt habe ich herausgearbeitet, welche Vorstellungen vom Tod bei Kindern bis zum Alter von sechs Jahren vorhanden sind. Dabei habe ich die für Kinder relevanten Einflussbereiche beleuchtet und erfahren, dass gerade auch Religion und Märchen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Vorstellung haben. Allerdings ist das Bewusstsein für den Tod als endgültiges Ereignis erst etwa zum Ende des elementaren Bildungsbereiches ausgebildet ist.
Im dritten Themenkomplex konnte ich herausstellen, dass das Thema Trauer und deren Bewältigung sehr individuell ablaufen. Ziel der Arbeit sollte dabei der empathische Umgang mit dem Thema sein. Alle möglichen Handlungsoptionen sollten darauf basieren.
Zusammenfassend kann ich feststellen, dass das Thema „Tod im elementaren Bildungsbereich“ sehr viele Facetten hat und gerade in dieser Altersstufe eine große Herausforderung an die Fähigkeiten von Erzieherinnen und Erziehern ist. Um solche Konfrontationen zielführend bewältigen zu können, ist es notwendig, dass die Erziehenden vom Wissensstand aufgeklärt und auch emotional vorbereitet sind.
Gerade deshalb bin ich der Meinung, dass schon in der Ausbildung dieses Thema einen festen Platz im Lehrplan haben muss. Eine unerwartete Konfrontation, die tatsächlich schon direkt nach der Ausbildung in den ersten Wochen im neuen Beruf auftreten kann, stellt eine große Gefährdung für Erziehende und Kind gleichermaßen dar.
Dieser Gefahr möchte ich mich in meiner zukünftigen Tätigkeit nicht aussetzen und ihr deshalb durch eine gute Ausbildung vorbeugen. Eine gute Trauerbegleitung kommt allen Seiten zugute.
6. Literaturverzeichnis
Bücher:
Baer, Udo: Traumatisierte Kinder sensibel begleiten. Basiswissen & Praxisideen. Beltz Verlagsgruppe, Weinheim 2018, 1. Auflage
Dein, Arthur: Wo ist das Glück? Verlag Lüttwitz, 1911, 1. Auflage
Ennulat, Gertrud: Kinder trauern anders. Wie wir sie einfühlsam und richtig begleiten. Verlag Herder, Freiburg 2013, 9. Auflage
Freund, Winfried: Schnellkurs Märchen. DuMont Buchverlag, Köln 2005, 1. Auflage
Heim, Tanja / Scherm, Michael Joseph: Basiswissen Praktische Philosophie / Ethik für die sozialpädagogische Erstausbildung. Bildungsverlag EINS, Köln 2012, 1. Auflage
Neumann, Siegfried / Schmitt, Christoph: Sichtweisen in der Märchenforschung. Schneider Verlag, Hohengehren 2013, 1. Auflage
Rudolph, Marguerita: Wie ist das, wenn man tot ist? Mit Kindern über das Sterben reden. Otto Maier Verlag, Ravensburg 1979, 1. Auflage
Schödel, Siegfried (Hrsg.): Arbeitstexte für den Unterricht. Märchen. Reclam Verlag, Stuttgart 1990, 1. Auflage
Tausch-Flammer, Daniela / Bickel, Lis: Wenn Kinder nach dem Sterben fragen. Ein Begleitbuch für Kinder, Eltern und Erzieher. Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 1994, 1. Auflage
Witt-Loers, Stephanie: Trauernde Jugendliche in der Schule. Vandenhoeck & Ruprecht GmbH, Göttingen 2013, 1. Auflage
Zeitschriften:
Ennulat, Gertrud: Tod und Trauer im Erleben von Kindern. In: kindergarten heute. Heft 11-12, 1997
Mead, Margered: They Learn From Living Things. In: Parents‘ Magazine. Heft 2, 1961
Internetseiten:
duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00043207/DissLangenkamp.pdf / 21.11.2021 / 12.25 Uhr
www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/bildungsbereiche-erziehungsfelder/soziale-und-emotionale-erziehung-persoenlichkeitsbildung/835 / 18.11.2021 / 17.30 Uhr
www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/bildungsbereiche-erziehungsfelder/soziale-und-emotionale-erziehung-persoenlichkeitsbildung/908 / 14.11.2021 / 17.00 Uhr
www.medienbewusst.de/ratgeber/tod-und-sterben-im-film-und-fernsehen/ 8.11.2021 / 19.10 Uhr
www.mein-haustier.de/magazin/abschied-vom-haustier/ 7.11.2021 / 17.22 Uhr
www.spiegel.de/panorama/bildung/netflix-serie-squid-game-eltern-sollten-altersfreigabe-beachten-a-244d135c-751b-4a10-99db-9f83d512a4a6 / 11.11.2021 / 15.33 Uhr
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema "Tod" als ein zum Leben gehörendes Ereignis im elementaren Bildungsbereich, also bei Kindern bis zum Alter von sechs Jahren. Sie erörtert, wie Kinder mit dem Tod konfrontiert werden können und wie Erzieherinnen und Erzieher diese Konfrontationen zielführend bewältigen können.
Welche Möglichkeiten der Konfrontation mit dem Tod werden im Text behandelt?
Der Text behandelt drei Hauptbereiche der Konfrontation: den familiären Bereich, soziale Kontakte (z.B. im Kindergarten) und Haustiere.
Wie erleben Kinder den Tod im familiären Bereich?
Früher war der Tod ein normaler Bestandteil des Lebens, auch für Kinder. Heutzutage erleben Kinder den Tod seltener, da kranke und ältere Menschen oft in Krankenhäusern und Pflegeheimen untergebracht sind.
Wie erleben Kinder den Tod im Bereich der sozialen Kontakte?
Kinder können durch Todesfälle in ihrem sozialen Umfeld, wie z.B. im Kindergarten oder in Freundschaften, mit dem Tod konfrontiert werden. Dies kann die Stabilität der Gruppe gefährden und Verunsicherung auslösen.
Wie erleben Kinder den Tod von Haustieren?
Der Tod eines Haustieres kann für Kinder sehr bedeutsam und einschneidend sein, oft genauso stark wie der Tod eines Menschen aus dem familiären Bereich. Der Umgang mit Tieren und die Verantwortung für sie sind wichtig für die Entwicklung und das Verständnis vom Leben.
Welche Vorstellungen vom Tod haben Kinder?
Kinder entwickeln altersabhängig unterschiedliche Todeskonzepte. Sie können spielerisch mit dem Thema Tod umgehen, bevor sie real damit konfrontiert werden. Ihre Vorstellungen werden durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie z.B. Erwachsene, Medien und religiöse Ansichten.
Welche Rolle spielen Erwachsene bei der Vorstellung der Kinder vom Tod?
Erwachsene spielen eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung der kindlichen Vorstellung vom Tod. Oft versuchen sie, Kinder davor zu schützen, sich genauer mit dem Tod auseinanderzusetzen, was aber nicht immer der richtige Weg ist.
Wie beeinflussen Medien und Märchen die Vorstellung der Kinder vom Tod?
Die Medien können den Tod sehr explizit und realistisch darstellen, was traumatisch sein kann. Märchen, auch wenn sie oft fantastische Elemente enthalten, können Kindern helfen, Prozesse und Zusammenhänge in der Welt besser zu verstehen.
Wie ändert sich das Bewusstsein für den Tod je nach Altersstufe?
Das Verständnis für den Tod ändert sich mit dem Alter. Jüngere Kinder (1-3 Jahre) reagieren vor allem auf die Abwesenheit von Bezugspersonen. Ältere Kinder (ab 5 Jahren) beginnen, sich intensiver für die Vorgänge in ihrem Umfeld zu interessieren und Fragen zum Tod zu stellen.
Was ist Trauerbewältigung und welche Ziele hat sie?
Trauer ist eine natürliche Reaktion auf einen Verlust. Die Trauerbewältigung zielt darauf ab, trauernden Kindern zu helfen, den Verlust anzunehmen und in ihr zukünftiges Leben zu integrieren. Wichtig ist es, ein vertrauenswürdiger Ansprechpartner zu sein und dem Kind den notwendigen Raum zu geben.
Welche Handlungsoptionen gibt es bei der Trauerbegleitung im elementaren Bildungsbereich?
Wichtig ist, dass Erziehende dem Prozess gegenüber aufgeschlossen und vorbereitet sind. Sie sollen den Kindern eine bestmögliche Begleitung zukommen lassen und ein stabiles Umfeld bieten. Ein Besuch auf dem Friedhof oder die gemeinsame Gestaltung von Erinnerungen kann hilfreich sein.
- Arbeit zitieren
- Lucy Daniel (Autor:in), 2021, Umgang mit dem Thema "Tod" im elementaren Bildungsbereich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1194581